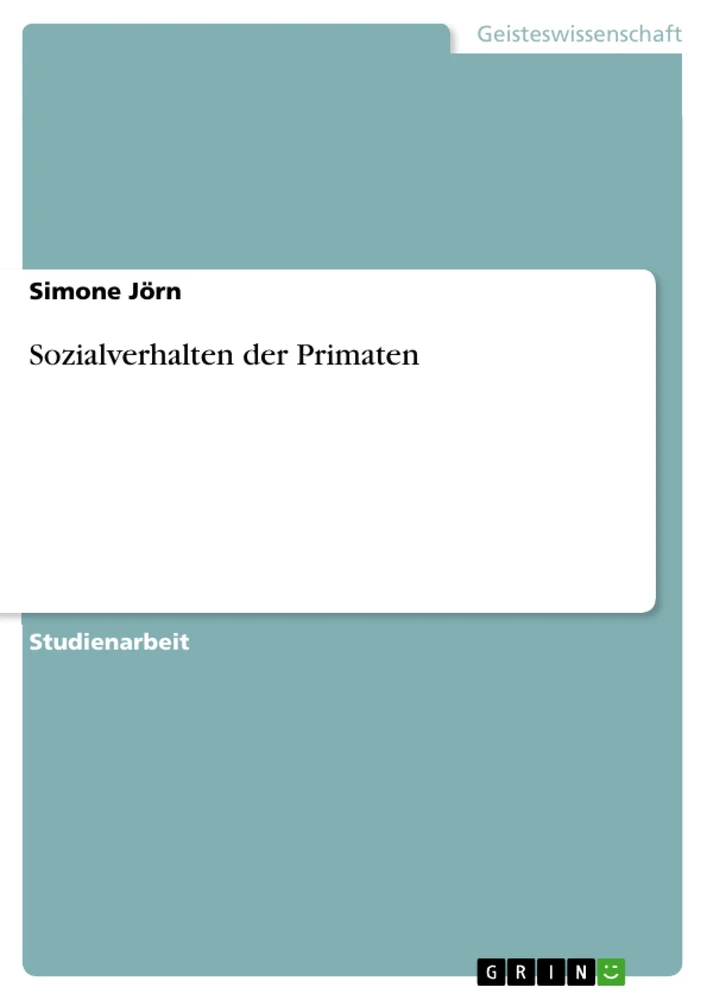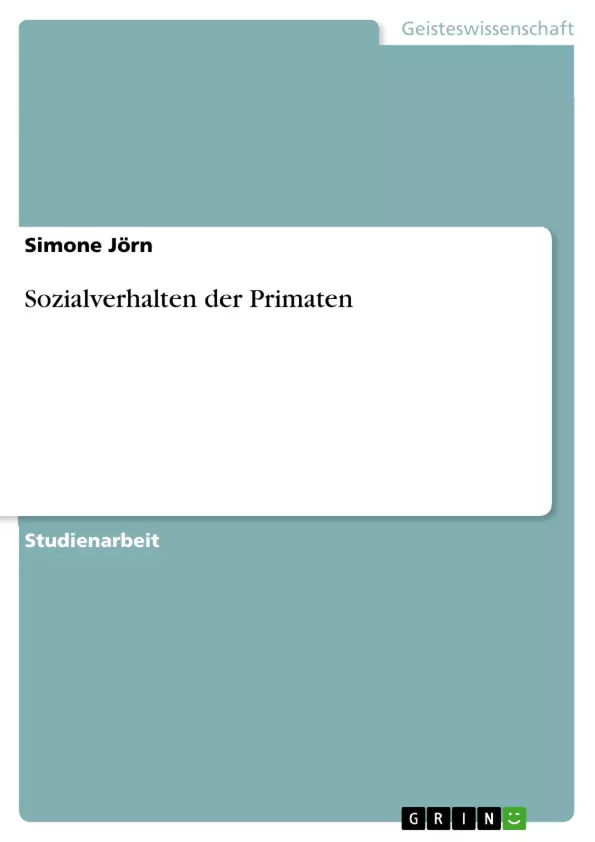Tierisches Verhalten, wie es sich beispielsweise in Territorialität, Gruppenleben und verschiedenen Fortpflanzungsstrategien äußert, kann in seiner Komplexität vielfach nicht durch zufällige Entwicklungen erklärt werden. Warum schließen Individuen Kooperationen miteinander? Weshalb leben viele Individuen in Gruppen? Welchen Sinn haben verschiedene Fortpflanzungsstrategien?
Diese Verhaltensaspekte sollen in dieser Ausarbeitung anhand einiger Beispiele hierfür relevanter Verhaltensaspekte nicht-menschlicher Primatengesellschaften, deren Sozialverhalten die möglicherweise umfassendste Ansicht tierischen Verhaltens darstellt, gedeutet werden.
Der Vorstellung von Sozial- und Paarungssystemen werden allgemeine Informationen über Primaten sowie eine Gegenüberstellung beispielhafter Unterschiede zwischen den beiden Untergruppen der Ordnung vorangestellt.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Am Beispiel des Sozialverhaltens der Primaten, das einen der komplexesten Aspekte tierischen Verhaltens darstellt, können bestimmte Verhaltensmuster in ihren Ausprägungen als Anpassungen an den spezifischen Bedingungen der Umwelt erklärt werden. Bei Betrachtung verschiedener Paarungs- und Sozialsysteme von Primaten wird ein Zusammenhang zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ökologischen Faktoren deutlich. Viele Formen sozialer Organisation, nicht nur bei nicht-menschlichen Primaten, sind als Evolutionsstrategien deutbar.
1. Einleitung
Tierisches Verhalten, wie es sich beispielsweise in Territorialität, Gruppenleben und verschiedenen Fortpflanzungsstrategien äußert, kann in seiner Komplexität vielfach nicht durch zufällige Entwicklungen erklärt werden. Warum schließen Individuen Kooperationen miteinander? Weshalb leben viele Individuen in Gruppen? Welchen Sinn haben verschiedene Fortpflanzungsstrategien?
Diese Verhaltensaspekte sollen in dieser Ausarbeitung anhand einiger Beispiele hierfür relevanter Verhaltensaspekte nicht-menschlicher Primatengesellschaften, deren Sozialverhalten die möglicherweise umfassendste Ansicht tierischen Verhaltens darstellt, gedeutet werden.
Der Vorstellung von Sozial- und Paarungssystemen werden allgemeine Informationen über Primaten sowie eine Gegenüberstellung beispielhafter Unterschiede zwischen den beiden Untergruppen der Ordnung vorangestellt.
2. Was ist ein Primat?
Mit über 230 Arten gehört die „Ordnung“ der Primaten zu den größten Hauptuntergruppen der Säugetiere. Nach welchen Kriterien werden diese Arten aber von anderen unterschieden? Anatomisch besitzen alle Angehörige dieser Hauptuntergruppe noch immer gemeinsame Merkmale, die sich im Verlauf der Evolution entwickelt haben und dem Leben auf im Wald angepasst sind. So gibt es Schlüsselmerkmale, die fast alle Primaten aufweisen: Sie besitzen nach vorne gerichtete Augen, meist Nägel anstatt Krallen, fünfstrahlige Hände und Füße sowie ein relativ großes Gehirn. Für Primaten charakteristisch ist weiterhin ein den übrigen Fingern entgegenstellbarer Daumen, der einen Pinzettengriff ermöglicht.
Der Körperbauplan der Primaten zeichnet sich durch Ursprünglichkeit aus, denn weder Ohren noch Hände und Füße unterscheiden sich in auffälliger Weise von denen älterer Säugetierarten (Dunbar& Barrett, 2001). Ansonsten ist auch die relativ lange Tragezeit des Nachwuchses für diese Ordnung charakteristisch. Und auch nach der Geburt bleibt der Nachwuchs verhältnismäßig lang beim Muttertier.
Die rezenten Arten werden in drei Hauptgruppen eingeteilt: Affen und Menschenaffen (beide Gruppen werden auch als „Anthropoide“ zusammengefasst) sowie Halbaffen (Prosimii). In der folgenden Abbildung wird der Stammbaum der Primatenarten veranschaulicht:
Abb.1 Einteilung der Primaten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Dunbar und Barrett , 2001, Seite 38)
Wie aus Abbildung 1 ersichtlich wird, werden bei den Anthropoidae zwischen Affen der Neuen Welt und Anthropoidae der Alten Welt unterschieden, wobei bei letzteren zwischen Affen und Menschenaffen differenziert wird. Zwischen den beiden Untergruppen Prosimii und Anthropoidae gibt es tendenzielle Unterschiede in Anatomie und Lebensweise, die nun beispielhaft dargestellt werden. Diese stehen mittel- und unmittelbar mit verschiedenen Aspekten des Sozialverhaltens im Zusammenhang.
2.1 Unterschiede zwischen Prosimii und Anthropoidae
Die folgende beispielhafte Gegenüberstellung soll die tendenziellen Unterschiede der Anatomie und Lebensweise zwischen Halbaffen und Anthropoiden verdeutlichen:
Halbaffen sind meist nachtaktiv und besitzen sogar häufig ein reflektierendes Tapetum im Augeninneren. Sie besitzen ein, im Vergleich zum relativ kleinen Gehirn, großes Riechzentrum, dass sowohl zur Nahrungssuche, als auch zur Individualerkennung genutzt wird. Das Sozialverhalten der solitär lebenden Tiere ist eher mäßig ausgeprägt. Halbaffen treten vornehmlich über Duftmarken und Rufe in Kontakt. Die vergleichsweise geringe Körpergröße lässt richtig vermuten, dass Halbaffen Baumbewohner sind. Sie ernähren sich zumeist von Insekten, worauf auch die kammförmige Zahnstellung dieser Arten hinweist.
Hingegen weisen die Anthropoidae ein sehr viel intensiveres soziales Miteinander auf. Die meisten Individuen leben in Gruppen miteinander. Ihr Riechzentrum ist kleiner als das der Halbaffen. Auch die Schnauzen- und Nasenregion ist verkürzt. Das Sehzentrum ist hingegen bei Vertretern dieser Arten vergrößert. Fast alle Anthropoidae sind tagaktiv und Blatt- oder Fruchtfresser. Letzteres erklärt die Entwicklung des Farbsehsinns. Außerdem weisen die terristisch lebenden Anthropoidae einen, im Vergleich zu den Halbaffen, tendenziell größeren Körperbau auf.
Da also vor allem die Anthropoidae ein intensives Sozialleben führen, liegt es nahe, eher deren soziales Miteinander untersuchen.
Im Folgenden werden die Sozial- und Paarungssysteme beispielhaft beschrieben.
3. Kooperation
Formen von Zusammenarbeit, also Kooperationen, sind bei vielen Primatenarten nicht ungewöhnlich. Sie treten in unterschiedlichen Formen auf: Sei es bei der Nahrungssuche oder bei „Machtkämpfen“ innerhalb einer Gruppe.
Auf den ersten Blick birgt ein solches Verhalten für das einzelne Individuum keinen augenscheinlichen Nutzen. Weshalb kooperieren Individuen also miteinander?
3.1 Verwandtenselektion und Reziproker Altruismus
Hamiltons Konzept der „Verwandtenselektion“ (der Begriff wurde 1964 von Maynard eingeführt) beschreibt altruistisches Verhalten als quasi „verkappten Egoismus“ (Hamilton, 1963& 1964, zitiert nach Paul, 2001, Seite 11). Der „Kampf ums Dasein“ findet zwar unter Individuen statt, diese sind aber nur Träger ihrer Gene. Ein Individuum, das die Fortpflanzungschancen eines nahen Verwandten erhöht, erzielt so indirekt eine Erhöhung seiner „Fitness“ (= genetischer Erfolg).
Für diese These spricht, dass altruistisches Verhalten besonders häufig zwischen Nahverwandten, z. B. bei Mutter und Kind oder bei Geschwistern beobachtet wird.
Allerdings ist das nicht die Regel, denn es treten auch altruistische Handlungen zwischen nichtverwandten Individuen auf. Nach dem Konzept von Trivers (1971) können diese Formen von Kooperation auf Reziprozität beruhen. „Reziproker Altruismus“ setzt voraus, dass das Verhalten dem Empfänger nützt (Erhöhung der Überlebens- und Fortpflanzungsmöglichkeiten) und mit Kosten für den Altruisten gekoppelt ist. Das Geben muss erwidert werden und zwischen Geben und Erwidern muss eine zeitliche Verzögerung bestehen (Paul, 2001).
Als Beispiel für reziproken Altruismus könnte das „Grooming“, also die Entlausung anderer Individuen gelten. Für diese These spricht, dass auch Nichtverwandte von Individuen gegroomt werden und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Gegroomte dem Individuen später nicht nur bei der Entlausung helfen wird, sondern auch in anderen Situationen wie etwa bei Rangkämpfen, Hilfestellung leistet. Gegen diese These spricht die Tatsache, dass ranghöhere Individuen häufiger „gegroomt“ werden als Rangniedere. Später ergreifen diese Individuen häufig nicht „Partei“ für ihren „Wohltäter“.
Hier muss erklärend hinzugefügt werden, dass Grooming nicht nur der Fellpflege dient. Es wirkt durch Ausschüttung bestimmter Hormone beruhigend und einschläfernd auf den Gegroomten. Es ist also beispielsweise möglich, durch Grooming einen aggressiven Artgenossen zu beruhigen oder auch eine kurzfristige Bindung zu einem Sexualpartner aufzubauen. Somit sind die Bedingungen für reziproken Altruismus nicht mehr gegeben, da der Geber einen unmittelbaren Nutzen von seinem Verhalten erwirkt.
Insofern ist „Grooming“ also nicht grundsätzlich als eine Form reziprokem Altruismus anzusehen.
4. Gruppenbildungen
Auch das Leben in Gruppen stellt eine Form von Kooperation zwischen Individuen dar. Basale Einheiten fügen sich zu teilweise komplexen und geschichteten Sozialsystemen zusammen, wobei eine verwirrende Vielfalt innerhalb der Ordnung besteht. Gruppenbildungen kommen im engeren Sinne eher bei tagaktiven Primaten zustande .Warum ist das so?
4.1 Vor- und Nachteile des Gruppenlebens
Alle nichtmenschlichen Primaten müssen sich gegen Raubfeinde verteidigen. Nachtaktive Arten zielen darauf ab nicht entdeckt zu werden und führen ihre Leben als Einzelgänger. Individuen die tagaktiv sind, genießen nicht den Schutz der Dunkelheit. Sie leben in Gruppen um Raubfeinde früher entdecken und rechtzeitig fliehen zu können. Die Wahrscheinlichkeit von einem solchen angegriffen zu werden, sinkt mit der Anzahl der in einer Gruppe lebenden Tiere. Feldstudien führten zu dem Schluss, dass die Gruppengröße vom Auftreten von Raubfeinden bestimmt wird: In Gebieten wo wenige Raubfeinde auftreten, bilden sich eher Gruppen kleinerer Größe. Im Gegensatz dazu kommt es in Gebieten mit vielen Raubfeinden nicht nur zur Bildung größerer Gruppen: Es kommt mitunter sogar zu einer „Vergesellschaftung“ verschiedener Arten, die sich zur Verteidigung gegen Raubfeinde, und sei es auch nur temporär, zusammentun. Dies ist schon im Falle von Meerkatzen und Stummelaffen beobachtet worden: Gruppen beider Arten „vergesellschafteten“ zur Verteidigung gegen Schimpansen
(Noe& Bshary, 1997, zitiert nach Paul, 2001, S.24).
Auch die Nahrungssuche gestaltet sich erfolgreicher und auch für das Pflegeverhalten bestehen bessere Möglichkeiten. Weiterhin sind Ressourcen wie Nahrung und Wasser in der Gruppe besser zu verteidigen. (McFarland, 2001).
4.2 Ökologische Faktoren verschiedener Organisationstypen
Dass das Leben in Gruppen für das Individuum auch auf Grund ökologischer Faktoren günstig ist, wurde schon angesprochen. Gibt es aber einen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und verschiedenen Organisationstypen?
Man unterscheidet nach Wrangham (1980) zwischen zwei Organisationstypen weiblicher Gruppen. Erstere zeichnet sich durch einen hohen Verwandtschaftsgrad der Weibchen aus. Kooperationen zwischen den Individuen geschehen oft. Dabei besteht zwischen den Individuen eine rigide Hierarchie. Diese Gruppen werden als „female bonded“ bezeichnet. Der andere Organisationstyp gestaltet sich im Gegenteil dadurch, dass die Beziehungen zwischen den Individuen locker sind, die Gruppen werden häufig gewechselt und zwischen den weibliche Individuen besteht kaum Verwandtschaft. Nach Wrangham spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der unterschiedlichen Organisationstypen: Die „female bonded“ Gruppen treten häufiger auf, wenn die Ressource Nahrung nur verstreut vorkommt und dabei gemeinschaftlich monopolisiert werden kann. Hierbei bilden sich sehr häufig rigide hierarchische Strukturen innerhalb einer Gruppe aus. Im Gegensatz dazu bilden größere Individuen eher nicht-„female bonded“ Gruppen. Gerade Arten, die sich von Blättern ernähren, wie beispielsweise Gorillas, sehen sich einem meist gleichmäßig verteilten Nahrungsangebot gegenüber. Die Ressource Nahrung muss nicht monopolisiert werden, so dass sich das Teilen von Nahrung für das Individuum nicht auszahlen würde (Wrangham, 1979& 1980, zitiert nach Paul, 2001, Seite 20ff). Strikte hierarchische Strukturen sind bei Gorillas aus diesem Grund kaum zu beobachten.
5. Soziale Dominanz
Welche Funktionen haben rigide Rangsysteme, wie sie zum Beispiel bei „female bonded“ Gruppen auftreten? Zum einen reduzieren und entschärfen Hierarchiestrukturen Konflikte innerhalb der Gruppe. Auf der anderen Seite regelt ein Rangsystem den Zugang zu Ressourcen, sei es zu Wasserstellen, Nahrung oder auch zu begehrten Ruheplätze.
Wie erlangt nun ein Individuum seine soziale Stellung?
5.1 Hierarchische Strukturen
Man findet zwei unterschiedliche Systeme vor, nepotistische und individualistische Hierarchien. Bei ersteren bestimmt die „Soziale Herkunft“ zu einem großen Teil die soziale Stellung des Individuums. Dabei ist die matrilineare Abstammung von Bedeutung. Meist rangieren Töchter direkt unter ihren Müttern.
Bei individualistischen Systemen spielt die physische Kondition eines Individuums die wichtigste Rolle. Hier fällt auf, dass jüngere Weibchen, im Gegensatz zu älteren Weichen, meist ranghöher situiert sind (Paul, 2001). In den verschiedenen Gruppen werden die Weibchen, bis auf wenige Ausnahmen, von den Männchen dominiert. Entweder sind die Männchen grundsätzlich über Weibchen dominant oder besetzen zumindest die höchsten Ränge. Bis auf wenige Ausnahme ist der Sexualdimorphismus stark ausgeprägt: Männchen sind tendenziell größer und kräftiger als Weibchen. Mit „Alpha-Weibchen“ ist deshalb meist nur dasjenige gemeint, das die höchste Position der Hierarchie der Weibchen einer Gruppe besetzt.
Stellen wir die Hierarchiesysteme von Männchen und Weibchen einander gegenüber, stellt sich folgendes heraus: Das Rangsystem der Männchen ist individualistisch ausgeprägt. Dabei sichert es vor allem den Zugang zu Geschlechtspartnerinnen und Nahrung. Das Alpha-Männchen, also das ranghöchste männliche Individuum, wechselt nach durchschnittlich zwei Jahren. Hingegen sind die Hierarchiestrukturen der Weibchen häufig konstanter, das Alpha-Weibchen wechselt nur etwa alle sieben Jahre. Diese Hierarchien sind, wie oben dargelegt, häufig nepotistisch, seltener individualistisch, ausgeprägt.
6. Paarungssysteme
Man differenziert zwischen den drei am häufigsten auftretenden Paarungssystemen, wobei diese in der Natur nur ganz selten in der vorgestellten „Reinform“ auftreten und sich bei einigen Arten sogar abwechseln können:
- Promiskuität:
In Gruppen mit vielen Männchen verpaaren sich Weibchen und Männchen mit mehr als einem gegengeschlechtlichen Partner.
- „Ein-Männchen-Polygynie“:
Ein Männchen verpaart sich mit mehreren Weibchen. In solchen Systemen erlangt nicht jedes Männchen die Chance, sich fortzupflanzen.
- Monogamie:
Ein Individuum verpaart sich nur mit einem gegengeschlechtlichen Partner seiner Art.
Polyandrie, was bedeutet dass sich ein Weibchen mit mehreren Männchen verpaart, wird in der obigen Auflistung nicht berücksichtigt. Zu solchen Systemen kommt es vergleichsweise selten.
Vor allem die Ressource Nahrung scheint auch hier einen Einfluss auf das Auftreten der verschiedenen Paarungssysteme auszuüben. In Gebieten mit einem weit verstreuten Nahrungsangebot kommt es eher zu promisken Systemen. Ist das Nahrungsangebot gleichmäßig verteilt, kommen tendenziell eher polygyne Paarungssysteme vor. Muss das Territorium aber zur Nahrungsversorgung gesichert werden, sind monogame Systeme häufiger vorzufinden (Paul, 2001).
6.1 Paarungssystem und Männchen-Kind-Beziehung
Lange Zeit ging man davon aus, dass die väterliche Fürsorge in monogamen Systemen ohne Ausnahme intensiv betrieben würde. Denn die Vaterschaftssicherheit eines Männchens kann in solchen Systemen einigermaßen sicher gewährleistet
werden. Untersuchungen ergaben allerdings, dass männliche Fürsorge bei Primaten in monogamen Systemen zwar häufig, aber nicht die Regel ist. Wertet man
nun auch die Daten über die Beziehungen zwischen Männchen und Jungtier in
polygynen Systemen aus, scheint die These, dass die Vaterschaftssicherheit für die
männliche Fürsorge entscheidend wäre, überholt: Die Mehrheit der Arten lässt
Väterliche Fürsorge kaum erkennen, obwohl auch hier eine fast absolute Vaterschaftssicherheit zwischen Männchen und Kind vorliegt. Deshalb stellt die Sicherheit der Vaterschaft nach Soini (Soini, 1984, zitiert nach
Paul, 2001, Seite187) keine hinreichende, sondern nur eine notwendige Voraussetzung für die Evolution väterlichen Investments bei Primaten dar. Eine Alternativhypothese für Väterliche Fürsorge ist nach Smuts und Gubernick
(Smuts& Gubernick, 1992, zitiert nach Paul, 2001, Seite 189) im Konzept des „Paarungsaufwandes“ zu sehen. Es wäre demnach möglich, dass sich das Männchen
nur um den Nachwuchs kümmert, um die zukünftigen Fortpflanzungschancen beim
Muttertier zu erhöhen und nicht etwa um das Überleben der eigenen Jungen zu gewährleisten. Als ein weiteres mögliches Beispiel männlicher Fortpflanzungsstrategien, folgt nun eine kurze Trendbeschreibung des Infantizids, wie er unter anderem auch bei Primaten dokumentiert wurde (Paul, 2001):
Infantizid (Kindstötung) durch Männchen
- Täter sind fast ausnahmslos Männchen (Digby,1995, u. a., zitiert nach Paul, 2001, Seite 49)
- Opfer sind fast immer noch nicht entwöhnte Jungtiere beiderlei Geschlechts
- Es gibt eine Häufung von Tötungen in Gruppen, in denen ein einziges Männchen das Fortpflanzungsmonopol innehat (also in polygynen Systemen häufiger, als bei promisken Arten)
- Täter sind meist erst vor kurzer Zeit in Gruppe eingewandert oder/ und in hohe Rangposition aufgestiegen
- Opfer und Täter sind in den meisten Fällen nicht verwandt
Sarah Hrdy (Hrdy, 1994, zitiert nach Paul, 2001, Seite 57) stellte als erste die Hypothese auf, dass der Infantizid eine männliche Fortpflanzungsstrategie sei, was diesen, als einziger Erklärungsansatz, widerspruchsfrei erklären würde.
Diese These würde voraussetzen, dass:
- Männchen keine Kinder töten, die sie selbst gezeugt haben
- Der Infantizid die „Laktationsamenorrhoe“ (natürliche Empfängnisverhütung während der Stillzeit) aufheben sollte
- Das infantizidale Männchen mit hoher Wahrscheinlichkeit Vater des nächsten Kindes werden (polygynes Paarungssystem) sollte
Nach Paul (2001) werden all diese Prognosen von Daten unterstützt, selbst wenn es einige wenige Fälle gibt, die nicht ganz in das Erklärungsschema passen.
7. Diskussion
Die Grundannahme vieler soziobiologischer Fragestellungen, dass erbliche Komponenten des Verhaltens durch Evolutionsmechanismen entstanden sind, wird durch die beispielhafte Vorstellung von Paarungs- und Sozialsysteme nicht-menschlicher Primaten gestützt, da auch hier Zusammenhänge zwischen den spezifischen Umweltbedingungen und verschiedenen Verhaltensaspekte deutlich wurden. Auch die Wechselwirkung der Nahrungsökologie auf die Evolution von Sozialsystemen wird deutlich. Kooperationen zwischen Individuen und Gruppenleben können als Umweltanpassungen verstanden werden. Und obwohl sich das Sozialverhalten der Primaten innerhalb der Ordnung sehr komplex und unheitlich zeigt, sind tendenzielle Abhängigkeiten zwischen Verhaltensweisen wie väterlicher Fürsorge und Fortpflanzungsstrategien aufzeigbar.
Die Mechanismen, welche die Anpassung an spezifische Umweltfaktoren steuern, sind nicht nur bei nicht-menschlichen Primaten anzunehmen. Denn auch wenn beispielsweise das menschliche Verhalten und Zusammenleben noch komplexere Varianten annimmt als das seiner nächsten Verwandten, könnten einige der vorgestellten Funktionen als basale Elemente heutiger Gesellschaften angenommen werden. Nicht zuletzt auch aus dem Grunde, dass sich der Menschen in seiner „heutigen Form“ aus tierischen Ursprüngen entwickelte. Auch seine Vertreter leben in mehr oder weniger reziproken altruistischen Systemen, mit dem Unterschied, dass deren Regeln und Konventionen nicht nur durch solche grundlegenden Prozesse entstanden sind, welche Thema dieser Ausarbeitung waren, sondern unter anderem auch durch kodifizierter Interessen bestimmte Kleingruppen.
Literaturverzeichnis
Dunbar, R. & Barrett, L. (2001). Affen: unsere haarigen Vettern. Köln: Egmont vgs verlagsgesellschaft mbH.
McFarland, D. (1999). Biologie des Verhaltens. Heidelberg: Spektrum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt das Sozialverhalten von Primaten und wie bestimmte Verhaltensmuster als Anpassungen an die spezifischen Umweltbedingungen erklärt werden können. Es werden verschiedene Paarungs- und Sozialsysteme von Primaten betrachtet und ein Zusammenhang zwischen bestimmten Verhaltensweisen und ökologischen Faktoren aufgezeigt.
Was ist ein Primat laut diesem Text?
Ein Primat wird durch anatomische Merkmale wie nach vorne gerichtete Augen, Nägel anstatt Krallen, fünfstrahlige Hände und Füße, ein relativ großes Gehirn und einen opponierbaren Daumen charakterisiert. Primaten sind an das Leben im Wald angepasst.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Prosimii und Anthropoidae?
Prosimii (Halbaffen) sind meist nachtaktiv, haben ein großes Riechzentrum und ein eher mäßig ausgeprägtes Sozialverhalten. Anthropoidae (Affen und Menschenaffen) haben ein intensiveres soziales Miteinander, ein kleineres Riechzentrum und ein vergrößertes Sehzentrum. Die meisten Anthropoidae sind tagaktiv.
Welche Formen von Kooperation werden bei Primaten beschrieben?
Der Text beschreibt Kooperationen bei der Nahrungssuche und bei "Machtkämpfen" innerhalb einer Gruppe. Es werden die Konzepte der Verwandtenselektion und des reziproken Altruismus erläutert.
Was ist Verwandtenselektion?
Verwandtenselektion beschreibt altruistisches Verhalten als "verkappten Egoismus", bei dem ein Individuum die Fortpflanzungschancen eines nahen Verwandten erhöht und so indirekt seine "Fitness" (genetischer Erfolg) steigert.
Was ist Reziproker Altruismus?
Reziproker Altruismus setzt voraus, dass das Verhalten dem Empfänger nützt (Erhöhung der Überlebens- und Fortpflanzungsmöglichkeiten) und mit Kosten für den Altruisten gekoppelt ist. Das Geben muss erwidert werden, und zwischen Geben und Erwidern muss eine zeitliche Verzögerung bestehen.
Welche Vor- und Nachteile hat das Gruppenleben für Primaten?
Vorteile sind Schutz vor Raubfeinden, erfolgreiche Nahrungssuche, bessere Möglichkeiten zur Pflege und Verteidigung von Ressourcen. Ein Nachteil wird nicht explizit genannt, aber implizit ist die Konkurrenz innerhalb der Gruppe.
Welchen Einfluss haben ökologische Faktoren auf die Organisation von Primatengruppen?
Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle. "Female bonded" Gruppen (mit hohem Verwandtschaftsgrad der Weibchen) treten häufiger auf, wenn Nahrung nur verstreut vorkommt und gemeinschaftlich monopolisiert werden kann. Nicht-"female bonded" Gruppen bilden sich eher bei Arten, die sich von gleichmäßig verteilten Ressourcen wie Blättern ernähren.
Welche Funktionen hat soziale Dominanz bei Primaten?
Hierarchiestrukturen reduzieren und entschärfen Konflikte innerhalb der Gruppe und regeln den Zugang zu Ressourcen wie Wasserstellen, Nahrung und Ruheplätze.
Welche Arten von Hierarchien gibt es?
Es gibt nepotistische Hierarchien (die soziale Stellung wird durch die "Soziale Herkunft" bestimmt) und individualistische Hierarchien (die physische Kondition ist entscheidend).
Welche Paarungssysteme werden bei Primaten unterschieden?
Es werden Promiskuität, "Ein-Männchen-Polygynie" und Monogamie unterschieden.
Welchen Einfluss hat die Ressource Nahrung auf das Auftreten der verschiedenen Paarungssysteme?
In Gebieten mit einem weit verstreuten Nahrungsangebot kommt es eher zu promisken Systemen. Bei gleichmäßig verteiltem Nahrungsangebot kommen tendenziell eher polygyne Paarungssysteme vor. Wenn das Territorium zur Nahrungsversorgung gesichert werden muss, sind monogame Systeme häufiger vorzufinden.
Was ist Infantizid und welche Rolle spielt er bei Primaten?
Infantizid ist Kindstötung, die bei Primaten vor allem von Männchen begangen wird. Es wird als männliche Fortpflanzungsstrategie interpretiert, um die "Laktationsamenorrhoe" aufzuheben und mit hoher Wahrscheinlichkeit Vater des nächsten Kindes zu werden.
- Quote paper
- Simone Jörn (Author), 2001, Sozialverhalten der Primaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/106683