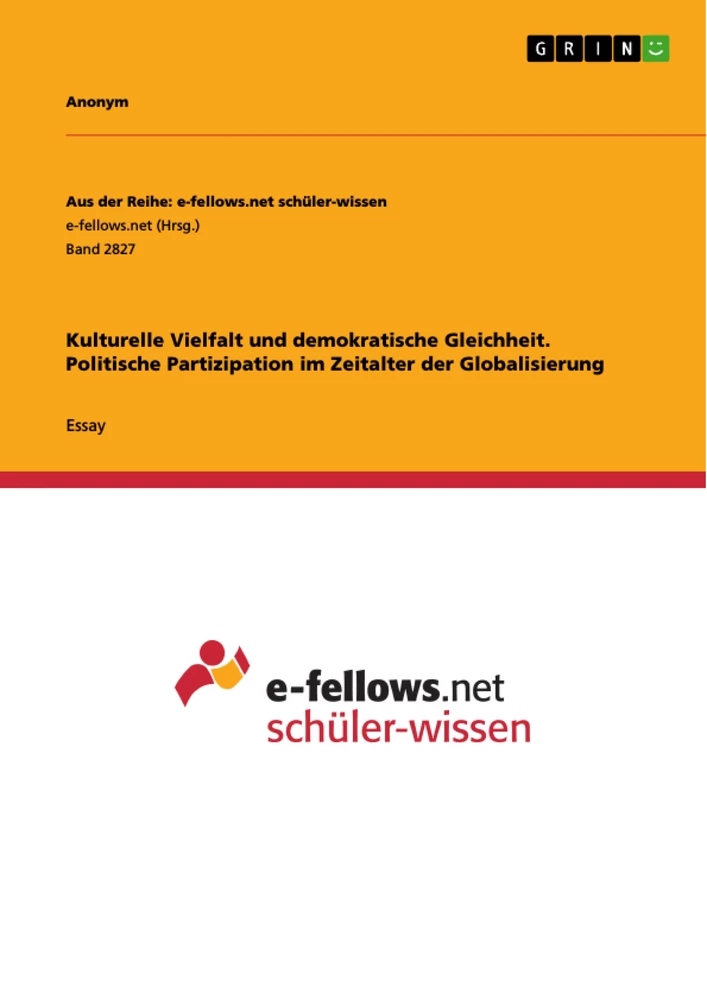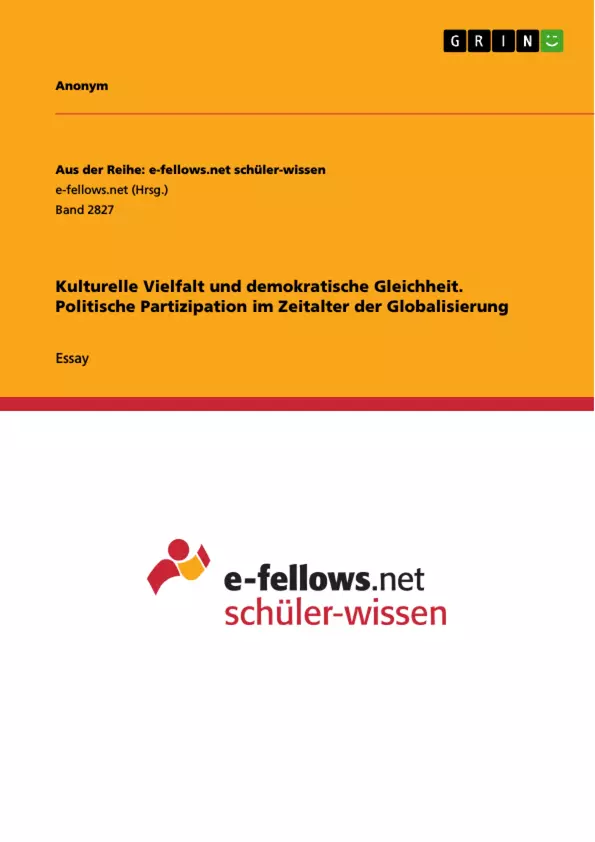In dem Text Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit-Politische Partizipation im Zeitalter der Globalisierung geht es um das Problem, dass Kämpfe um politische Anerkennung zwischen unterschiedlichen Gruppen zunehmen. In der derzeitigen politischen Theorie wird dies unter dem Begriff der Politik der Identität oder Differenz diskutiert. Eine globale Integration findet statt, jedoch mit der Folge, dass es zu Gegenbewegungen von politischer Wirkung kommt. Es entstehen neue Formen kollektiver Identität. Dabei handelt es sich um von Identität und Differenz bestimmte neue politische Bewegungen. Es wird die Frage aufgestellt, wie im Zeitalter der Globalisierung demokratische Identitäten gestaltet sein müssten.
Inhaltsverzeichnis
- Strange multiplicity- Die Politik der Identität und Differenz im globalen Zusammenhang
- Die Problematik von Identität und Differenz
- Essentialismus und Konstruktivismus
- Normative Schlüsse für die politische Kultur liberaler Demokratien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Herausforderungen, die durch die Globalisierung für demokratische Identitäten entstehen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie im Zeitalter der Globalisierung demokratische Identitäten gestaltet werden sollten. Der Text beleuchtet die wachsende Bedeutung der Politik der Identität und Differenz, die durch die Integration und Fragmentierung von Gesellschaften im globalen Kontext geprägt ist.
- Die Politik der Identität und Differenz im globalen Kontext
- Die Problematik von Essentialismus und Konstruktivismus
- Die Herausforderungen für die integrative Leistung des Nationalstaates
- Die Folgen der Globalisierung für die Gestaltung demokratischer Identitäten
- Der soziologische Blickwinkel auf Globalisierung und ihre Auswirkungen auf Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel, "Strange multiplicity- Die Politik der Identität und Differenz im globalen Zusammenhang", stellt die Argumentation des Textes vor. Es beleuchtet die Problematik von Identität und Differenz im Kontext der Globalisierung und untersucht den Gegensatz von Essentialismus und Konstruktivismus. Außerdem werden normative Schlüsse für die politische Kultur liberaler Demokratien gezogen.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Politik der Identität, Differenz, Essentialismus, Konstruktivismus, demokratische Identität, Nationalstaat, Integration, Fragmentierung, soziologische Perspektive, politische Partizipation.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Politische Partizipation im Zeitalter der Globalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1064642