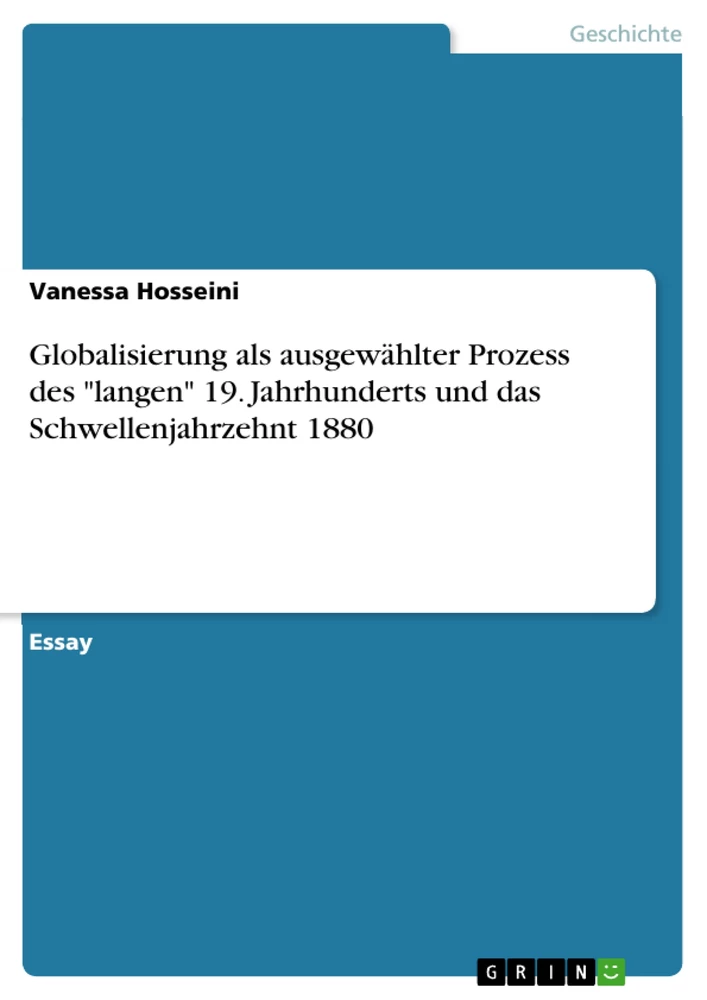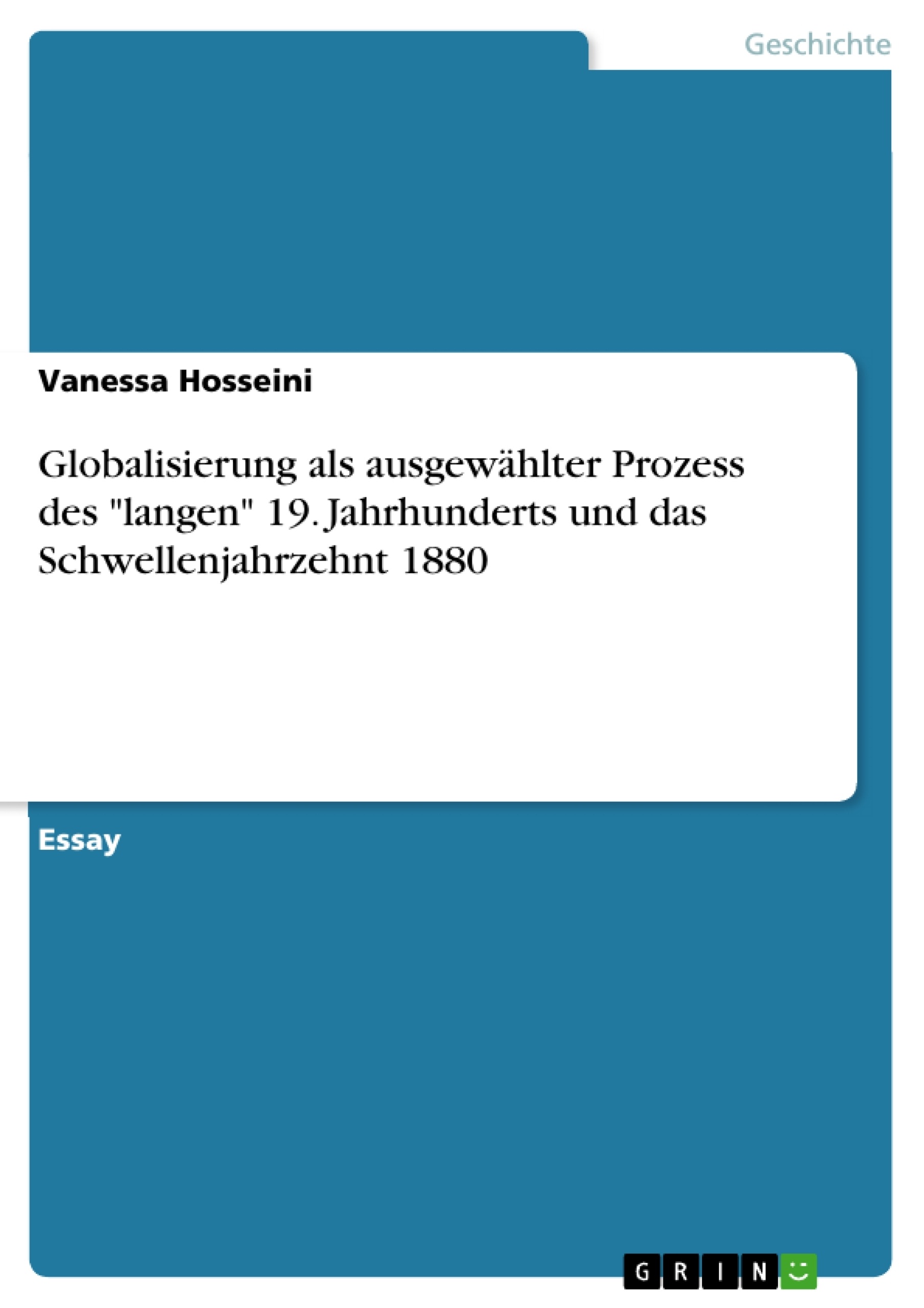Im 21. Jahrhundert hat die Globalisierung einen neuen Höhepunkt erreicht, denn durch die sozialen Medien und die Verbindung durch das Internet sind die Lebenswelten der verschiedenen Länder unveränderlich miteinander verknüpft. Doch wann begann die Verbindung über Ländergrenzen hinweg? Gab es schon zu früheren Zeiten sogenannte Wirkungsketten, die das Schicksal der Länder miteinander verband? Jürgen Osterhammel definierte die Globalisierung folgendermaßen: „Globalisierung lässt sich zusammenfassen als der Aufbau, die Verdichtung und die zunehmende Bedeutung globaler Vernetzung“.
Inhaltsverzeichnis
- Globalisierung als ausgewählter Prozess des „langen“ 19. Jahrhunderts in der Analyse
- Das Schwellenjahrzehnt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesung "Die Welt des „langen“ 19. Jahrhunderts" befasst sich mit der Epoche des Viktorianismus und Fin de Siècle. Sie analysiert die Globalisierung als zentralen Prozess des 19. Jahrhunderts und beleuchtet das Schwellenjahrzehnt 1880 als entscheidende Zäsur.
- Entwicklung und Auswirkungen der Globalisierung im 19. Jahrhundert
- Die Rolle des Schwellenjahrzehnts 1880 in der Geschichte des 19. Jahrhunderts
- Die Bedeutung der Industrialisierung und neuen Technologien
- Die Ausbreitung des Imperialismus und die koloniale Expansion
- Die Folgen der Globalisierung für verschiedene Gesellschaften und Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
Globalisierung als ausgewählter Prozess des „langen“ 19. Jahrhunderts in der Analyse
Dieser Abschnitt erklärt den Begriff der Globalisierung und erläutert, warum die Epoche des 19. Jahrhunderts als "langes" Jahrhundert betrachtet wird. Er untersucht die verschiedenen Aspekte der Globalisierung im 19. Jahrhundert, wie die zunehmende Vernetzung der Weltwirtschaft, die Industrialisierung, die Transportrevolution und die Ausbreitung von Weltsprachen. Zudem werden die negativen Folgen der Globalisierung, wie die Ausbeutung von Ressourcen und die Entwertung indigener Kulturen, thematisiert. Der Text stellt heraus, dass die Globalisierung durch verschiedene Ereignisse, wie den ersten Weltkrieg und die Spanische Grippe, beeinflusst wurde.
Das Schwellenjahrzehnt
Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Schwellenjahrzehnts der 1880er Jahre. Er zeigt, wie sich die Nutzung fossiler Brennstoffe, die Industrialisierung und technologische Fortschritte, wie die Erfindung der Glühbirne und des Automobils, auf die Gesellschaft und die Weltwirtschaft auswirkten. Der Abschnitt verdeutlicht die Rolle des Hochimperialismus und die Aufteilung Afrikas zwischen den Kolonialmächten. Das Schwellenjahrzehnt 1880 wird als eine Zeit des Wandels und Umbruchs dargestellt, in der die europäische Dominanz verstärkt wurde und Großbritannien als Wirtschaftszentrum die Welt prägte.
Schlüsselwörter
Die Vorlesung behandelt die Schlüsselthemen Globalisierung, Industrialisierung, Imperialismus, Schwellenjahrzehnt, 19. Jahrhundert, Viktorianismus, Fin de Siècle, Kolonialismus, Transportrevolution, Weltsprachen, und das Schwellenjahr 1880.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Hosseini (Autor:in), 2020, Globalisierung als ausgewählter Prozess des "langen" 19. Jahrhunderts und das Schwellenjahrzehnt 1880, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1060828