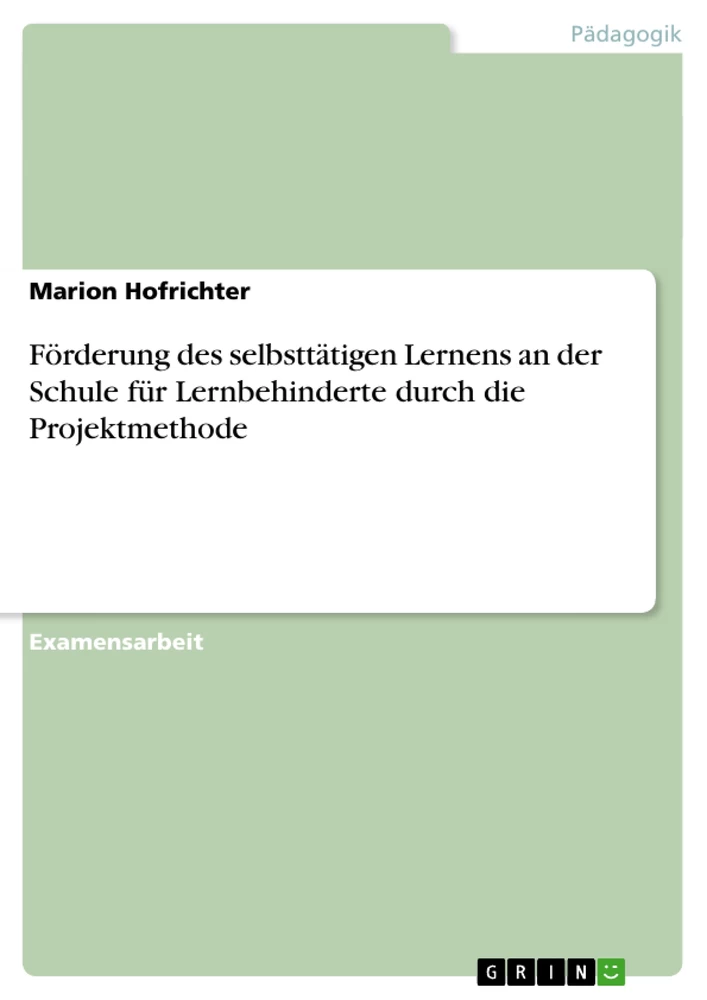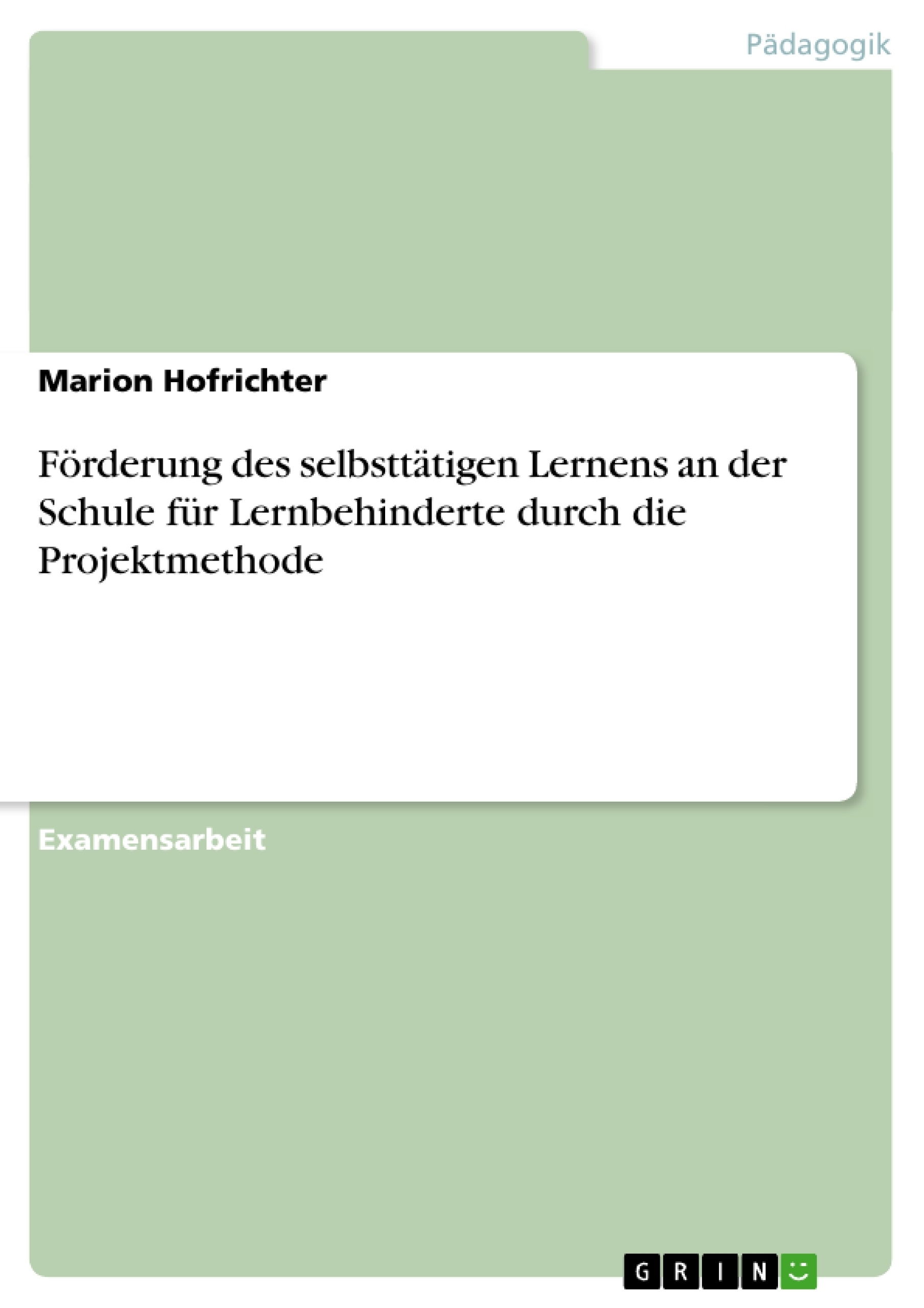Die Schule von gestern ist nicht mehr die Schule von heute. Die Kindheit hat sich aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, breiterer Informationsvermittlung und anderer Umgangsformen verändert. Um Kindern heute gerecht zu werden ist es wichtig, diese Veränderungen und Wandlungen als Grundlage für das Lernen im Blick zu halten. Schule und Lernen müssen sich verstärkt darum bemühen, vielfältige Möglichkeiten zu Eigentätigkeiten und zwischenmenschlichem Umgang zu schaffen.
In den 90er Jahren vollzogen sich grundlegende gesellschaftliche Veränderungen, damit wandelten sich auch die Anforderungen in der Berufswelt. Heute sind ganz andere Kompetenzen als noch vor 5 Jahren gefragt. Entscheidend sind Eigenschaften wie Selbstständigkeit, freier Wille und Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Methodenbeherrschung und persönliche Kompetenz. "Wissen ist heute natürlich immer noch ein wichtiger, aber nicht mehr der einzige Baustein in der Gesamtqualifikation der Schülerinnen und Schüler." (Müller 2001, S.11)
Die oben beschriebenen veränderten Anforderungen spiegeln sich auch im Schulgesetz des Landes Sachsen - Anhalt wider. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule beinhaltet u. a., eigenverantwortliches Handeln und Leistungsbereitschaft der Schüler zu fördern, sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten und sie zu individueller Wahrnehmungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit zu befähigen (vgl. Schulgesetz 1996, S. 9). In den gültigen Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen - Anhalt wird den Lehrerinnen und Lehrern die pädagogische Freiheit eingeräumt, ein Drittel der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit für offene Unterrichtsformen zu nutzen, fächerübergreifend zu unterrichten und die Schüler zu mehr Eigenaktivität und Gruppenarbeit zu befähigen.
Die vorliegende Arbeit soll sich damit beschäftigen, wie das selbsttätige Lernen der Schüler, insbesondere lernbehinderter, gefördert werden kann und welchen Beitrag Projektunterricht dazu leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Anforderungen an die schulische Bildung
- Zum Aufbau der Arbeit
- Ziele und Fragestellungen der Arbeit
- Das Projekt: „Kräuterwerkstatt“ – ein Praxisbeispiel
- Organisation und Planung
- Die Durchführung des Projektes
- Der erste Tag
- Der zweite Tag
- Der dritte Tag
- Der vierte Tag
- Die Auswertung des Projektunterrichtes
- Theoretische Grundlagen zur Durchführung des Projektunterrichtes
- Begriffsbestimmung
- Wichtige Voraussetzungen
- Merkmale des Projektunterrichtes
- Der Ablauf eines Projektes
- Besonderheiten der Projektdidaktik an der Schule für Lernbehinderte
- Projektreflexion und Schlussfolgerungen
- Das selbsttätige Lernen
- Begriffsbestimmungen
- Der neue Lernbegriff
- Das selbsttätige Lernen
- Grundsätze der Förderung selbstgesteuerten Lernens
- Wege zum selbstgesteuerten Lernen
- Direkte Instruktion
- Begriffsklärung
- Die wichtigsten Methodenkompetenzen
- Die Prinzipien des direkten Strategietrainings
- Adaptive Instruktion
- Kooperatives Lernen
- Die Stadien der Gruppenentwicklung
- Merkmale des Gruppenunterrichtes
- Formen der Gruppenarbeit
- Individuelles, selbstgesteuertes Lernen
- Die vier Stufen der Selbstständigkeit
- Methoden zur Förderung selbsttätigen Lernens
- Selbsttätigkeit im Projektunterricht
- Zusammenfassung
- Förderung der Selbsttätigkeit an der Schule für Lernbehinderte
- Zum Begriff „Lernbehinderung“
- Besonderheiten der Förderung des selbstständigen Handelns lernbehinderter Schüler
- Möglichkeiten
- Schwierigkeiten und Grenzen
- Schlussfolgerungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Förderung des selbsttätigen Lernens an der Schule für Lernbehinderte und untersucht dabei die Rolle des Projektunterrichts. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Projektunterrichts darzustellen und zu analysieren, wie dieser Ansatz zur Steigerung der Selbstständigkeit von Schülern mit Lernbehinderung beitragen kann.
- Neue Anforderungen an die schulische Bildung und die Bedeutung von Selbstständigkeit
- Theoretische Grundlagen und Merkmale des Projektunterrichts
- Förderung des selbsttätigen Lernens und verschiedene Ansätze zur Steigerung der Selbstständigkeit
- Besonderheiten der Förderung des selbstständigen Handelns von Schülern mit Lernbehinderung
- Die Rolle des Projektunterrichts zur Förderung der Selbsttätigkeit von Schülern mit Lernbehinderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den aktuellen Bedarf an selbstständigem Lernen und Eigeninitiative in der schulischen Bildung dar und erläutert die Ziele und Fragestellungen der Arbeit.
- Das zweite Kapitel beschreibt ein Praxisbeispiel eines Projektes, "Kräuterwerkstatt", das die Anwendung von Projektunterricht in der Schule für Lernbehinderte demonstriert.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Projektunterrichts, definiert den Begriff und beleuchtet wichtige Voraussetzungen, Merkmale, den Ablauf und Besonderheiten für den Einsatz in Schulen für Lernbehinderte.
- Das vierte Kapitel beschreibt die neue Auffassung vom Lernen und die damit verbundenen veränderten Anforderungen an den Unterricht. Es beleuchtet die Bedeutung von Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der Schüler und stellt verschiedene Möglichkeiten zur Förderung dieser Fähigkeiten vor.
- Das fünfte Kapitel behandelt die Förderung der Selbsttätigkeit an der Schule für Lernbehinderte. Es untersucht den Begriff "Lernbehinderung" und stellt Besonderheiten und Herausforderungen bei der Förderung des selbstständigen Handelns von Schülern mit Lernbehinderung dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Selbsttätiges Lernen, Projektunterricht, Lernbehinderung, Förderung von Selbstständigkeit, Methodenkompetenz, direkter Unterricht, kooperatives Lernen, adaptiver Unterricht, individueller Lernen und Schulen für Lernbehinderte.
- Quote paper
- Marion Hofrichter (Author), 2002, Förderung des selbsttätigen Lernens an der Schule für Lernbehinderte durch die Projektmethode, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/10601