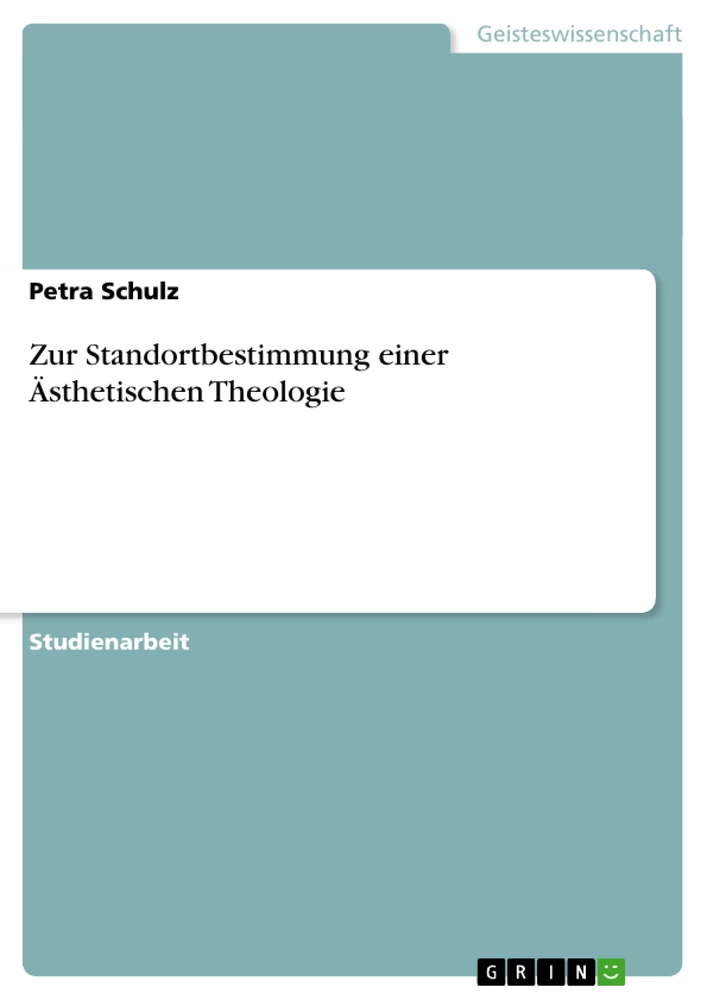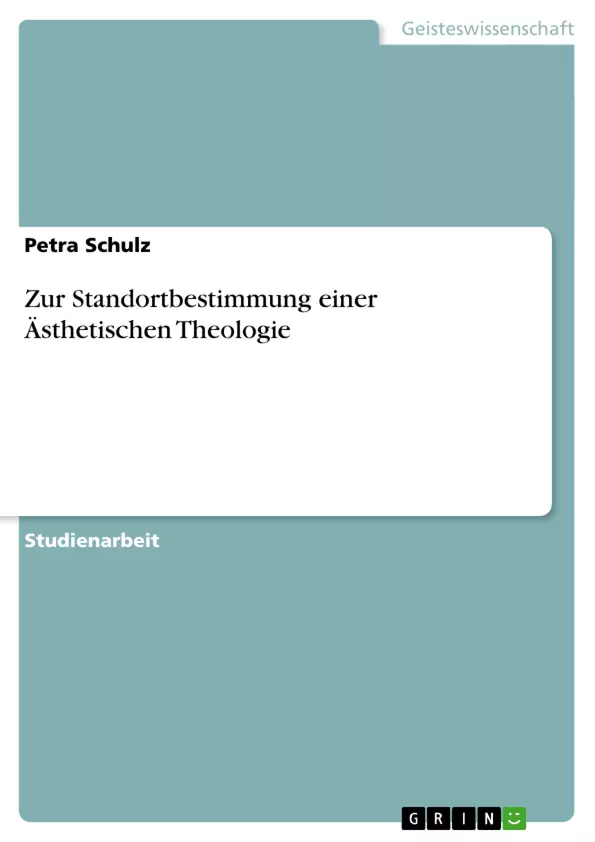Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Problembestimmung: Analyse der Gesellschaft, der Kirche und der Theologie
3. Ästhetische Theologie
3.1 Ästhetik und ihre Einordnung in die Theologie
3.1.1 Ästhetik als Theorie des Schönen
3.1.2 Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis
3.1.3 Ästhetik als Theorie der Kunst
3.2 Ästhetik als Theorie des Schönen - Hans Urs von Balthasar
3.3 Ästhetik als Theorie sinnlicher Erkenntnis - Klaas Huizing
3.4 Ästhetik als Theorie der Kunst
3.4.1 Kunst als Ort menschlicher Erfahrung
3.4.2 Kunst als Ort religiöser Erfahrung
4. Zur Standortbestimmung einer ästhetischen Theologie
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der in der Überschrift verwendete Begriff „Ästhetische Theologie“ stellt angesichts der Pluralität von unterschiedlichen Ansätzen und Reflexionsinhalten eine unangemessene Verkürzung dar. Vielmehr müsste man von „ästhetischen Theologien“ sprechen, so wie es auch nicht nur die Ästhetik gibt, sondern unter diesem Begriff eine Vielzahl von Theorien zusammengefasst sind.
Für eine Standortbestimmung ästhetischer Theologien ist es notwendig, die Hintergründe zu erfragen, warum sich - und darauf weisen die vielen Neuerscheinungen hin - mehr und mehr Theologen mit dieser Disziplin beschäftigen. Worauf reagiert sie ? Auf welche Fragen oder Bedürfnisse will sie eine Antwort geben? Hierzu soll im ersten Teil der Arbeit eine soziologische Untersuchung der Gesellschaft stattfinden, die uns zeigen wird, dass sich die Lebenswelt in den letzten Jahrzehnten rapide verändert hat. So stellt sich die Frage, inwiefern die Kirche und die Theologie auf diese Veränderungen reagieren. Kann eine ästhetische Theologie (bessere) Antworten als andere theologische Disziplinen auf die Erfordernisse der Zeit geben? Der zweite Teil stellt insofern drei Grundmodelle unterschiedlicher Theorien von Ästhetik vor und kombiniert sie mit theologischen Ansätzen. Der abschließende dritte Teil hinterfragt diese sodann nach deren Potential, auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagieren zu können, und versucht, sie in den theologischen Fächerkanon einzuordnen.
2. Zur Problembestimmung: Analyse der Gesellschaft, der Kirche und der Theologie
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Religion und Glaube im Zuge der Moderne mehr und mehr aus dem Alltag der westlichen Welt verdrängt und unsere Gesellschaft stetig sekularer wurde. Die Aufklärung und der technisch-industrielle Fortschritt lieferten neue Deutungsmuster und übernahmen Funktionen, die zuvor die Religionen erfüllten und so änderten sich nicht nur die Beziehungen des Menschen zu den Dingen und Ereignissen im Leben grundlegend, sondern auch die Einstellung des Menschen zum Leben und zu seinem Grund.1Als Folge entdeckte der Mensch durch den Wegfall der alten Ordnungen auf der einen Seite neue Freiheiten des
Lebensvollzuges, wurde andererseits aber auch mit den negativen Seiten der neu gewonnenen Möglichkeiten und Entgrenzungen konfrontiert, die sich in Orientierungslosigkeit und psychologischen Problemen wie Zukunftsängsten manifestier(t)en.
Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg setzte diesen Trend weiter fort und brachte im Zuge des Wirtschaftswachstums und des einsetzenden Geldsegens weitere einschneidende Veränderungen. Ging es im Nachkriegs-Deutschland zunächst ums „Überleben“, so wurde mit steigendem Wohlstand das „Erleben“ immer wichtiger.2
In dieser „Erlebnisgesellschaft“, die zuerst Gerhard Schulze 1992 beschrieb, eroberten sich die Menschen die „Unbeschränktheit des Musikhörens, des Reisens, des Kleiderkaufens, des Essens und Trinkens, der Sexualität, des Tanzes (und) des abendlichen Ausgehens.“3Im Zentrum dieser expandierenden Fun-Kultur steht das eigene Subjekt, das sich amüsieren, genießen und erleben will.4Kuschel merkt kritisch an, dass dieser Erlebnismarkt allerdings „nicht reale Bedürfnisse, sondern selbstgeschaffene Abhängigkeit befriedige.“5Insofern sind sie Pseudoerlebnisse: „Die Enttäuschung über die Erlebnisse, die in Wahrheit keine sind, treibt die Menschen immer schneller von einem Erlebnis zum nächsten.“6
Kuschel stellt weiterhin fest, dass die Lebenswelt nach dem 2. Weltkrieg eine umfassende Ästhetisierung erfahren hat. Wurden zunächst Produkte aufgrund ihrer Nützlichkeit gekauft, so wurde mit zunehmender Kaufkraft die Verbindung von Nützlichkeit und Design immer wichtiger. Die Ästhetisierung der Lebenswelt ist unaufhaltsam vorangeschritten und umfasst alle vorstellbaren Bereiche. Verschönerungswellen nach dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ ergießen sich über Stadt und Land und auch die Menschen sorgen sich um ihr „Styling“. Dieses zeigt sich z.B. an den Fitnesswellen, die periodisch über das Land rollen und anhand der Solarien und Krafträume, die im letzten Jahrzehnt7aus dem Boden schossen. Nicht nur in der Werbung begegnet man bei fast jedem Produkt einer hübschen Frau, die wie die Petersilie auf dem Teller zur Verschönerung des Produkts platziert wird - und Oliver Bierhof deutet mit dem Slogan „Weil ich es mir wert bin“ zum einen auf den ästhetischen Nutzen hin - für diesen darf auch ordentlich in die Tasche gegriffen werden - und macht zum anderen klar, wer oder was im Zentrum der Aufmerksamkeit steht - nämlich das Individuum selber, die eigene Person. Dass dieser Schönheitskult aber auch Gefahren birgt, zeugen u.a. die steigenden Zahlen von Bulimie oder Magersuchterkrankungen.
Das Optische hat eine dominante Stellung in unserer heutigen Kultur eingenommen. Die Macht von Bildern8macht sich - wie in den beiden Beispielen schon offensichtlich - die Werbeindustrie zu rein ökonomischen Zwecken zunutze, die ihre Konsumaufforderungen über Dutzende von Fernsehprogrammen auf die Rezipienten und gleichzeitigen Konsumenten losschickt. Aber auch die Nachrichtensendungen bedienen sich in zunehmendem Maße der Bilder und befriedigen einen wachsenden Voyeurismus, wie die Endlosschleifen des 11. September zeigen.
Neben dieser oberflächlichen Ästhetisierung weist Wolfgang Welsch aber auch auf eine Tiefenästhetisierung9hin, die sich u.a. in einer „Derealisierung des Realen“10äußert. Die Bilder, die von den Medien vermittelt werden, bieten anhand der technischen Möglichkeiten oder aufgrund ihrer perspektivischen Auswahl (allerdings ähnlich wie bei den Schriftmedien) keine Gewähr mehr, die Gesamtheit der Wirklichkeit darzustellen und verwischen aufgrund ihrer möglichen Virtualität die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Auch im Zapping und Switchen zwischen den Kanälen übt der Rezipient eine Derealisierung des Realen ein, erscheint Wirklichkeit doch zunehmend als unverbindlich, schwebend und modellierbar da produziert und konstruiert. Diese Beobachtung findet ihre Analogie in der Grundsituation des heutigen Menschen, wo in der unermesslich erscheinenden Freiheit der Lebensvollzüge jegliche Einstellung und Haltung - so auch im Glauben - zu einer reinen Ansichtssache geworden ist.
Wie sieht es aber nun mit der Kirche aus? Wie reagiert sie auf diese gesellschaftlichen Veränderungen?
Grundsätzlich dürfte man annehmen, dass die Kirche u.a. aufgrund der Eucharistie oder der Sakramente einen enormen Wissensschatz und eine „angeborene“ Kompetenz von der Verwendung von Formen und Symbolen und damit von der Bedeutung und Wichtigkeit ästhetischer Darstellung besitzt. Jedoch bemerkt Kuschel, dass dem Prozess der Zunahme der Ästhetisierung der Lebenswelt ein Prozess der Abnahme ästhetischer Kompetenz im Raum von Kirche und Theologie entspricht.11In einer postchristlichen Gesellschaft, so schreibt er, haben die Museen die Kirchen ersetzt, die Künstler die Priester und die Objekte die Altäre.12 Es ist deutlich, dass die über Jahrhunderte gleich gebliebenen Strukturen zu veraltet sind, als dass die Kirche die Mehrheit der Menschen noch erreichen kann. Auch ist die theologische Sprache über Gott nicht mit den sprachlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte mitgegangen.13Hinzu kommt noch eine populistische Opposition gegenüber der Kirche und ihre Vertreter, die sich darin äußert, dass gemeinhin alles, was von Seiten der Kirche kommt, pauschal und unreflektiert abgelehnt, ja belächelt wird. Neben den bereits erwähnten Gründen mag auch eine verkopfte Theologie, die im Zuge der Betonung von Rationalität und Vernunft um ihre Wissenschaftlichkeit kämpfen wollte, ihren Beitrag zu dieser Situation beigetragen haben - ebenso wie die zu einseitige Betonung einer rein dogmatischen oder moralisierenden Theologie. Die Kirche und die Theologie stehen vor dem Dilemma, dass sie etwas zu sagen haben, aber keiner es hören will.
Was aber haben sie zu sagen? Die Basis für jegliche Religion stellt meines Erachtens die menschliche Kontingenz dar, diese Existenz zwischen den Polen von Angst und Hoffnung, die brutale Unsicherheit zwischen Leben und Tod, diese Existenz der Liebe und der Schmerzen, das stetige Gefühl, nicht „Herr im eigenen Haus zu sein“ und immer den Anspruch, das Ideal, wie es sein könnte, vor Augen zu haben. Jesus kam auf die Welt, um die verirrten Schafe zu sammeln und zu Gott zu führen, Buddha, um die kranken Menschen zu heilen. Religion hat den Anspruch, den Wunsch, zu helfen, Wege aufzuzeigen, die begehbar sind und die in letzter Konsequenz zum Heil, zum „Heilen“ führen. Eine Theologie, die diesen Anspruch hat, muss beim heilsbedürftigen Menschen beginnen, seine Situation reflektieren, analysieren, sie damit konfrontieren, denn nur im Aufspüren seiner Probleme in der Kontingenz kann er diese bewältigen und der Spur, die die Religion legt, folgen.
Insofern ist der Weg zu der dargestellten Problematik unserer heutigen Gesellschaft nicht weit. Zwar entspricht die Ästhetisierung unserer Lebenswelt einem elementaren Bedürfnis nach Schönheit, die die Sinne anspricht und sie befriedigt, jedoch muss man allen Kritikern recht geben, die in den derzeitigen Ästhetisierungsprozessen der Erlebnisgesellschaft eine Gefahr entdecken. Sowohl die Dynamik von Pseudoerlebnissen als auch die Problematiken des wachsenden Konsums und des Diktats des Erlebens haben wir angesprochen. Vielleicht ist unsere Gier nach Befriedigung durch die Oberflächlichkeit des Konsums und des Erlebens die logische Flucht einer Gesellschaft, die sich zum einen vor der Pluralität der möglichen Lebensweisen fürchtet und zum anderen alle Sinne vor den erdrückenden globalen Problemen verstopft. Es scheint, als würde man sich einigeln, alles vergessen wollen und spätestens vor der Tagesschau zum Glücksrad umschalten. Dass nach den Terroranschlägen in Amerika - deren Ursache in dem seit Jahrzehnten schwelenden Nord-Süd-Konflikt liegt - keine breite, alle Gesellschaftsschichten umfassende Diskussion über unseren Luxus, unsere Werte und unser Verhältnis zur Dritten Welt stattfand, zeugt hiervon.
Die Frage die sich stellt ist, wie die Theologie auf die Erlebnisgesellschaft und auf die Ästhetisierung und ihre Folgen reagieren kann. Primär muss es darum gehen, wie es die Kirche und die Theologie schaffen, das Ohr der Menschen zu erreichen, um dann zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse beizutragen. Als eine mögliche Alternative erscheint die ästhetische Theologie. Auf diesen Anspruch hin soll sie im folgenden untersucht werden.
3. Ästhetische Theologie
3.1 Ästhetik und ihre Einordnung in die Theologie
Im Jahre 1742 hielt Alexander Gottlieb Baumgarten erstmals Vorlesungen über Ästhetik und mit seiner 1750 erschienenen Aesthetica gilt er als Gründer dieses neuen Wissenschaftszweigs. Seiner Definition nach war die Ästhetik die „Wissenschaft von der Vollkommenheit dersinnlichen Erkenntnis“14und umfasste den Bereich der menschlichen Wahrnehmung, die nicht mittels der Logik oder der Begrifflichkeit einzufangen war. Baumgarten hob damit „denjenigen Bereich der menschlichen Erkenntnis, der nicht von den mathematisch-logischen Wissenschaften erfasst (war), nachdrücklich zum Gegenstand der wissenschaftlichen Reflexion“15. Es ging ihm dabei nicht um eine Einschränkung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, sondern um ihre Erweiterung. In den folgenden Jahrhunderten hat diese Disziplin beträchtliche Veränderungen erlebt, die nach Grözinger in drei Grundmodellen ästhetischer Theorie zusammengefasst werden können.16Dabei ist aber anzumerken, dass diese in den seltesten Fällen rein auftreten, sondern Elemente der einzelnen Modelle auch in anderen aufgenommen und neu kombiniert werden können.
3.1.1 Ästhetik als Theorie des Schönen
Eine Ästhetik, die das Schöne in den Fokus ihrer Betrachtung stellt, ist untrennbar mit dem Namen Plato verbunden. Für ihn existiert Schönheit als Größe für sich - unabhängig von jeder schöpferischen Gestaltung oder jedes Kunstbemühens des Menschen. Nicht die Kunst erschafft das Schöne, sondern das Schöne ist schon vor und jenseits der Kunst als ein göttliches Schöne da. Diese göttliche Schönheit kann aber von den Menschen nicht vollständig gesehen werden, denn sie ist verdunkelt und verdeckt. Sie ergreift aber trotz ihrer Verdunklung vom Menschen Besitz und löst in ihm eine Unruhe aus, die die Menschen erst zu Handelnden macht.17 Der Hauptvertreter einer in dieser Tradition verwurzelten ästhetischen Theologie ist Hans Urs von Balthasar, dessen theologischer Ansatz im nächsten Kapitel vorgestellt wird.
3.1.2 Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis
Eine Ästhetik, die die Gesamtheit der sinnlichen Wahrnehmung als Lokus der Erkenntnis begreift, geht auf den eingangs erwähnten Alexander Gottlieb Baumgarten zurück. Worauf die Vertreter dieser Theorie hinweisen ist, dass der Bereich der sinnlichen Erkenntnis gegenüber des logisch-abstrahierenden Denkens eine unersetzliche Bedeutung hat. Eine theologische Ästhetik, so Grözinger, kann sich dieser Erkenntnis nicht verschließen, da die Gotteserkenntnis im Alten und Neuen Testament nie auf den logisch-abstrahierenden Bereich beschränkt ist, sondern den Menschen auf allen Ebenen seines Denk- und Sinnesvermögen anspricht18. So stellen insbesondere im Alten Testament Theologie und Poesie eine geschlossene Einheit dar (Psalmen, Mirjam-Lied), wobei Inhalt und Form einer theologischen Aussage nicht voneinander zu trennen sind und eine ästhetische Analyse auch einen tieferen Einblick in die Theologie leisten kann.19Für diesen Bereich der Ästhetische Theologie wird neben vielen Theorien stellvertretend auf Klaas Huizings literarisch-biblischen Ansatz eingegangen werden.
3.1.3 Ästhetik als Theorie der Kunst
Dieser Ansatz einer Ästhetik, die im Zentrum ihrer Reflexion die Kunst und das Kunstwerk hat, stellt heute den größten Bereich einer ästhetischen Theologie dar und drängt zumindest die unter Punkt 1 genannte Theorie in den Hintergrund. Am Anfang dieser Ästhetiktheorie steht Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der als Reflexionsgegenstand der Ästhetik nicht die Sinnlichkeit sondern die Kunst in den Vordergrund schob. „Der eigentliche Ausdruck jedoch für unsere Wissenschaft ist>Philosophie der Kunst<und bestimmter>Philosophie der schönen Kunst<.“20
Damit stellt sich die Frage, was denn ein Kunstwerk oder Kunst generell ist. Die Vielzahl der Kunstformen - Literatur, Musik, bildende Kunst, Malerei, Tanz, Architektur, etc. - soll in dieser Hausarbeit insbesondere auf Literatur und Malerei begrenzt werden. Hinsichtlich der Frage, was das spezifisch Künstlerische an einem Kunstwerk ist, verweisen diverse Autoren auf die Unbestimmtheit einer möglichen Definition. Wilhelm Gräb betont, dass allein die Reflexionssubjektivität eines jeden darüber entscheidet, ob ein Kunstwerk „schön“ oder „gelungen“ ist. Diese begriffliche Trennung ist insofern wichtig, als Kunst nicht nur rein ästhetisch „schön“ sein kann, sondern wonach auch das „Hässliche“ schön sein kann, wenn es sich als handwerklich gelungen darstellt und/oder eine Idee verkörpert.21
Eine Analyse theologischer Kunstkritik - wie sie Inken Mädler durchführt - weist drei größere Positionen auf, in denen Kunst und ihr (theologischer) Wert wahrgenommen wird.
a) Der christliche Charakter des künstlerischen Artefakts
b) Der christliche Charakter des Künstlers, was die Ausgrenzung nicht-christlicher Werke bzw. Künstler aus dem kirchlichen Kontext impliziert und
c) Neuere Interpretationen, die vornehmlich die Rezeptionsbedingungen analysieren und auf theologische Bestimmungen verzichten.22
Auf eine umfassende Darstellung dieser Positionen muss hier verzichtet werden. Die Diskussion an späterer Stelle wird aber zeigen, dass weder der christliche Charakter des Künstlers noch der des Artefakts gegeben sein müssen, um den religiösen Charakter von vielen Kunstwerken ansichtig zu machen.
An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass diese drei groben Theorien einer Ästhetik keine geschlossenen Systeme sind und eine strikte Trennung vielfach wegen der Schnittmengen und Entsprechungen unmöglich ist.
3.2 Ästhetik als Theorie des Schönen - Hans Urs von Balthasar
Hans Urs von Balthasar gilt weithin als Urvater einer ästhetischen Theologie. Sein monumentales WerkHerrlichkeit(1961 - 1969), in der er seine Theorie des Schönen und der Herrlichkeit Gottes entwickelte, erntet ehrfürchtiges Staunen und Bewunderung. Von Balthasars Werk entstand aus der Erfahrung, dass sein ästhetisches Empfinden über lange Zeit in der Theologie gedemütigt wurde. Richard Viladesau über von Balthasars „Trostlosigkeit der Theologie“23
(...) theology´s attempt to imitate the method of the exact science (...) has undermined the beauty of theology. Not only has modern theology neglected beauty as an object of inquiry, but also it has largely lost its connection with living religion and spirituality (…)
(…) theology cannot be a merely “abstract” science, since its goal is to guide us beyond all concepts to the experience of God´s mystery24
Das zentrale Thema “Gottes Herrlichkeit” basiert auf den biblischen Begriffen von kabod (AT) und doxa (NT) und beschreibt Gottes Erhabenheit und Größe, die er selbstäußernd den Menschen offenbart. Es bezeichnet insofern auf anthropologischer Ebene „the indwelling joy of His divine being which as such shines out from Him (...)“25. Aufgrund der Verbindung mit „Freude“ reicht der Begriff von Macht nicht aus, um Gottes Herrlichkeit zu beschreiben; dieser muss mit der Idee der göttlichen Schönheit komplettiert werden. Lenke man die Aufmerksamkeit nicht auf die göttliche Schönheit, so bestünde die Gefahr, dass die „gute Nachricht“ seine überzeugende Kraft, nämlich die Würdigung ihres Freude schenkenden Potentials verlöre.26
Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich nach von Balthasar weniger (aber auch) in der Schönheit der Welt als in der Person Jesu Christi. In Christus inkarniert und manifestiert sich die Herrlichkeit und Liebe Gottes, er ist „Gottes zentrales Kunstwerk“27. Von Balthasar bezeichnet Christus weiterhin als die „objektive Evidenz“, in der sich Gott den Menschen offenbart und die mit ihrem Aufleuchten die „subjektive Evidenz“, die innere Erfahrung des Glaubens, erhellt.28Die „subjektive Evidenz“ bezeichnet also den Glauben der Menschen, die Wahrnehmung der Herrlichkeit Gottes durch den Menschen, der sich von dem seine ganze Person überströmenden Licht und von der Liebe Jesu Christi in Beschlag nehmen lässt. Jesus hat insofern eine Vermittlerfunktion als er durch sein Leben, Wirken und Handeln auf die Herrlichkeit Gottes verweist.29
Wenn Gott uns nun - so von Balthasars Argumentation - in Christus in einer menschlichen und sinnhaften Erscheinung begegnet, so sind die Sinne als Organe der Wahrnehmung nicht auszuschließen. Insofern beruht die Selbstmitteilung Gottes nicht nur auf dem Logos, sondern auch auf Bildern und dem Vorstellungsvermögen des Menschen.
Von Balthasar sieht in der irdischen, vom Menschen geschaffenen Schönheit kein ansprechendes Equivalent zur göttlichen Herrlichkeit. Wahre Schönheit, wahre Liebe - und damit sein Bild einer ästhetischen Theologie - geht von Gott, „von oben“30aus und wird als Gnade empfangen, wenn man sich ihr öffnet.
Von Balthasar vernachlässigt in seiner ästhetischen Theologie meines Erachtens die anthropologische Ebene zu stark. Auch das Leid und die Not der Welt finden - bei aller Vorsicht (Siebenbändiges Werk) - zu wenig Beachtung, so dass auch Grözinger ein gewisses romantisches und idealistisches Verständnis der Kultur, das sich vor dem faktischen Elend und der Not nicht mehr verantworten kann, kritisieren muss.31
3.3 Ästhetik als Theorie sinnlicher Erkenntnis - Klaas Huizing
Hält von Balthasar alle Sinne als Organe der Wahrnehmung der Selbstmitteilung Gottes für wichtig, so sucht Klaas Huizing in Anlehnung daran nach einer Ästhetik, die die sinnliche Wahrnehmung ins Zentrum des Interesses stellt und sich nicht länger an der Urteilslogik schön/hässlich oder wahr/falsch orientiert. Ausgehend von der Beobachtung, dass der Mensch in erster Linie „Atmosphären“32(= Gefühle) wahrnimmt bevor diese in Worte transformiert werden, entwickelt er seine These, dass es vor allem die Sinnlichkeit ist, die einen Zugang zur Transzendenz ermöglicht und erst später (wenn überhaupt) das Denken. So lehnt er - wie von Balthasar - eine Theologie ab, die gefühllos und rein wissenschaftlich von Gott und Jesus Christus spricht. Sieht er den Zugang zur Transzendenz fast ausschließlich in der Sinnlichkeit, so erhebt er diese zum Ort der Erkenntnis von Gott und dem Göttlichen.
Sein biblisch-literarischer Ansatz sieht in der Bibel kein dogmatisches Lehrbuch oder eine moralische Drohfibel sondern eine ästhetische Ur-kunde.33Literarische Untersuchungen zeigten, dass die Evangelien keinesfalls von unbegabten „Schreiberlingen“ verfasst wurden, sondern letztere äußerst kompetente und talentierte Autoren waren, die es schafften, das Leben Jesu in bewegten Bildern für die künftigen Generationen vor Augen zu malen.34
Gründend auf Paulus, der in Gal 3,1 von dem „vor-Augen-malen“ des Gekreuzigten spricht, liest er die Bibel als Inkarnationsdrama, in dem Jesus Christus im Leseakt eine konkrete Gestalt annimmt, sich sozusagen inkarniert und so die LeserInnen affektiv betroffen macht. Diese „affektive Betroffenheit“35durch die faszinierende Erscheinung des „vor-Augen- gemalten“ Christus, also seine ästhetische Evidenz (=Augenscheinlichkeit, Einsicht, die ohne methodische Vermittlung geltend gemacht wird), mündet, so Huizing, in der „Wiedergeburt“36der LeserInnen. Mit Wiedergeburt meint er eine Veränderung im Leser, der inspiriert von Jesus Vorbild zu einer Reflexion über sein eigenes Handeln angeregt und zum Nachahmen animiert wird. Den Vorteil dieser literarischen Anthropologie als Teil einer ästhetischen Theologie sieht er darin, dass die Menschen durch einen Leseakt, der die Betonung auf die Sinnlichkeit lenkt, inspiriert werden, ohne dass ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet wird oder ihnen Anordnungen gegeben werden. Eine Begründung der Betonung der Sinnlichkeit vor der Ratio liefert auch seine Auffassung, dass das Denken spätestens beim Glauben an seine Grenzen stößt. Denn manche Zusammenhänge und bestimmte Glaubensinhalte lassen sich eben nicht mehr mit dem Verstand oder der Vernunft erklären.
Huizings Theorie einer Ästhetische Theologie ähnelt stark Aspekten der ignatianischen Exerzitien. Auch Ignatius von Loyola hatte - zur „Unterscheidung der Geister“ - für eine kontemplative Betrachtung der Evangelien und insbesondere der Person Christi geworben, um von der Kraft der Präsenz Christi ergriffen und inspiriert zu werden. Dass auch Hans Urs von Balthasar von dem Gründer des Jesuitenordens geprägt wurde37- er übertrug 1993 die Exerzitien ins Deutsche - deutet die Nähe der ästhetischen Theologien zur Spiritualität und eventuell zur Mystik an. Es geht nicht nur darum, sich vom Vorbild Jesu Christi oder vom Licht Gottes einnehmen zu lassen, sondern auch und vielleicht in erster Linie um die Zustände der Ruhe und der Kontemplation, in denen sich solche Erfahrungshorizonte erst eröffnen. Hierzu noch einige Gedanken: Die Kirche hat es in der Vergangenheit versäumt, das Bedürfnis nach solchen Räumen der Ruhe und Stille entsprechend zu befriedigen und so zog es viele zu den ostasiatischen Religionen, die eine religiöse Praxis von Kontemplationen und Meditationen ohne Dogmatik und Moral ermöglichten. Dass aber auch dieser Trend der erzählend erklärte und auslegte, der fiktive Figuren erfand, um indirekt, in der Beleuchtung durch StellvertreterFiguren oder objektive Korrelate klarzumachen, worum es ihm ging“ (Kuschel, S. 449/450).
letzten beiden Jahrzehnte zu verblassen scheint, deutet darauf hin, dass zum einen die Schnelligkeit der Welt, die Berieselung der Medien und der Sog des „Erleben-wollens“ den Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen lassen und dass zum anderen Ängste, Sorgen und das Zurückgeworfensein auf die Probleme der Welt und vielleicht auf die eigenen so groß geworden sind, dass die Zustände der Stille und Muße zunehmend als Qual empfunden werden.
Eine Theologie, die wie Huizings oder auch von Balthasars Ansatz, auf die Kontemplation Wert legt, muss sich dieser Problematik bewusst sein. Zum anderen wird Huizings Theologie aber auch wie die von Balthasars an der Sekularität der Gesellschaft ihre Grenzen finden. So nachvollziehbar, wie die Betonung auf die Sinnlichkeit vor der Ratio (aber keinesfalls außerhalb der Ratio) ist, so setzt diese - wenn nicht den Glauben - so doch bereits die Bereitschaft voraus, sich mit Jesus Christus und dem Christentum zu beschäftigen. Dass diese aber oft nicht gegeben ist, haben wir in der Analyse der Gesellschaft erwähnt und so stellt sich die Frage, ob die im folgenden vorgestellte Ästhetik, die die Kunst in den Mittelpunkt ihres Interesses stellt, eine Lösung für die angesprochene Problematik bietet.
3.4 Ästhetik als Theorie der Kunst
In der einführenden Beschreibung dieses Ansatzes wurde bereits die Frage nach einer Definition der Kunst angesprochen. Eine weitere Frage stellt sich nun unter theologischer Sicht, nämlich was Kunst eigentlich mit Theologie und Religion zu tun hat, wo Gemeinsamkeiten und Überschneidungen liegen.
Wir hatten bereits gehört, dass Grözinger poetische Elemente im Alten Testament als Theopoesie versteht und dass Huizing die literarische Qualität der Evangelien hervorhebt, was uns erste Verbindungen von künstlerischem Schaffen und Theologie aufzeigte. Aber auch allein die Kunstgeschichte zeigt in aller Deutlichkeit die Verbindung von Kunst und Religion38- zumindest in der Malerei bis in die Neuzeit. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts aber kann man einen Bruch im Verhältnis von Kirche und Kunst feststellen39, der sogar zu einem Verlust des Wissens über die Kunst geführt hat, wie Johannes Rauchenberger bemerkt: „Die Bilder mögen wohl heilig und sogar ein Ort theologischer Erkenntnis sein, aber wir wissen es nicht mehr.“40Die Kunst ist zunehmend zu einer eigenständigen Wissenschaft geworden, die Aufgaben übernommen hat, die zuvor von Theologie oder Philosophie erfüllt wurden.41Wilhelm Gräb führt an, dass Kunstwerke eine eigene Weise des menschlichen Selbst- und Weltumgangs ermöglichen und umfassende Weltinterpretationen bieten.42Insofern werden Kunst und Religion in den geistes- und sozialgeschichtlichen Veränderungen der Moderne substituierbar. Es ist kein Dienstverhältnis mehr der einen für die andere. Weder braucht die Kunst die Religion als Referenzrahmen für die Bestimmung ihrer ideellen Gehalte, noch braucht die Religion die Kunst zur Bebilderung ihres heilsgeschichtlichen Offenbarungswissens43
Dass sich (Teile der) Theologie und die Kunst in einem Konkurrenzverhältnis sehen, verdeutlicht Alex Stock wenn er schreibt, dass „eine repräsentative Einführung in die Kunstgeschichte aus neuerer Zeit im Register als Stichwort wohl ‚Thermographie’, nicht aber ‚Theologie’“44kenne. Dies sei weniger Zufall als symptomatisch, will die Kunst sich doch als eigenständige Wissenschaft definieren und nicht von einer Theologie als eventuelle Subdisziplin vereinnahmt werden.
Von theologischer Seite scheint insbesondere die Diskussion um den Wahrheitsbegriff ein Beispiel für diese interdisziplinären Eifersüchteleien zu sein. Die Diskussion um den Wahrheitsanspruch fand ihren ersten Höhepunkt in der Kontroverse zwischen Plato und Aristoteles. „Plato wollte die Kunst, wo immer sie einen eigenen Anspruch auf Wahrheit erhebte, aus der Polis ausschließen.“45Wahrheit sollte exklusiver Gegenstand von Theologie und Philosophie bleiben. Für Aristoteles dagegen erschloss die Kunst eine Wahrheit, vor der die Menschen ansonsten ihre Augen verschließen würden. Mit dem Einbruch der Renaissance änderte sich die Selbstauffassung des Künstlers insofern, als dass er sich als derjenige empfand, der Wahrheit selbst erst erschafft. Doch wurde dieser Gedanke in unserem Jahrhundert soweit modifiziert (Heidegger, Adorno), dass der Künstler Wahrheit nicht produziert, sondern sie vielmehr aufzudecken hilft. Dass das Christentum die Kunst selbst immer in Anspruch genommen hat, zeigt, dass sich die Theologie keinesfalls von der Vorstellung des die Wahrheit aufdeckenden Charakters der Kunst verschlossen hat.46So spricht Karl-Josef Kuschel von der Kunst als Ort desWahr-Scheinlichen. Sie könne Anspruch erheben, Wahrheit zum Scheinen zu bringen, insofern enthält sie also die Möglichkeit von Wahrheit, die aber „ebenso wie alle Produkte des Menschen der Selbsttäuschung unterliegen können.“47Zwar besteht insbesondere für die Literatur die Gefahr, die Wittgenstein als „die Verhexung der Sprache“48 bezeichnet, doch ist sich die Kunst - jedenfalls nach der eingesehenen Literatur - durchaus ihrer Subjektivität und Perspektivität bewusst und so scheint die Problematik des Wahrheitsanspruchs eine theologisch hausgemachte zu sein, hinter der man eine gewisse Arroganz der Theologie „mehr zu sein“ vermuten kann.49
Neben der Betonung auf ihre Eigenständigkeit mögen gegenüber der Kunst auch weitere Ressentiments liegen, die ihren Ursprung in der Kritik der Kunst am Christentum haben, ist die Kunst doch „in summa anti-kirchliche“50. Johannes Rauchenberger warnt, dass die Beschäftigung mit der Kunst die Theologie vor sich selber stellt, da Kunst sicherlich nicht nur eine „Ode auf die kulturellen Leistungen des Christentums“51ist. Dass diese kritische Betrachtung aber nicht in einer Ablehnung der Kunst für die theologische Betrachtung enden muss, sondern durchaus fruchtbar sein kann, fordert Friedhelm Mennekes. Die Kunst hält die Theologie sozusagen am Boden, „bewahrt sie vor Weltflucht und schwärmerisch-ekstatischen Eskapaden“.52
Dass die Kunst als eigenständige Disziplin angesehen und gewürdigt werden muss, ist aus unserer heutigen Sicht nur logisch; dass die Theologie aber auch aus dem Fundus der Kunst schöpfen, sie theologisch durchleuchten und interpretieren darf, formuliert Karl-Josef Kuschel in Bezug auf die Literatur:
>Funktionalisiere< ich damit die Literatur? Ja, und warum auch nicht? So wie jeder Leser einen guten Text >funktionalisiert<, wenn er ihn zu >seinem< Text macht, d.h. wenn er entdeckt, dass dieser Text ihm das Stück Wahrheit in Wahrhaftigkeit sagt, das er braucht. Funktionalisieren aber heißt weder vergewaltigen noch vereinnahmen. Vergewaltigen hieße, Textegegenihren Sinn auslegen, und vereinnahmen hieße, Texte zur Bestätigung von Sinnangeboten zu missbrauchen, die außerhalb ihrer liegen. Beides wäre der Tod jedes kreativen, fruchtbaren Umgangs mit Literatur53
Im folgenden soll nun die Kunst auf Analogien untersucht werden, die für die Theologie und für die Vermittlung von Religion fruchtbar seien können. Hierbei soll die Kunst zunächst als Ort genereller menschlicher Erfahrungen und in einem zweiten Schritt als Ort religiöser Erfahrung untersucht werden.
3.4.1 Kunst als Ort menschlicher Erfahrung
Der zentrale Begriff in diesem Zusammenhang ist der der „conditio humana“. Der Mensch, sein Leben, sein Schicksal, seine Existenz stehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Matthäus 8,20 beschreibt die Grundsituation des Menschen: „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege.“ Kuschel weist darauf hin, dass die archetypischen Gestalten in der Literatur (u.a. Don Juan, Hamlet, Odysseus, Hiob, Antigone, Ödipus) diese „conditio humana“ versinnbildlichen: die Angewiesenheit des Menschen auf Liebe und Hoffnung, seine unablässige Sinnsuche, sein rastloses Streben nach Heimat, seine Tragik nach Wahrheitssuche und seine das Selbstopfer nicht scheuende Widerstandsbereitschaft.54Von Georg Steiner übernimmt Kuschel das Bild der „Karsamstag-Existenz“, welches die Situation des Menschen beschreibt. Auf der einen Seite, so Kuschel, steht der Karfreitag, mit ihm die Kreuzigung, das Leiden, der Tod, die Schmerzen, die Absurdität dieses Lebens und auf der anderen Seite der Ostersonntag: die Auferstehung, die Freude, das Glück, die Hoffnung. Und genau das ist unsere Erfahrung der Kontingenz: Wir stehen zwischen diesen beiden Polen, hin- und hergerissen, nirgendwo zuhause und immer fremd.
So entsteht alle große Kunst und alle große Theologie aus dieser Spannung: dem Wissen um die Schmerzen und den Tod und zugleich um die Hoffnung auf neues Leben, die Befreiung von Unmenschlichkeit und Entfremdung. Alles entsteht in diesem Raum des >Zwischen< - zwischen Karfreitag und Ostersonntag55 Theologie, so führt Kuschel weiter an, funktioniere nur allzu rasch als Medizin. Wenn die Abgründe der eigenen Existenz, die Widersprüche und die Absurditäten durch vorschnelle Vertröstungen und Verweise auf Gott verdrängt würden, dann wird Theologie zu einer „beschwichtigenden Therapie für Seelenschmerzen“56degradiert. Insofern bietet die Kunst (und für Kuschel speziell die Literatur) einen reichen Erfahrungsschatz an Kontingenzerfahrungen, den sich Kirche und Theologie zu nutze machen können. Kunst und Religion befassen sich beide mit dem Menschen und seiner Welt, sie deuten, interpretieren und erklären und so beschreibt Grözinger: „Religion ist immer dort am Werk, wo ‚Leben’ gedeutet wird und diese Deutung ästhetisch zur Darstellung kommt.“57
3.4.2 Kunst als Ort religiöser Erfahrung
Ist die Überschrift in der Form einer Aussage formuliert, so soll dies nicht heißen, dass die Kunst mit absolut gesetzter Sicherheit ein Ort religiöser Erfahrung ist. Die Diskussion, ob Kunst eine Plattform für religiöse Erfahrung oder „nur“ für ästhetische Erfahrung ist, durchzieht die Literatur und deutet wiederum auf den Konflikt des Wahrheitsanspruchs hin. Dass Kunst „geistliche Tatbestände wie Stille, Tiefe, Dichte usw. ansichtig“58macht ist sowohl aus der Sicht des Rezipienten als auch des Kunstschaffenden nachvollziehbar. Aber sind dies bereits religiöse Erfahrungen? Die Frage, um die es hier im Kern geht, ist, ob die Kunst das Göttliche, die göttliche Offenbarung gemäß der Selbstaussage Jesu Christi: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Johannes 14,6)59verkörpern kann. Karl Barth war davon überzeugt, dass ein Kunstwerk nie Offenbarungsqualität habe.
Offenbarung gibt es für den Menschen in Jesus Christus allein, der seinerseits nur über die Offenbarungs-Ur-Kunde, die Heilige Schrift, dem Menschen zugänglich sei. Kein Werk menschlicher Kultur könne diese Funktion übernehmen60
In späteren Jahren war Barth zumindest bereit, der Kunst Gleichnisfunktion einzuräumen. Auch den Künstlern (und insbesondere Carl Zuckmayer) gestand Barth zu, ein priesterliches Amt auszuüben: „in einem Ausmaß, wie das unter den berufsmäßigen Priestern, Predigern, Theologen usw. katholischer oder evangelischer Konfession wohl nur von wenigen gesagt werden kann.“61
Barths Vorbehalten hinsichtlich der Offenbarungsqualität von Kunstwerken steht Georg Steiner gegenüber, für den „Gottes Gegenwart“ in jedem großen, ernsthaften Kunstwerk direkt präsent ist. „Die Begegnung mit dem Kunstwerk ist (eine) Begegnung mit einer Wirklichkeit eigener Art (...) Im Akt der Hingabe wird Kunst zur >Form gewordenen Epiphanie<; es >schimmert etwas durch< (...)“62
Wenn man entgegen der kirchlichen Lehrmeinung annimmt, dass sich Gotteserfahrung, in welcher Gestalt auch immer, auch heute noch ereignet, dann könnte man dieser Theorie zustimmen. Jedoch muss hinterfragt werden, ob das Durchdringen „des ganz Anderen“ im Kunstwerk nicht in der Gefahr der Feuerbachschen Projektions- oder der Freudschen Illusionstheorie steht. Insofern argumentiert G. Larcher vorsichtiger, indem er die Begegnung mit Kunst mit dem „Terminus der „offenbarungsanalogen Struktur“ eines geschenkhaft zu bezeichnenden Bedeutungsüberschusses analog der Erfahrung der Gnade“63charakterisiert. Die Erfahrung mit der Kunst wäre somit in den Bereich der ästhetischen Erfahrung verlagert. Dennoch fordert Kuschel von der Theologie, dass es kein Zurück zu einer offenbarungstheologischen Abqualifizierung oder Ignorierung des Ästhetischen“64gibt.
Eine Lösung bietet Walter Lesch, der in der Betonung des Motivs der „Spur“ eine Annäherung von religiösen und ästhetischen Erfahrungen sieht. So deutet die Kunst etwas an, verweist auf etwas, transzendiert die Wirklichkeit hin auf das Unbegreifliche, Unfassbare, Unaussprechliche.65Und Thomas Erne fügt hinzu: „Kunst sucht das ganz Andere, die Darstellung des Undarstellbaren in den Brüchen und Verwerfungen einer scheinbar solid gefügten Wirklichkeit.“66
Letztendlich muss die Diskussion, ob man mit der Kunst Erfahrungen ästhetischer oder religiöser Natur macht, kapitulieren, da eine begriffliche Terminierung von religiöser Erfahrung wegen der subjektiven Grundstruktur der Erfahrung nicht möglich ist. Und wer will jemanden die Freude, die Geborgenheit, die Liebe bei der Betrachtung eines Kunstwerks, einer wunderschönen Landschaft, beim Lesen eines Buches wirklich absprechen, wenn diese für ihn Religiosität bedeuten?
Es bleibt festzuhalten, dass Kunstwerke auf etwas verweisen können, auf etwas stoßen können gemäß Kuschels „Bekenntnis“: „Sie (die Dichter) sind nicht der Grund meines Glaubens, wohl aber oft dessen Anstifter.“67Die Kunst für die Theologie nicht fruchtbar zu machen, entspräche einem großen Defizit.
4. Zur Standortbestimmung einer ästhetischen Theologie
Im folgenden soll nun darüber nachgedacht werden, welchen Platz in der Theologie die vorgestellten Ansätze einer Ästhetische Theologie einnehmen können. Bei von Balthasar hatten wir kritisiert, dass seine Theorie einer Ästhetische Theologie der gesellschaftlichen Situation nicht gerecht wird. Das Ausblenden des Elends der Welt und der menschlichen Grundsituation und die Betonung der Herrlichkeit Gottes und seiner Liebe, die die Menschen durch Jesus Christus und durch die Schöpfung erfahren können, kann man (böswillig) als zynisch betrachten. Seine Theologie „von oben“, die nicht vom Menschen ausgeht, scheint nicht in der Lage zu sein, die zu Anfang beschriebenen Ansprüche an eine moderne Theologie zu erfüllen. Jedoch wird durch die Auseinandersetzung mit Balthasar bewusst, dass Glaube auch Freude und inneren Frieden bedeutet (Obwohl dies keine neue, aber verschüttete und oft vernachlässigte Erkenntnis ist).68Er selber sieht seine ästhetische Theologie als Ergänzung zu einer rein abstrakten und rationalen Fundamentaltheologie und Dogmatik69und als eine Theologie mit Gefühl, wie dies auch Rahner von der Theologie forderte.70
Bei Klaas Huizing sahen wir, dass auch er bestrebt ist, die sinnliche Erfahrung im Bereich der Theologie aufzuwerten. Allerdings sieht er seine Ästhetische Theologie nicht als Ergänzung an, sondern er behauptet, dass Theologie und Ästhetik identisch sind.71 Als Ort transzendentaler Erkenntnis zeichne sich die sinnliche Wahrnehmung aus, nicht (bzw. nicht direkt) die Ratio. Seine These ist insofern nachvollziehbar, als dass Zustände, in die man durch Kontemplation und Meditation gelangt, sich tatsächlich als Orte manifestieren, wo man sich jenseits alles Denkens und Raisonierens befindet. In diesen Zuständen entfalten sich Gefühle der tiefsten Zufriedenheit. Jedoch legt sein biblisch-literarischer Ansatz zugrunde, dass man diese Zustände durch die Kontemplation und Versinnbildlichung der Person Jesu Christi erreicht. Damit wird aber eine Denkleistung, die die Reflexion über und die Bedeutung des Handelns Jesu beinhaltet, bereits vorausgesetzt. Insofern ist die sinnliche Wahrnehmung aber schon an die Ratio gebunden.
Wie bereits erwähnt ist an Huizings Ansatz aber zumindest auch die Bereitschaft, sich mit dem Glauben und mit Jesus Christus zu beschäftigen, gebunden. Hier muss wieder auf die sekulare Gesellschaft verwiesen werden, die zu großen Teilen diese Bereitschaft verweigert. Innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen können sowohl Huizings als auch von Balthasars Ansätze der Festigung und Intensivierung des Glaubens dienen. Ihre Betonung auf die sinnliche Erkenntnis stellt sie weiterhin in eine Verbindung zu einer Theologie, die in der mystischen Tradition verwurzelt ist.
Demgegenüber steht eine Ästhetische Theologie, die anthropozentrisch die „conditio humana“ untersucht, die Gesellschaft und die Welt - wiedergespiegelt in der Kunst - beobachtet, analysiert, deren Ideen, Interessen, Sorgen und Bedürfnisse reflektiert. Eine ästhetische Theologie solcher Art gesteht ein, dass auch die Religion selbständig geworden ist, was sich u.a. sowohl in der theoretischen Verknüpfung von Glaubensinhalten aus unterschiedlichen Religionen als auch in der Vermischung religiöser Praktiken äußert. „Theologie und Kirche haben sie (die Religion) nicht mehr in ihrer Gewalt“72, schreibt Wilhelm Gräb. Dennoch sieht Rahner in diesen „Individual-Religionen“, die uns u.a. in der Kunst begegnen, eine Chance für die Theologie. Gerade weil diese nicht durch den verengenden Prozess systematischer Gedanken gegangen sind, kann sie die Theologie für eine Reflexion ihrer eigenen Inhalte, Betonungen und Defizite nutzen und Einsichten über ihren eigenen Kontext, ihre Sprache und Methoden erlangen.73
Dieser Ansatz einer ästhetischen Theologie geht „von unten“ aus, vom Menschen und legt eine Spur zu dem, wofür auch die Theologie letztendlich nur verweisende Worte findet. Kuschel nennt diesen Ansatz in Anlehnung an F. Stier „Theologie im Vorhof“74, die sich bewusst in die Tradition der negativen Theologie stellt. Diese kämpft für die „Selbstzurücknahme der Gott-Rede in die Frage, in die Selbstbeschneidung und Demut desjenigen, der seinen Gott nicht hat, sondern zu ihm auf dem Weg ist.“75
Allein der Aufbau dieser Arbeit deutete bereits darauf hin, dass eine ästhetische Theologie, die die Kunst in den Mittelpunkt stellt, insbesondere für die praktische Theologie76ihren Nutzen hat und unter diesem Bewertungskriterium den anderen beiden Ansätzen „überlegen“ ist. Entsprechend Tillichs Korrelationsdidaktik kann die (religiöse) Beschäftigung mit Kunst Menschen abholen und ihnen neue Horizonte eröffnen, ohne dass sie offensichtlich mit Religion oder mit dem christlichen Glauben konfrontiert werden.
Religion ist dem Menschen immanent - so meine These, denn jeder Mensch verspürt die unter Punkt 2 angesprochen Bedingungen der Existenz. Es müssen nur die Kanäle des Bewusstseins und der Wahrnehmung geöffnet werden.
5. Schlussbetrachtung
Vieles wurde gesagt - vieles mehr musste aufgrund der Fülle von Theorien und Informationen, die es mittlerweile zu diesem Thema gibt und aufgrund der begrenzten Hausarbeit vernachlässigt und ausgelassen werden. Auf zwei Punkte, die in der Hausarbeit angesprochen wurden, möchte ich im folgenden wegen ihrer Bedeutung für die Theologie noch einmal eingehen.
In Übereinstimmung mit Kuschel sehe ich den Wert einer ästhetische Theologie vor allem in der Betonung ihres anthropozentrischen Ansatzes. Eine Theologie, die ihren Sinn in dieser Welt haben will, muss vom Menschen und seiner Existenz ausgehen und ihn bei seinen Bedürfnissen abholen, um zu Kontingenzbewältigungen beitragen zu können. Die Beschäftigung mit den Grundbedingungen menschlicher Existenz wird aber zwangsläufig immer auch eine Konfrontation mit der Welt sein, mit ihren Ungerechtigkeiten und Unzulänglichkeiten. Die Kirche kann - will sie Dienste am Menschen leisten - sich nicht der Aufgabe entziehen, die Ungerechtigkeiten der Welt anzuprangern und gegen sie anzukämpfen. Die Erhaltung der Schöpfung muss eine zentrale Aufgabe von Kirche sein, da - allein aus anthropozentrischer Sicht - Umweltkatastrophen das Konfliktpotential in der Welt immens verstärken werden.
Die Kirche hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr einschüchtern lassen. Unsicher durch die vielen Kirchenaustritte geworden, scheint sie sich beleidigt zurückgezogen zu haben, hört man ihre Stimme in öffentlichen Diskussionen doch immer weniger. Wahrscheinlich will sie aber auch keiner mehr nach irgendetwas fragen. Die Kirche - hier vor allem die Amtskirche - muss sich ändern, muss ihren Elfenbeinturm verlassen und sich den wirklichen Problemen der Menschen und der Welt widmen. Somit wird hier für eine politisch engagierte Theologie plädiert, die den 11. September zum Anlass nimmt und sich wieder mehr einmischt, kritisiert und zu verbessern hilft. Insofern muss sie sich aber auch - nach eingehender Selbstkritik - zu ihrem moralisierenden Anspruch bekennen. Viele werden die Theologie dann wieder als „Spielverderber“ bezeichnen. Und ja, das muss und will sie sein; sie muss die Rolle des Spielverderbers spielen, wenn außer dem Spielen nichts mehr wahrgenommen wird.
„Wahrnehmen“ führt mich zu dem zweiten Punkt. Wir hatten bei von Balthasars und Klaas Huizings Ansatz eine Verbindung zu einer mystischen Theologie festgestellt. Gerade in der Kontemplation und Meditation, die Huizing erwähnt, und des „Sich-Öffnens“ für Gottes Herrlichkeit sahen wir Parallelen. In dieser schnellebigen Gesellschaft, in der jeder ein Handy hat, das ihn nicht allein aber auch nicht „bei sich“ sich lässt, findet sich immer weniger Zeit für Ruhe, Stille und Betrachtung. Wie von Balthasar und Huizing will auch die Kunst Räume der Kontemplation schaffen, in denen der Mensch sich und seine Lebenswelt reflektieren kann. Dies ist die Voraussetzung jeglichen bewussten und verantwortlichen Handelns. Hierin liegt eine der Aufgaben, die die ästhetischen Ansätze an eine Theologie stellen.
Diese Arbeit schrieb ein Mitglied der Fun-Kultur, der Erlebnisgesellschaft und der Ästhetisierung. Und wiedereinmal zeigte sich: Die Beschäftigung mit Religion holt Verlorengeglaubtes wieder hervor, engagiert und fordert auf. Ewald Lienen, der Trainer des 1. FC Köln, sagte in einem Interview am Tag nach dem Terroranschlag in den USA sinngemäß: Für mich stellt sich nicht die Frage, wie man die eigene Sicherheit erhöhen kann oder wie die USA auf den Anschlag reagieren soll. Die einzig wichtige Frage kann nur sein, was jeder einzelne dafür tun kann, die Spannungen zwischen reich und arm zu entschärfen. Respekt.
6. Literaturverzeichnis
Balthasar, Hans Urs von,Mein Werk - Durchblicke, Einsiedeln/Freiburg 1990.
--,Weltliche Schönheit und göttliche Herrlichkeit, in: Internationale katholische Zeitschrift, November 1982, 6/82, S. 513-517.
Bohrer, Karl Heinz,Die Grenzen desÄsthetischen, in: Welsch, Wolfgang (Hg.), Die Aktualität des Ästhetischen, München 1993, S. 48-64.
Erne, Thomas,Vom Fundament zum Ferment: Religiöse Erfahrung mitästhetischer
Erfahrung, in: Herrmann, Jörg u.a. (Hg.), Die Gegenwart der Kunst: Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München 1998, S. 283-295.
Gräb, Wilhelm,Kunst und Religion in der Moderne: Thesen zum Verhältnis vonästhetischer und religiöser Erfahrung, in: Herrmann, Jörg u.a. (Hg.), Die Gegenwart der Kunst: Ästhetische und religiöse Erfahrung heute, München 1998, S. 57-72.
Grötzinger, Albrecht,Praktische Theologie undÄsthetik, München 1987.
--,Gibt es eine theologischeÄsthetik?in: Müller, Wolfgang Erich u.a. (Hg.) Kunst-
Positionen: Kunst als Thema gegenwärtiger evangelischer und katholischer Theologie, Stuttgart/Berlin/Köln 1998, S. 35-43.
Guerriero, Elio,Hans Urs von Balthasar: Eine Monographie, Einsiedeln/Freiburg 1993.
Hartmann, Michael,Ästhetik als ein Grundbegriff fundamentaler Theologie, St. Ottilien 1985.
Höhn, Hans-Joachim,Wider das Schwinden der Sinne! Impulse für eine zeitkritischeÄsthetik des Glaubens, in: Kranemann, Benedikt u.a. (Hg.) Die missionarische Dimension der Liturgie, Stuttgart 1998, Bd. 1, S. 45-59.
Huizing, Klaas,Ästhetische Theologie: Der erlesene Mensch. Eine literarische Anthropologie, Stuttgart 2000, Band 1.
Kuschel, Karl-Josef,Im Spiegel der Dichter: Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Düsseldorf 1997.
Lesch, Walter,Autonomie der Kunst und Theologie der Kultur. Zugänge zum theologischen Interesse an Kunst und Kultur, in: Lesch, Walter (Hg.), Theologie und ästhetische Erfahrung: Beiträge zur Begegnung von Religion und Kunst, Darmstadt 1994, S. 1-24.
Mädler, Inken,Direktiven - Perspektiven: Die Kunst der Moderne im Horizont theologischer Bestimmungen, in: Müller, Wolfgang Erich u.a. (Hg.) Kunst-Positionen: Kunst als Thema gegenwärtiger evangelischer und katholischer Theologie, Stuttgart/Berlin/ Köln 1998, S. 18-34.
Mennekes, Friedhelm,Zum gegenwärtigen Verhältnis von Kunst und Kirche, in: Mennekes, Friedhelm (Hg.), Zwischen Kunst und Kirche: Beiträge zum Thema: Das Christusbild im Menschenbild, Stuttgart 1985, S. 21-40.
--,Künstlerisches Sehen und Spiritualität, Zürich/Düsseldorf 1995.
Ratzinger, Joseph,Ein Mann der Kirche in der Welt, in: Lehmann, Karl u.a. (Hg.) Hans Urs von Balthasar: Gestalt und Werk, Köln1989, S. 349-354.
Rauchenberger, Johannes,Biblische Bildlichkeit: Kunst - Raum theologischer Erkenntnis, Paderborn 1999.
Sedmak, Clemens,Die Lesbarkeit Gottes: Dogmatik als Textwissenschaft und Literatur?, in: Tschuggnall, Peter (Hg.), Religion, Literatur, Künste: Aspekte eines Vergleichs, Anif/Salzburg 1998, S. 58-70.
Stock, Alex,Die Bilder, die Kunst und die Theologie, in: Müller, Wolfgang Erich u.a. (Hg.) Kunst-Positionen: Kunst als Thema gegenwärtiger evangelischer und katholischer Theologie, Stuttgart/Berlin/Köln 1998, S. 11-17.
Viladesau, Richard,Theological Aesthetics, New York/Oxford 1999.
Welsch, Wolfgang,DasÄsthetische - eine Schlüsselkategorie unserer Zeit?In: Welsch, Wolfgang (Hg.), Die Aktualität des Ästhetischen, München 1993, S. 13-47.
[...]
1vgl. Höhn, S. 52
2vgl. Kuschel, S. 31
3Kuschel, S. 31
4Dass die Kombination aller drei Faktoren immer wichtiger wird, zeigen z.B. die neu eröffneten Erlebnisrestaurants und -cafés (In Köln öffnete jüngst ein Restaurant, dass seine Speisen in absoluter Dunkelheit serviert; Rittermahle oder Schiffsdinners dagegen scheinen bereits wieder überholt zu sein, was die Schnelligkeit dieses Trends nur noch mehr verdeutlicht.
5Kuschel, S. 31
6Welsch, S. 15
7Der Münchener Theologe Hermann Timm hat die neunziger Jahre „Das ästhetische Jahrhundert“ getauft, (vgl. Huizing, S. 15) und Welsch klassifiziert den „neuen“ Mensch alsHomo aestheticus(vgl. Welsch, S. 20).
8Karl Heinz Bohrer spricht von dem „Primat des Bildes“ (Bohrer, S. 49).
9Hier im Sinne von Virtualität und Modellierbarkeit gemeint (vgl. Welsch, S. 20).
10Welsch, S. 19
11vgl. Kuschel, S. 32
12vgl. Kuschel, S. 30
13Kuschel schreibt: „In religiöser Sprache ist eine bestimmte kirchliche und gesellschaftliche Ordnung eingefroren, die - übertragen auf gewandelte gesellschaftliche Verhältnisse - vielfach komisch bis lächerlich wirken muß“ (Kuschel, S. 11).
14Grözinger, Praktische Theologie und Ästhetik (im folgenden abgekürzt: PTÄ), S. 111
15Grözinger, PTÄ, S. 111/112
16vgl. Grözinger, PTÄ, S. 105-122
17vgl. Grözinger, PTÄ, S. 29/30
18vgl. Grözinger, PTÄ, S. 113
19vgl. Grözinger, PTÄ, S. 26, auch S. 2-4
20Grözinger, PTÄ, S. 116
21vgl. Gräb, S. 63/64
22vgl. Mädler, S. 18f, auch zu einer umfassenderen Diskussion
23Guerriero, S. 284
24Viladesau, S. 12
25Viladesau, S. 26
26vgl. Viladesau, S. 29
27Guerriero, S. 285
28vgl. Guerriero, S. 285
29Clemens Sedmak bemerkt (zwar in einem anderen Kontext aber dennoch passend): „ Der Mensch „Jesus“ wird zum vermittelnden Prinzip „Christus“ transformiert“ (Sedmak, S. 63).
30vgl. Viladesau, S. 37
31vgl. Grözinger, PTÄ, S. 78, auch Fußnote
32vgl. Huizing, S. 17
33vgl. Huizing, S. 13
34Kuschel deutet neben den Schriftstellern auch auf Jesus als Poeten hin: „Er war gewiß kein Dichter, kein Schriftsteller, aber ein Erzähler war er durchaus, ein Poet allemal. Pointiert gesagt: Er war derArchepoet seiner Sache, der seinen Weg und seine Botschaft (Anbruch des Reiches Gottes) in Spiegelgeschichten faßte, sich
35Huizing, S. 17
36Huizing, S. 23
37Von Balthasar beschreibt selber, wie er durch die Exerzitien geprägt wurde (vgl. Balthasar, Mein Werk, S. 40) und Joseph Kardinal Ratzinger berichtet über Balthasar: „Unter einem Baum in einem abgelegenen Waldgebiet nahe bei Basel überfiel ihn der Blitz der Gewissheit: Du mußt Priester werden, du musst ignatianisch werden“ (Ratzinger, S. 351). Ratzinger bezieht das „Ignatianische“ Balthasars allerdings allein auf den Gehorsam gegenüber dem Papst und der Amtskirche.
38Vgl. Mädler, S. 18 / “In their origins, religion and art formed a unity” (Viladesau, S. 16).
39vgl. Mädler, S. 18
40Rauchenberger, S. 39
41Theodor W. Adorno betont sogar, dass die Kunst heute getreuer als Philosophie und Theologie das leistet, was deren Aufgabe einmal war (vgl. Grözinger, PTÄ, S. 65).
42vgl. Gräb, S. 65/66
43Gräb, S. 66
44Stock, S. 15
45Grözinger, PTÄ, S. 69
46vgl. Grözinger, PTÄ, S. 69
47Kuschel, S. 27 Paul Feyerabend weist darauf hin, „dass die Wissenschaften im Grunde auch nicht anders verfahren als die Künste, denn beide operieren einem Stil gemäß, und Wahrheit und Wirklichkeit sind in der Wissenschaft ebenso stilrelativ wie in der Kunst“ (Welsch, S. 39).
48„(...) the “bewitchment“ that language exercises over its speakers, making us mistake our words for real states of being” (Viladesau, S. 21).
49Grözinger zitiert hierzu Schwebel: „Mag Kirche ihren eigenen Wahrheitsanspruch ‚höher’ veranschlagen, so ist - irdisch betrachtet - ihre Form der Wahrheitssuche mit anderen Formen des Suchens aufgrund der grundsätzlichen Offenheit von Wahrheit auf der gleichen Stufe (Grözinger, Gibt es eine theologische Ästhetik?, S. 40/41). Und Friedhelm Mennekes führt an: „Allzu tief sitzen die gegenseitigen Verwundungen und Empfindlichkeiten im Verhältnis von Kunst und Kirche. Dazu haben dogmatische Arroganz und profane Aggressivität inzwischen eine zu lebendige Geschichte (Mennekes, Zwischen Kunst und Kirche, S. 22).
50Mennekes, Zwischen Kunst und Kirche, S. 22
51Rauchenberger, S. 42
52Mennekes, Künstlerisches Sehen und Spiritualität, S. 10
53Kuschel, S. 2
54vgl. Kuschel, S. 456
55Kuschel, S. 29
56Kuschel, S. 6
57Grözinger, Gibt es eine theologische Ästhetik?, S. 38
58vgl. Mennekes, Künstlerisches Sehen und Spiritualität, S. 10
59vgl. Grözinger, PTÄ, S. 27
60Kuschel, S. 18. Auch Grötzinger ist der Ansicht, dass Offenbarung an die souveräne Selbstvorstellung Gottes, wie sie uns im Zeugnis der Schrift vorliegt, gebunden bleibt. Insofern ist für ihn Kunst ein Ort ästhetischer Erfahrungen, der aber Entsprechungen zum Offenbarungsgeschehen aufweist (vgl. Grözinger, PTÄ, S. 133/4).
61Kuschel, S. 19
62Kuschel, S. 24
63Rauchenberger, S. 44
64Kuschel, S. 26
65vgl. Lesch, S. 14. Eine theologische Ästhetik, die solcherart argumentiert, steht in der Tradition der negativen Theologie.
66Erne, S. 284
67Kuschel, S. 1
68Michael Hartmann schreibt, wenn auch in einem anderen Kontext: „Es ist uns immer wieder begegnet, daß im Schönen, im Spiel, eine Zone der Wirklichkeit, des Seins, eröffnet wird, die über das Alltägliche hinausreicht, letztlich zum Göttlichen hin transzendiert und offen steht; diese Zone des Offenseins birgt inchoativ die Heilsgüter: Frieden in Gott, Seeligkeit und Verklärung, Überwindung der Schuld, verborgene Anwesenheit des Paradieses (...)“ (Hartmann, S. 78).
69Viladesau, S. 35. Wenige Seiten zuvor heißt es: „(...) the restoration of aesthetics to theology ’is in no sense to imply that the aesthetic perspective ought now to dominate theology in the place of the logical and the ethical’” (Viladesau, S. 30).
70vgl. Viladesau, S. 12
71Huizing, S. 15
72Gräb, S. 65
73vgl. Viladesau, S. 16/17. Weiter heißt es dort: “(...) it can use that history (of art PS) as a source for the knowledge of concrete religion, and it can find there (particularly in liturgy and art) an „illustration“ of its own meanings”
74Kuschel, S. 14
75Kuschel, S. 14
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt das Thema Ästhetische Theologie, untersucht verschiedene Ansätze und Theorien innerhalb dieser Disziplin und deren Relevanz für die heutige Gesellschaft, Kirche und Theologie. Es analysiert die Veränderungen in der Gesellschaft, insbesondere die zunehmende Ästhetisierung der Lebenswelt und die Herausforderungen, denen sich Kirche und Theologie dadurch gegenübersehen.
Welche Hauptpunkte werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Frage, warum sich Theologen zunehmend mit ästhetischer Theologie beschäftigen. Es wird eine soziologische Untersuchung der Gesellschaft vorgeschlagen, um die rapiden Veränderungen der Lebenswelt zu verstehen und zu prüfen, ob ästhetische Theologie bessere Antworten auf die Erfordernisse der Zeit geben kann. Die Arbeit stellt drei Grundmodelle unterschiedlicher Theorien von Ästhetik vor und kombiniert sie mit theologischen Ansätzen.
Wie wird die Gesellschaft in Bezug auf Religion und Glauben analysiert?
Die Analyse der Gesellschaft beschreibt, wie Religion und Glaube im Zuge der Moderne aus dem Alltag verdrängt wurden und die Gesellschaft stetig säkularer wurde. Der Fokus liegt auf der "Erlebnisgesellschaft" und der zunehmenden Ästhetisierung der Lebenswelt. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern diese Entwicklung zu Orientierungslosigkeit und psychologischen Problemen führt.
Welche Rolle spielen Bilder und Medien in der heutigen Kultur?
Das Dokument betont die dominante Stellung des Optischen und die Macht der Bilder in der heutigen Kultur. Die Werbeindustrie nutzt Bilder zu ökonomischen Zwecken, während Nachrichtensendungen einen wachsenden Voyeurismus bedienen. Es wird auch auf eine Tiefenästhetisierung hingewiesen, die sich in einer "Derealisierung des Realen" äußert, wobei die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen.
Wie reagiert die Kirche auf die gesellschaftlichen Veränderungen?
Es wird festgestellt, dass die Kirche trotz ihres Wissensschatzes über Formen und Symbole eine Abnahme ästhetischer Kompetenz erlebt. Die Strukturen der Kirche sind zu veraltet, um die Mehrheit der Menschen zu erreichen, und die theologische Sprache hat sich nicht mit den gesellschaftlichen Veränderungen mitentwickelt. Es wird argumentiert, dass die Kirche vor dem Dilemma steht, etwas zu sagen zu haben, aber keiner es hören will.
Was sind die drei Grundmodelle ästhetischer Theorie, die vorgestellt werden?
Die drei Grundmodelle ästhetischer Theorie sind:
- Ästhetik als Theorie des Schönen (Hans Urs von Balthasar)
- Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis (Klaas Huizing)
- Ästhetik als Theorie der Kunst
Was sind die zentralen Ideen von Hans Urs von Balthasars ästhetischer Theologie?
Hans Urs von Balthasars ästhetische Theologie konzentriert sich auf die "Herrlichkeit Gottes", die sich in der Person Jesu Christi inkarniert und manifestiert. Christus wird als "Gottes zentrales Kunstwerk" betrachtet, und die Sinne werden als Organe der Wahrnehmung nicht ausgeschlossen.
Was sind die Hauptthesen von Klaas Huizing in Bezug auf ästhetische Theologie?
Klaas Huizing betont die sinnliche Wahrnehmung als Zugang zur Transzendenz. Er sieht die Bibel nicht als dogmatisches Lehrbuch, sondern als ästhetische Ur-kunde. Die Evangelien werden als Inkarnationsdrama gelesen, in dem Jesus Christus im Leseakt Gestalt annimmt und die LeserInnen affektiv betroffen macht.
Wie wird die Kunst als Ort menschlicher Erfahrung betrachtet?
Die Kunst wird als Ort der "conditio humana" betrachtet, wobei archetypische Gestalten in der Literatur die grundlegenden Bedingungen des menschlichen Lebens versinnbildlichen. Es wird auf die Spannung zwischen Karfreitag (Leiden, Tod) und Ostersonntag (Auferstehung, Hoffnung) hingewiesen.
Kann Kunst ein Ort religiöser Erfahrung sein?
Es wird diskutiert, ob Kunst religiöse Erfahrungen vermitteln kann. Während einige, wie Karl Barth, die Offenbarungsqualität von Kunstwerken ablehnen, sehen andere, wie Georg Steiner, "Gottes Gegenwart" in jedem großen, ernsthaften Kunstwerk. Die Kunst kann etwas andeuten, auf etwas verweisen und die Wirklichkeit hin auf das Unbegreifliche transzendieren.
Welchen Platz können die vorgestellten Ansätze einer Ästhetische Theologie in der Theologie einnehmen?
Die Ansätze einer Ästhetischen Theologie können unterschiedliche Plätze einnehmen. Balthasars Theorie ergänzt eine rein abstrakte und rationale Fundamentaltheologie und Dogmatik. Huizings Ansatz betont die sinnliche Wahrnehmung und verbindet sich mit einer Theologie, die in der mystischen Tradition verwurzelt ist. Eine anthropozentrische ästhetische Theologie, die die Kunst in den Mittelpunkt stellt, kann insbesondere für die praktische Theologie von Nutzen sein.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Schlussbetrachtung gezogen?
Die Schlussbetrachtung betont den Wert eines anthropozentrischen Ansatzes in der ästhetischen Theologie. Es wird für eine politisch engagierte Theologie plädiert, die die Ungerechtigkeiten der Welt anprangert und gegen sie ankämpft. Zudem wird die Bedeutung von Ruhe, Stille und Betrachtung in der schnelllebigen Gesellschaft hervorgehoben.
- Quote paper
- Petra Schulz (Author), 2001, Zur Standortbestimmung einer Ästhetischen Theologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105507