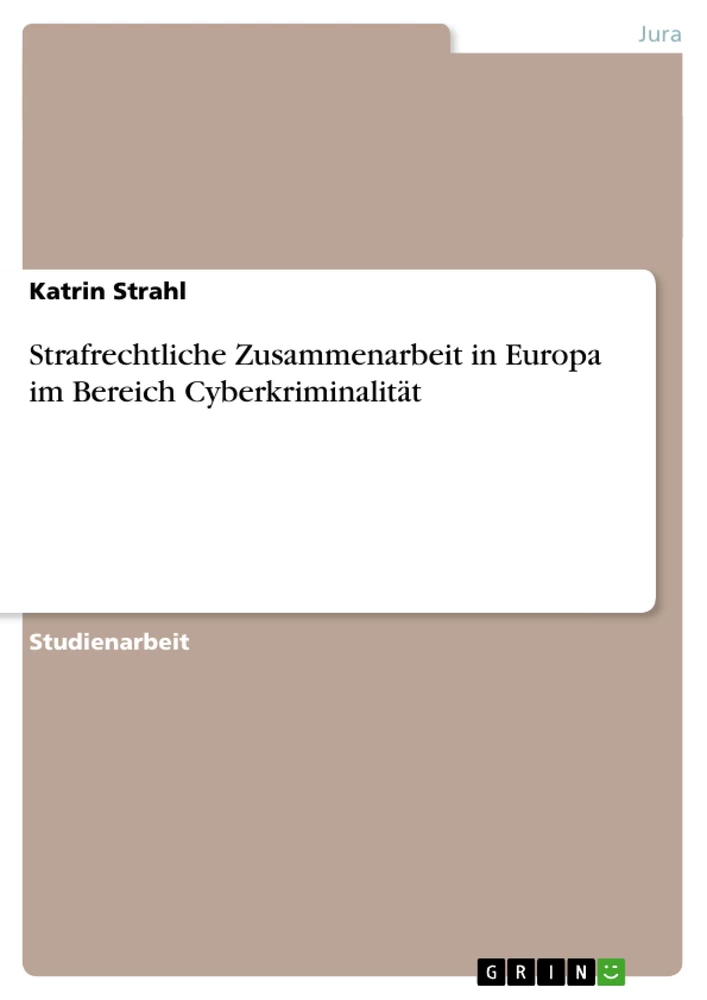Strafrechtliche Zusammenarbeit in Europa im Bereich Cyberkriminalität
Das Internet entwickelt sich in den letzten Jahren immer mehr zum Massenmedium. Die Benutzerzahlen wachsen rapide an. Mehr als 30 Mio. Rechner sind in ca. 61000 intra- und internationale Netzen miteinander vernetzt. Von rund 800 Millionen Internet-Seiten im WWW bewegen sich Schätzungen zur Zahl der Seiten mit strafbaren Inhalt zwischen acht und zehn Millionen. Die Strafverfolgung erscheint gegenüber eines solchen Kriminalitätspotentials utopisch, zumal durch die Virtualisierung der Straftätergruppen deren Ermittlung durch konventionelle Ermittlungstechniken nicht möglich ist. Die Vielfalt der Kriminalitätsformen im Internet ergibt sich aus den vielfältigen Möglichkeiten der Informationsdarstellung. Durch die Möglichkeit des Zugriffs auf gesicherte Firmendaten durch sogenannte ,,Hacker" entsteht das Potential zur Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Damit geht der Mißbrauch des Datenschutzes, sowie Spionage einher.
Da eine Kontrolle der verbreiteten Inhalte allein schon durch die täglich wachsende Größe des Internets unmöglich ist, wird auch die Verbreitung terroristischen, staatsfeindlichen und neonazistischen Gedankenguts möglich gemacht.
Angesichts des weltumfassenden Charakters des Internets stellt sich zunächst die Frage, ob deutsches Strafrecht überhaupt anwendbar ist.
Innerhalb des deutschen StGB wird diese Frage im Rahmen des internationalen Strafrechts in den §§ 3 bis 7 und 9 geregelt. Die internationale Strafrechtsregelung des StGB basiert zunächst auf folgenden Prinzipien:
Nach demTerritorialprinzipsind alle Taten der Strafgewalt des Staates unterworfen, innerhalb dessen Staatsgebiet diese begangen wurden, unabhängig davon, wer sie begeht oder wer das Opfer ist. Anknüpfungspunkt ist somit der Tatort.
DasSchutzprinzipdehnt die nationale Strafgewalt auf Taten aus, die zwar im Ausland begangen werden, die jedoch inländische Rechtsgüter gefährden oder verletzen. Als Unterfall des Schutzprinzips gilt das in § 7 StGB normierte sogenanntepassive Personalprinzip, das den Strafrechtsschutz auf Auslandstaten gegen eigene Staatsangehörigen ausweitet. Das sogenannteaktive Personalprinzipknüpft an die Staatsangehörigkeit des Täters an und unterwirft diesen dem eigenen Strafrecht auch für Taten im Ausland.
DasUniversal- bzw. Weltrechtsprinzipunterstellt Rechtsgüter dem strafrechtlichen Schutz, die von allen Kulturstaaten anerkannt sind und an deren Schutz ein gemeinsames Interesse besteht.
Das Prinzip derstellvertretenden Strafrechtspflegebesagt letztendlich, daß inländische Strafgewalt dort einzugreifen hat, wo die an sich zuständige ausländische Strafjustiz aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen an der Durchsetzung ihres Strafanspruches gehindert ist.
Die fortschreitende Nutzung verschiedenster Kommunikationstechniken macht eine buchstäblich grenzenlose Kriminalität möglich. Der Fortschritt bietet noch strafrechtliche Schlupflöcher, die nur durch internationale legislative, judikative und exekutive Zusammenarbeit zu schließen sind.
In der Festlegung der Federführung im grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahren zwischen den Nationen ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten. Es besteht kaum eine Möglichkeit der Konzentration von grenzüberschreitenden Ermittlungen in einem Land. Das unübersichtliche europäische Strafrecht, Vorbehalte der Länder gegeneinander führen zu einem insgesamt sehr unübersichtlichen europäischen Strafrecht.
Den Weg hin zur internationalen Zusammenarbeit habe ich kurz chronologisch dargestellt (siehe Anhang).
Die Vielzahl an europäischen Gesetzesvorlagen und Aktivitäten zur Bekämpfung der Cyberkriminalität zeigen, daß sowohl von Seiten des Europarates, als auch von Seiten privater Initiativen dem Thema Rechnung getragen wird. Die Schwierigkeit, so viele Nationen gesetzlich und exekutiv auf einen Nenner zu bringen, erfordert großes Engagement und Kompromißfähigkeit. Unter der Aufsicht der schon etablierten Institutionen, wie dem Europarat und dem Europaparlament, könnte die grenzüberschreitende Kriminalität erfolgreich bekämpft werden.
Die Absicht der Europäischen Kommission, Europol und das in Zukunft entstehende Euro-Just eng zusammenarbeiten zu lassen, ist erfolgsversprechend. Es darf jedoch nicht dazu führen, daß diese europäische strafverfolgungs- und Justizbehörde eigenständige Ermittlungen und Aburteilungen durchführt und damit über die unterstützenden Funktionen hinausgeht.
Quellen
http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,46800,00.html
Kriminalistik 3/96 Verbrechen im Cyberspace / Stephan Harbort
Kriminalistik 4/00 - Rechtl. Konfliktpunkte über der Bekämpfung von Kriminalität im Internet / Bodo Meseke
http://www.jugendschutz.net/telednst.html
ZUM Heft 2/8 S. 115/120 Teledienste und Mediendienste /Cornelius von Heyl NVwZ 1998, 1 ff. Neues Recht für Multimediadienste / Roßnagel StGB
Anhang:
1957 Europäisches Auslieferungsübereinkommen (Europarat)
1959 Europäisches Rechtshilfeabkommen
1995 Übereinkommen über das vereinfachte Auslieferungsverfahren
Juni 1997 Amsterdamer Aktionsplan gegen die organisierte Kriminalität zur verstärkten
Bekämpfung der High-Tech-Kriminalität
3. Dezember 1998 Erstellung des Dokumentes ,,Elemente der Strategie der Union gegen High-Tech-
Kriminalität"
01. April 1999 Vertrag von Amsterdam
Titel IV EU-Vertrag (Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen)
Artikel 29 und 30 EU-Vertrag unterlegt weiterhin die Verstärkung der operativen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
23. April 1999 Der EU-Rat beschließt ein Übereinkommen zur Zusammenarbeit bei
computerbezogenen und computergestützten Straftaten. Durch eine rund um die Uhr besetzte Ansprechstelle sollen grenzüberschreitende Computerfahndungen einheitlich geregelt werden.
- Übereinkommen für die effizientere Fahndung und Verfolgung bei Straftaten mit Computersystemen und -daten
- Verstärkte Fahndung und Verfolgung von High-Tech-Straftaten, wie Computerbetrug und Verstöße gegen Datenschutzrechte im Internet
- Schaffung einer geeigneten europäischen Gerichtsbarkeit
- Beschleunigung der Amtshilfeersuchen durch rund um die Uhr besetzte Ansprechstellen
- Entwicklung eines Übereinkommens zur Ermöglichung der Datenrecherche in mitgliedstaatlichen Hoheitsgebieten
- Ermöglichung von grenzüberschreitenden Computerfahndungen zum Zwecke von Ermittlungen bei schweren Straftaten
- Beteiligung der Kommission im vollen Umfang 15./16. Oktober 1999 Treffen der europäischen Regierungschefs in Tampere:
- Schaffung einer besseren Vereinbarkeit und Konvergenz der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten
- Bereitstellung gemeinsamer polizeilicher und justitieller Ressourcen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
- Gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen
- Einvernehmen in Bezug auf Auslieferungsverfahren (gem. Art. 6 EUV) und deren Beschleunigung über Eilverfahren
- Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im Ermittlungsbereich, wie der schnellen Sicherung von Beweismaterial
- Schaffung eines gemeinsamen Ermittlungsteams zur Bekämpfung von Menschenhandel mit Teilnahme von Europol-Vertetern
- Einrichtung einer operativen Task Force der europäischen Polizeichefs in Zusammenarbeit mit Europol zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität
- Stärkere Hinzuziehung von Europol zu Analysen, Koordination, Erhebung von Daten zu speziellen Strafdelikten
- Verabschiedung über die Errichtung eines europäischen Gerichts (EURO-JUST) bis zum Ende des Jahres 2001 zur Erledigung von Rechtshilfeersuchen · Einrichtung einer Europäischen Polizeiakademie zur Schulung hochrangiger Angehöriger der Strafverfolgungsbehörden
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Strafrechtliche Zusammenarbeit in Europa im Bereich Cyberkriminalität"?
Der Text behandelt die strafrechtliche Zusammenarbeit in Europa im Bereich der Cyberkriminalität. Er beschreibt, wie das Internet als Massenmedium Kriminalität ermöglicht und erschwert. Die Herausforderungen der Strafverfolgung angesichts des globalen Charakters des Internets und der Virtualisierung von Straftätergruppen werden thematisiert.
Welche strafrechtlichen Prinzipien werden im Text genannt?
Der Text erläutert verschiedene strafrechtliche Prinzipien, die bei der Beurteilung von Straftaten mit internationalem Bezug relevant sind: das Territorialprinzip, das Schutzprinzip (einschließlich des passiven Personalprinzips), das aktive Personalprinzip, das Universal- bzw. Weltrechtsprinzip und das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege.
Welche Probleme bei der internationalen Zusammenarbeit werden im Text angesprochen?
Der Text weist auf Schwierigkeiten bei der Festlegung der Federführung in grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahren hin. Die Vielfalt des europäischen Strafrechts und Vorbehalte der Länder untereinander erschweren die Zusammenarbeit. Außerdem werden strafrechtliche Schlupflöcher durch den technischen Fortschritt benannt.
Welche europäischen Gesetzesvorlagen und Initiativen werden im Kontext der Bekämpfung von Cyberkriminalität erwähnt?
Der Text erwähnt verschiedene europäische Initiativen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, unter anderem vom Europarat und von privaten Initiativen. Es wird die Notwendigkeit von Engagement und Kompromissfähigkeit betont, um eine einheitliche gesetzliche und exekutive Basis zu schaffen.
Welche Institutionen und Organisationen werden im Zusammenhang mit der internationalen Zusammenarbeit genannt?
Der Text bezieht sich auf den Europarat, das Europaparlament, die Europäische Kommission, Europol und Eurojust. Die Zusammenarbeit dieser Institutionen wird als erfolgsversprechend dargestellt, aber es wird davor gewarnt, dass diese europäischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden eigenständige Ermittlungen durchführen.
Welche Ereignisse und Übereinkommen werden im Anhang des Textes chronologisch aufgeführt?
Der Anhang listet eine chronologische Übersicht über relevante Ereignisse und Übereinkommen auf, die die internationale Zusammenarbeit im Strafrecht betreffen. Dazu gehören das Europäische Auslieferungsübereinkommen (1957), das Europäische Rechtshilfeabkommen (1959), das Übereinkommen über das vereinfachte Auslieferungsverfahren (1995), der Amsterdamer Aktionsplan gegen die organisierte Kriminalität (Juni 1997), die Erstellung des Dokumentes "Elemente der Strategie der Union gegen High-Tech-Kriminalität" (3. Dezember 1998), der Vertrag von Amsterdam (1. April 1999), Beschlüsse des EU-Rates zur Zusammenarbeit bei computerbezogenen Straftaten (23. April 1999) und das Treffen der europäischen Regierungschefs in Tampere (15./16. Oktober 1999) mit verschiedenen Beschlüssen zur justitiellen und polizeilichen Zusammenarbeit.
Was sind die wichtigsten Punkte des Treffens der europäischen Regierungschefs in Tampere?
Das Treffen in Tampere umfasste unter anderem die Schaffung einer besseren Vereinbarkeit und Konvergenz der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die Bereitstellung gemeinsamer polizeilicher und justitieller Ressourcen zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen, Einvernehmen in Bezug auf Auslieferungsverfahren und deren Beschleunigung, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im Ermittlungsbereich, die Schaffung eines gemeinsamen Ermittlungsteams, die Einrichtung einer operativen Task Force der europäischen Polizeichefs in Zusammenarbeit mit Europol, die Stärkere Hinzuziehung von Europol und die Verabschiedung über die Errichtung eines europäischen Gerichts (EURO-JUST).
- Quote paper
- Katrin Strahl (Author), 2001, Strafrechtliche Zusammenarbeit in Europa im Bereich Cyberkriminalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105502