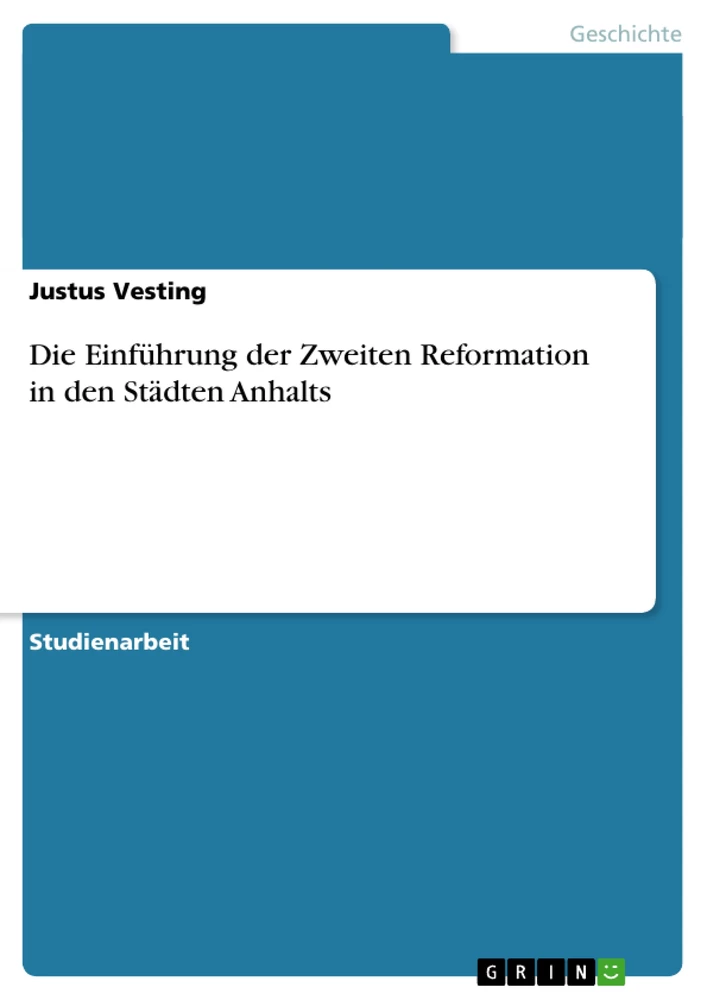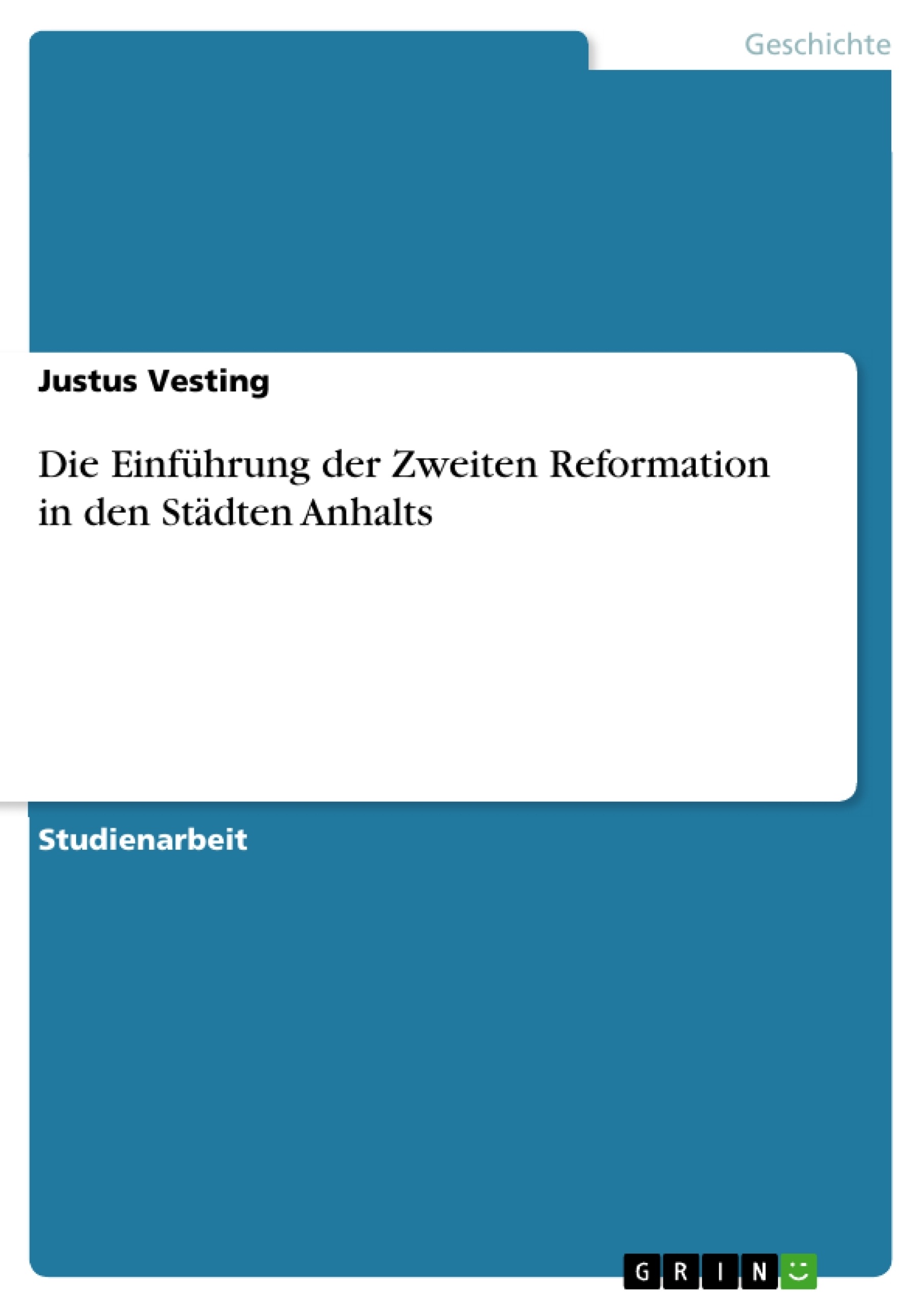Wie Anhalts Städte gegen den Geist des Absolutismus kämpften – eine packende Chronik des Widerstands! Diese tiefgründige Analyse enthüllt, wie sich die Bürger von Anhalt im 16. und 17. Jahrhundert gegen die Einführung der Zweiten Reformation zur Wehr setzten, einem Wendepunkt, der weit mehr als nur theologische Differenzen offenbarte. Entdecken Sie, wie die Städte, einst Bollwerke der lutherischen Reformation, ihre hart erkämpfte Selbstständigkeit gegen die zunehmende Macht der Fürsten verteidigten. Im Fokus stehen Zerbst, Dessau, Bernburg und Köthen, deren Schicksale exemplarisch für den Konflikt zwischen städtischer Autonomie und fürstlichem Absolutismus stehen. Die Einführung des reformierten Bekenntnisses unter Fürst Johann Georg I. eskalierte den Konflikt, der sich in der Abschaffung des Exorzismus, der Entfernung von Altären und der Einführung neuer Abendmahlsriten manifestierte. Doch hinter den religiösen Auseinandersetzungen verbarg sich ein Kampf um politische und wirtschaftliche Interessen. Die Städte befürchteten, durch die fürstliche Kirchenpolitik ihrer Privilegien und Einflussmöglichkeiten beraubt zu werden. Die Bürger protestierten auf vielfältige Weise: Sie verweigerten die Teilnahme an Gottesdiensten, reichten Beschwerden ein und störten die neuen Zeremonien. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Motive der Akteure, von theologischen Überzeugungen bis hin zu handfesten wirtschaftlichen Interessen, und zeichnet ein facettenreiches Bild einer Epoche des Umbruchs. Tauchen Sie ein in die Welt des Konkordienstreits, der Auseinandersetzungen um das Abendmahl und die Rolle des Gymnasiums illustre in Zerbst. Erfahren Sie, wie Theologen wie Wolfgang Amling und Magdeburger Theologen wie D. Sack in die Konflikte eingriffen und wie die Bevölkerung auf die erzwungenen Konfessionswechsel reagierte. Es wird untersucht, inwiefern die Zweite Reformation in Anhalt eine Reformation „von oben“ war und welche Rolle die Ritterschaft und die Landstände spielten. Der Widerstand der Städte war ein vielschichtiges Phänomen, das theologische, politische und wirtschaftliche Aspekte vereinte. Die Einführung der Zweiten Reformation markierte einen entscheidenden Schritt hin zur Durchsetzung des fürstlichen Absolutismus in Anhalt. Diese Studie bietet neue Einblicke in die Dynamik zwischen Landesherren und Bürgertum in der Frühen Neuzeit und zeigt, wie Konfessionspolitik zur Durchsetzung territorialstaatlicher Interessen instrumentalisiert wurde. Ein Muss für alle, die sich für Reformationsgeschichte, Stadtgeschichte und die Entstehung des Absolutismus interessieren. Schlüsselwörter: Zweite Reformation, Anhalt, Zerbst, Dessau, Bernburg, Köthen, Konfessionalisierung, Absolutismus, Stadtgeschichte, Kirchengeschichte, Johann Georg I., Wolfgang Amling, Konkordienstreit, Philippismus, Calvinismus, Luthertum, Territorialstaat.
Inhalt
1.Einleitung
2. Die Einführung der Zweiten Reformation in den Städten Anhalts
2.1. Die Situation der Städte und ihr Verhältnis zum Fürstenhaus vor und in der lutherischen Reformation
2.2. Das Kräftemessen der Städte mit den Fürsten zwischen den Reformationen
2.3. Die wegweisenden Ereignisse zur Zweiten Reformation in Anhalt
2.4. Die reformatorischen Maßnahmen Johann Georgs und die Reaktionen in Anhalt
2.5. Die Situation seit der Teilung des Fürstentums
3. Ursachen für die Reaktion der Städte
4. Schluss
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Zweite Reformation1 gilt im Gegensatz zur Reformation Luthers allgemein als eine Reformation von “oben”. Meistens führten die jeweiligen Landesherren mit Hilfe von hochgebildeten Theologen und umsichtigen Ratgebern die Neurungen hin zur reformierten Konfession in ihren Landesteilen durch. Dazu zählten unter anderem die Pfalz, Brandenburg, kurzzeitig Kursachsen und eben auch das Fürstentum Anhalt. Hier waren es vor allen Dingen die Fürsten und die Superintendenten die versuchten ihre phillipistische Haltung im Lande zu verwirklichen. Die Freundschaft dieser Leute mit Melanchthon, die theologische Überzeugung die lutherische Reformation zu vollenden2, die fehlende “als lutherisch verstandene Vergangenheit” in Anhalt3, sowie die günstigen Bedingungen in der calvinistischen Theologie für die “Disziplinierung von Landadel, Pfarrern und Untertanen”4, der Drang zur Homogenisierung von den lutherischen Nachbarn und der “Familienstolz” der Askanier5 dürften einige der Gründe sein, weswegen das Fürstenhaus diesen Weg einschlug.
Die Städte Anhalts hatten sich schon sehr früh zur lutherische Reformation bekannt, und sie gewissermaßen von “unten” her vorangetrieben und durchgesetzt. In dieser Arbeit will ich versuchen darzustellen, wie die Städte auf diese “diktierte” Zweite Reformation reagierten.
Dabei werde ich, in chronologischer Reihenfolge, die Ereignisse vor und in der lutherischen Reformation kurz andeuten (1.1.), dann gehe ich auf die ersten Auseinandersetzungen in den Jahren 1545 -1578 (1.2.), und auf die Zeit des Konkordienstreits ein (1.3.). Anschließend folgt der Abschnitt über die entscheidenden Ereignisse der Zweiten Reformation in Anhalt (1.4.) und schließlich die Zeit bis zur Wiedereinführung des Luthertums (1.5.). In einem zweiten Teil werde ich einige Thesen über das Handeln der Städte entwickeln, und damit gleichzeitig die Ereignisse auswerten.
Ich werde versuchen zu zeigen, dass es den Städten nicht nur um eine theologische Auseinandersetzung oder um das wahre Bekenntnis ging, sondern dass sie auf einen Prozess zur Vorbereitung des Absolutismus reagierten, und dabei um ihre eigene Selbstständigkeit fochten.
Die komplizierte Literaturlage schloss eine Fokussierung auf eine einzige Anhaltinische Stadt aus, so dass die städtischen Eigenarten nur bedingt beachtet wurden. Die verwendete Literatur ist ausführlich am Ende dieser Arbeit vermerkt.
2. Die Einführung der Zweiten Reformation in den Städten Anhalts
2.1. Die Situation der Städte und ihr Verhältnis zum Fürstenhaus vor und in der lutherischen Reformation
Die Anhaltiner Städte und insbesondere Zerbst spielten bei der lutherischen Reformation eine wichtige Rolle. Bereits 1522 hatte man die Reformation in Zerbst eingeführt6, und 1532 schließlich in ganz Anhalt7. Luther hatte dabei auch selbst in Anhalt gewirkt, und predigte am 18.Mai 1522 in der Kirche des Augustinerklosters in Zerbst, mit wohlwollender Unterstützung des Rates der Stadt8. Das Fürstenhaus dagegen bekannte sich erst 1530 nach dem Tode der Fürstenmutter Margarete von Münsterberg, die “Luther gegenüber ziemlich ablehnend” eingestellt war9, zur Reformation und zum Augsburgischem Bekenntnis. Dann war es aber sehr eng mit Luther und besonders mit Melanchthon befreundet.
Doch vor der Reformation spielte noch ein anderer Vorgang eine wichtige Rolle für das Verhältnis der Städte zu den Fürsten, nämlich die Machteinschränkung der Städte durch die Fürsten am Ende des 15.Jhd. Die “Ordnung für die Stadt Zerbst” von 1499 nahm dem Rat der Stadt seine Selbstständigkeit, und degradierte ihn zum Verwaltungsorgan des Fürsten10. Dadurch musste sich die “Metropole Anhalts, das einst blühende Zerbst”11 tief gedemütigt gefühlt haben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das “ehrbare Bürgertum der Stadt Zerbst [bei der Einführung der Reformation] die eigentliche Kerngruppe”12 war. Ein weiterer Einschnitt war die Einführung des römischen Rechts in Zerbst am 12. Dezember 1545, dass das geltende Sachsenspiegelrecht ablöste, und damit ein Übergewicht der absoluten Fürstengewalt über die Stände schuf, und die städtische Selbstverwaltung zurückdrängte13.
2.2. Das Kräftemessen der Städte mit den Fürsten zwischen den Reformationen
Erste Anzeichen für den städtischen Widerstand gegen die “fürstliche Reformation“, finden sich bereits in den 40ziger Jahren des 16.Jhd., als Theodorius Fabricius zum Superintendenten in Zerbst berufen wurde. Fabricius war Schüler bei Luther und Melanchthon, und insbesondere mit dem Letzteren verband ihn “eine tiefgehende Übereinstimmung in religiösen, theologischen und kirchlichen Anschauungen.”14
Nach seinem Studium in Wittenberg und einigen Aktivitäten in Münster, wurde er 1544 als Pfarrer nach St.Nikolai in Zerbst und kurz darauf auch zum Superintendenten der Stadt berufen, und zwar, wie er selbst schreibt: “zuerst von den erlauchten Fürsten von Anhalt, [erst] später aber vom Rate und den Hundertmännern”15. Möglicherweise hat ihn Melanchthon bei den Fürsten empfohlen - dafür würde auch das Engagement Melanchthons für Fabricius in späteren Jahren sprechen. Allerdings traten sehr bald theologische Differenzen zwischen dem phillipistischen Fabricius und den “samt und sonders lutherisch gesinnt[en]”16 Zerbster Pfarrern auf, sowie kirchenrechtliche Gegensätze mit dem Rat der Stadt. Seine verschiedenen Maßnahmen die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen, z.B. dass er “die etwas gelockerte Kirchenordnung [des Fürsten] wieder etwas fester anzog”17, seine Schulordnung von 1545 und seine Visitationen, erregten heftigen Widerstand, so dass es 1554 zum offenen Eklat kam. Schließlich hatte Fabricius bei der 2.Visitation “im Beisein der Herren Fürsten, ihrer Räte, der Presbyter, Subdiakonen und des städtischen Rates einige Mißbräuche des Rates” beklagt, ganz wie es ihm “als Bischof zustand“18. Bei dieser Visitation ebenso, wie bei den im Januar 1555 stattfindenden Verhandlungen in Dessau, stärkten ihm die Fürsten und auch Melanchthon den Rücken.
In den Artikeln der Beschwerdeschrift gegen Fabricius, die ein Zerbster Pfarrer und diverse Diakonen unterschrieben hatten19, fallen zwei Umstände ins Auge: Einerseits scheint es nicht wirklich um theologische Probleme zu gehen, sondern in erster Linie darum, Fabricius zu schmähen, da einige der Vorwürfe eher auf einen Papsttreuen schließen lassen, als auf einen Philippisten; andererseits ist es für sie “ein Grund zur Beschwerde, daß er wider den Brauch aller Herrschaften und umliegenden Länder und gegen die Berufung der Pfarrer die Synode abhält.”20 Während man die Schmähungen durchaus auch als Reaktionen auf Fabricius’ “Temperament und [seine] Eigenart”21 verstehen kann, so wehren sich die Verfasser im zitierten 7. Artikel der Beschwerdeschrift gegen seine autoritäre, die bisherigen Gebräuche und Regeln übergehende, Kirchenpolitik; ihre Rechte wurden beschnitten.
Das Kräftemessen zwischen dem Rat der Stadt und Fabricius hörte auch nach dem Konvent in Dessau nicht auf. In den Jahren 1556/57 zum Beispiel versuchte der Rat der Stadt “gegen alles Kirchenrecht” und gegen den Willen des Fabricius22, einen neuen Presbyter zu berufen. Er führte einfach ein neues Gesangsbuch in der Kirche ein, und 1558 störten einige Ratsherren sogar den Gottesdienst mit lateinischem Chorgesang23. Trotz der Rückendeckung der Fürsten bat er 1559 aus seinem Amt ausscheiden zu dürfen, und seinem Nachfolger Abraham Ulrich gelang offensichtlich trotz seiner Nähe zum Fürstenhaus, ein gutes Verhältnis zum Rat der Stadt aufzubauen24.
Die großen Anhaltinischen Städte, wie Dessau, Bernburg und Köthen, hatten dagegen weniger Möglichkeiten, sich gegen den fürstlichen Machtanspruch durchzusetzen, waren sie doch schließlich Residenzstädte der Fürsten. 1540 setzte Dessau durch die Annahme eines neuen Siegels ein deutliches Zeichen, dass sich die Stadt dem Fürsten unterworfen hatte, und der Rat der Stadt nicht mehr im Auftrag der Bürgerschaft regierte, sondern der verlängerte Arm des Fürsten geworden war25.
Die Fürsten von Anhalt beriefen 1547 einen Landtag, bestehend aus Vertretern der Städte und der Landstände, und zwangen sie eine Landsteuer zu bewilligen. Das bedeutete auch für die Stadt Zerbst “ein Herausgerissenwerden aus ihrer selbstständigen Stellung als Republik und die Einführung in die Landschaft als ganzes, in das fürstliche Territorium.”26
Die fürstliche Landordnung von 1572 hat schließlich der “Selbstständigkeit der Städte und des Adels auf den Dörfern in vielen Stücken ein Ende” gemacht27. Und Angesichts der Tatsachen, dass sie von bisher unbekannter “Präzision und Grundsätzlichkeit” war28, und dass der Stadtrat von Zerbst dabei völlig übergangen worden ist29, erscheint es nur verwunderlich, dass die Einführung der Landesverordnung “glatt vor sich gegangen” ist30. In ihr wurde nämlich u.a. die Errichtung einer kirchlichen Behörde, des sogenannten “Konsistoriums”, beschlossen, die neben der Kirchenverwaltung auch Entscheidungen in Ehesachen übernahm. “Damit wurde ein wichtiges Gebiet des öffentlichen Lebens der Verwaltung des Rates entzogen und unter das fürstliche Regiment gestellt.”31
Diese Schrittweise Machtzurückdrängung der Städte durch die Fürsten, insbesondere der stolzen und reichen Stadt Zerbst, konnte nicht folgenlos bleiben. Unter diesem Hintergrund sind auch die Ereignisse der Folgejahre zu verstehen.
2.3. Die wegweisenden Ereignisse zur Zweiten Reformation in Anhalt
Die folgenden Jahre wurden bestimmt vom sogenannten Konkordienstreit, bei dem letztendlich die Anhalter Spitzentheologen, nach mehreren theologischen Diskussionen, dem Fürsten Joachim Ernst rieten, die Konkordienformel (1578) ebenso wenig, wie das Konkordienbuch (1580) zu unterschreiben. Damit stellte sie sich gegen die lutherische Ubiquitätslehre, und signierten den Bruch zu den lutherischen Gebieten im Reich.
Über die Haltung der Städte in dieser Zeit lässt sich nur spekulieren.
In Zerbst war Wolfgang Amling, seit 1573 Pfarrer und seit 1577 Superintendent. Er hatte seit 1569 an den theologischen Verhandlungen teilgenommen. Offensichtlich war er sowohl beim Fürsten, als auch bei der anhaltinischen Geistlichkeit, seiner Gemeinde und der Zerbster Bürgerschaft überaus beliebt, und besaß großes Vertrauen32. Dies lässt vermuten, dass die Bevölkerung dem Theologen blind vertraut hat, und wahrscheinlich auch über die Ereignissen nicht besonders informiert gewesen ist bzw. von den hochtheologischen Problemen, die auch überaus kompliziert formuliert waren, nicht viel verstanden hat. Nach der offizielle Meinung des Fürstenhauses, hielt man es auch weiterhin mit Luther. In der “Repetitio Anhaltina”33 von 1581 wurden u.A. das Augsburgische Bekenntnis, die Schmalkhaldischen Artikel, die beiden Katechismen Luthers und die Schriften Melanchthons angenommen34. Und sieht man sich den §7 “Vom Abendmahl des Herrn” an, so liest man dort: “Wir behalten aber diese [...] Meinung, [...], daß nämlich im Abendmahl des HErrn, im Brod und Wein oder mit Brod und Wein wahrhaftig ausgetheilet und genossen werde eben der Leib, welcher am Altar des Kreuzes [...], und auch eben das theure, werthe Blut, [...]. Denn der Stifter, unser HErr und Heiland Jesu Christi, ist in diesem [...] Abendmahl, [...], selber wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig und theilet selbst aus in den äußerlichen und sichtbaren Zeichen oder symbolis (als: Brod und Wein), wie er wahrhaftig gegenwärtig ist, seinen wahren Leib für uns am Holz des Kreuzes gegeben, und sein wahres Blut für uns vergossen;”35 Während der erste Teil stark an die lutherische Formulierung erinnert, lehnt sich der zweite Teil eher an das Calvinistische Verständnis vom Abendmahl an. Bei solch einer Verwirrung ist es nicht verwunderlich, dass die Städte nur mit Verständnislosigkeit reagierten36.
Für die Errichtung des Gymnasium illustre 1582 in Zerbst, dass nach der Übernahme der Ordination der Anhaltinischen Theologen durch Amling (1578) nötig geworden war37, konnte Amling auch den Rat der Stadt gewinnen, indem er ihm versprach alte Rechte hinsichtlich der Schulgestaltung und der Professorenberufung zurückzugeben38. Zweifellos war die Errichtung einer Hochschule in der Stadt ein ungeheurer Prestigegewinn, und viele Bürger waren “zuerst so stolz gewesen” auf die Schule39, auch wenn sie dem Zweck diente, die phillippistische Theologie Amlings (der bis zu seinem Tod 1606 die Professur für Theologie innehatte40 ) bei den jungen Anhaltinischen Studenten durchzusetzen.
Das erste offizielle Bekenntnis, dass allen Geistlichen Anhalts als Anhaltisches Bekenntnis vorgelegt wurde41, war das Bekenntnis “Vom heiligen Abendmahl” von 158542. Dieses Bekenntnis war zwar offiziell von den vier Anhaltinischen Superintendenten unterzeichnet worden, unterlag aber starken Vorgaben des Magdeburger Theologen D. Sack43. Dieses Bekenntnis erreichte “die größte Nähe zum Luthertum”44, wurde als “eine Abkehr von Melanchthons Theologie und als Annäherung an die in Kursachen geltende orthodoxe Richtung angesehen”45, und versöhnte nicht nur die nichtanhaltinischen lutherischen Theologen46, sondern wurde auch “sämtlich mit Danksagung angenommen”47 von Teilen Anhalts.48 Sämtlichen Anhaltinischen Geistlichen sollte dieses Bekenntnis zur Unterschrift vorgelegt werden, und es sollte “hinfort kein Kirchen- und Schuldiener im Fürstentum zugelassen werden” wenn er nicht unterschrieben hatte49. Einige Pastoren und Bürger haben sich bei späteren Eingaben auf jenes Bekenntnis von 1585 berufen, allerdings bezweifle ich, dass es eine wahre Identifizierung der Bevölkerung mit diesem stark verklausulierten Text gegeben hat.
2.4. Die reformatorischen Maßnahmen Johann Georgs und die Reaktionen in Anhalt
Die eigentlichen reformatorischen Maßnahmen, die den starken Unwillen der Städte erregte, begannen erst mit Johann Georg I., der seinem Vater Joachim Ernst auf dem Anhaltinischen Thron, nach dessen Tod 1586, folgte, und ganz Anhalt als Vormund seiner Brüder bis 1606 regierte. Eine seiner ersten Maßnahmen war zunächst die Weglassung später dann das Verbot des Exorzismus bei der Taufe 1589/9050. Damit knüpfte er offenbar an die Tradition seines Vaters an, der seinen Bruder Johann Ernst bereits 1578 ohne Exorzismus hat taufen lassen51. Diese Maßnahme erregte heftigen Widerstand, insbesondere bei der Ritterschaft, allerdings nicht so sehr aus theologischen Erwägungen, sondern weil bei deren Durchsetzung der Landtag und die Stände völlig übergangen wurden52. Dennoch hatten einige Teile der Stadtbevölkerung Angst um ihr Seelenheil bzw. das ihrer Kinder, und so weiß man von einem Schuster aus Bernburg, der sich dagegen auflehnte53. Die Entlassung des protestierenden, aber hochgeachteten Pfarrers Johann Arnd aus Badeborn, hat sicherlich auch den Befürwortern der Abschaffung eher geschadet54. Nicht unwichtig ist hierbei, dass der Fürst noch im Mai 1589 den Ständen des Landes im Landtagsabschied schwört, dass er die Tradition seines Vaters fortführen will, und bei den Kirchengebräuchen und Zeremonien bleiben will55. Auf diesen Schwur werden sich die Protestschreiben der Ritterschaft und der Städte in Zukunft beziehen. So auch die “Erinnerungsschrift” Anfang des Jahres 1596, unterschrieben u.A. auch von 5 Vertretern größerer Anhaltinischer Städte, die sich über die ersten Gerüchte weitere Veränderungen kirchlicher Zeremonien sehr beunruhigt fühlten56.
Tatsächlich hat der Fürst dann auch Neuerungen durchgesetzt, allerdings nicht so weit und in der Form, wie ihm in der fiktiven Kirchenordnung (in 18 bzw. 28 Artikel)57 von Lutheranern unterstellt worden ist, sondern er lässt statt dem Altar, einen hölzernen Tisch aufstellen; lässt den Pfarrer sich zur Gemeinde drehen; schafft die Oblaten zugunsten von weißem Brot ab; und lässt jeden Abendmahlsteilnehmer Brot und Weinkelch selber in die Hand nehmen58.
Wie wurden nun die obengenannten Neuerungen des Fürsten in den Städten Anhalts durchgesetzt?
Schon am 10. Oktober 1596 wurde der Altar in Dessau demoliert und abgetragen, samt der darin befindlichen Reliquien, und auf Befehl des Fürsten durch einen Tisch ersetzt. Noch am selben Tag nahmen die Fürsten zum ersten Mal das Abendmahl nach reformierten Ritus59.
Während der Fürst in Dessau mit gutem Vorbild voranging, setzte Amling die Neuerungen in Zerbst durch, und erhielt dabei offenbar Unterstützung vom Rat, der das Abendmahl am 7. November 1596 in St.Nicolai anführte. Auch die Unterweisungen der Pastoren und Küster schienen reibungslos zu verlaufen60.
Auch in Köthen hat man im Dezember 1596 den Altar abgeschafft und das Brotbrechen eingeführt; alles auf Anordnung des Köthener Bürgermeisters61.
In Bernburg ließ der Bürgermeister den Altar abbrechen und am 19.Dezember wurde das Brotbrechen am hölzernen Tisch eingeführt62. Der einflussreiche Hauptmann Curt von Börstell hat in Bernburg die Änderungen vorangetrieben. Doch schreibt der Rat in einem Bericht an den Fürsten, dass die Bürger “im höchsten Grade beunruhigt” wären63.
So reibungslos ging es aber nur in den Anhaltinischen Großstädten zu, da sie unter direkter Einflussnahme des Fürsten und dessen Anhänger standen. In anderen Landesteilen dagegen regte sich Widerstand. Ballenstedt versuchte die Einführung zu verzögern. In Harzgerode und Günthersberge mussten die Pastoren den Pöbel fürchten, und der Rat der Stadt legte Beschwerde beim Kurfürsten ein. Viele Bürger, ja selbst schwangere Frauen, gingen in die lutherischen Nachbargebiete zum Abendmahl. In Jessnitz fand der Rat keinen, der die Altäre abtragen mochte. In Raguhn bat der Pfarrer um Entlassung mit dem Hinweis, dass sein Bekenntnis das von 1585 sei. In einem Ort bei Köthen gab es Widerstand sogar von Seiten der Frauen. Weihnachten 1596 verweigerten die Coswiger das Abendmahl und der Gierslebener Pfarrer kritisierte im Januar des folgenden Jahres, dass die Lehre vom Abendmahl, wie es der Fürst versucht durchzusetzen, nicht der Auffassung Luthers entspräche.64 Am radikalsten wehrten sich wohl die Frauen aus Wörbzig, die mit einer Art frühneuzeitlichem Selbstmordkommando die Einführung der reformierten Lehre verhindern wollten65.
Wie sich aus diesen Fallbeispielen folgen lässt, haben neben der Ritterschaft und den Pfarrern im Lande, auch die Räte der Städte und mit ihnen die Bürger, gegen die Neuerungen protestiert. Die Protestmaßnahmen waren im allgemeinen: die Verhinderungen bzw. Verzögerungen der fürstlichen Anordnungen, die Verweigerung des Abendmahls bzw. das Ausweichen in lutherische Gebiete, Protestbriefe an den Fürsten bzw. dessen Vertreter, viele Entlassungsgesuche von Seiten der Pastoren66, und schließlich störten die Bevölkerung die neuen Gottesdienste mit allen möglichen Mitteln.
Der Fürst reagierte konsequent auf diesen Widerstand. Die Protestschreiben ignorierte er, und Bitten um Reformationsverschonung wies er zurück. Wenn es direkten Widerstand gab, ermahnte er seine Hauptmänner oder andere Gefolgsmänner durchzugreifen. Bitten von Pfarrern um Entlassung gewährt er alle, und sorgte dann für einen neuen Kandidaten, der entweder schon im Gymnasium illustre studiert hatte, oder einer der sächsischen Flüchtlinge war, denen die Anhaltiner Fürsten nach den großen Verfolgungen der „Kryptocalvinisten“ in Sachsen Asyl gewährt hatten. Diese Auswechselungen schienen Erfolg zu bringen, denn schon im Oktober 1597 berichtet Hauptmann von Börstell, dass in Dessau, Zerbst, Lindau, Köthen und Bernburg die Reformation gut vorangeht, nur in Wörlitz, Alsleben, Coswig, Ballenstedt u.A. dieser Fortgang gehemmt wird, „weil die Haupt- und Amtsleute dort nicht genügend von dem Werk unterrichtet sind“67.
Um die Stände zu beruhigen, versprach Fürst Johann Georg in einem Landtagsabschied vom 6.April 1598 das Gewissen der Ritterschaft nicht mit falscher Lehre zu beschweren, und ihr “jure patronatus” nicht einzuschränken, behalte sich aber sein “jure supremae inspectionis” vor68. Damit hatte der Fürst offenbar gehofft alle Probleme beseitigt zu haben, doch nun flammte der Widerstand erst Recht wieder auf.
In Ballenstedt bat der Rat den Fürsten, in Bezugnahme auf jenen Landtagsabschied, am 26. April 1598 darum, der Stadt ihren alten Pfarrer Sellius wiederzugeben, der aus heftigen Protest gegen die Neuerungen im Juli 1597 seinen Abschied genommen hatte. In der Stadt Bernburg beschwerten sich Bürgermeister und Rat beim Fürsten 1599 über die Zustände, die die Einführung der Neuerungen hervorgerufen hatten. Im Juni 1598 wurde von einem förmlichen Tumult aus Bernburg berichtet, es wurden Zusammenkünfte von Reformationsgegnern gehalten, und die Gottesdienste gestört. Sogar aus der Fürstenstadt Dessau gingen viele nach auswärts zum Abendmahl, selbst fürstliche Angestellte. Diese verteidigten ihre Handlung auch mit dem Verweis auf den fürstlichen Landtagsabschied. Ein Dessauer Sattler schimpfte den Lindauer Pfarrer einen Schelm und Calvinistischen Pfaffen und dessen Frau eine Calvin’sche Hure. Der Bürgermeister von Köthen gab dem Fürsten dreist zu, dass er selbst das Abendmahl in benachbarten lutherischen Gebieten feiere. Auch der Rat der Stadt bemühte sich, nicht gerade ein Vorbild für die fürstlichen Neuerungen zu sein. Man könnte noch unzählige Beispiele aus anderen Orten Anhalts aufführen, in denen es zu Konflikten zwischen den Kräften, die die Reformen durchsetzen wollen, und ihren Gegnern, kam.69 Die Unruhen mündeten schließlich darin, dass Anfang des Jahres 1599 in Hoym von der Empore uriniert wurde, und in Reinstedt die Situation fast zu Mord und Totschlag eskalierte70.
Wie eine vom Fürsten eingesetzte Kommission im März 1599 bemerkte, sei dort, wo das Reformationswerk durchgeführt worden ist, alle Bestimmungen eingehalten worden; “Nur sei das gemeine Volk noch nicht für das alles gewonnen.[...] Und dafür sei vor allem das gute Beispiel der Geistlichen aber auch der Beamten und in den Städten der Bürgermeister und Ratmannen nötig, die deshalb zu veranlassen seien, dass sie [sich] endlich zu dem Reformationswerk bequemen”71.
Zusammenfassend lassen sich drei verschiedene Ebenen erkennen, wie das Reformationswerk angenommen bzw. abgelehnt worden ist:
1. Man kann klar sagen, dass es in den Städten eher eingeführt werden konnte, als auf dem Lande, wo die Ritterschaft sich enorm dagegen stemmte.
2. Es war eher in den großen Städten, wie Zerbst, als in kleineren Städten durchzusetzen.
3. Es standen sich bezüglich der Einführung des Reformationswerkes einige fürstentreue Stadträte und Teile der Bevölkerung gegenüber.
In den Überlegungen des Fürsten und seiner Räte, ob man die Pfälzer Agende und mit ihr den reformierten Heidelberger Katechismus im Lande einführt, finden sich auch Gedanken, die die Punkte 1 und 2 unterstreichen. So überlegt man, ob man den Lutherischen Katechismus in den Kirchen und Schulen der Dörfer, beim “gemeinen Arbeitsvolck und den alten Bauersleuthen”72 und dafür in den Städten den Heidelberger Katechismus73 einführt. Diese Überlegungen, bei denen auch mit Vertretern der Pfalz verhandelt worden ist, dauerten bis in das Jahr 1601.
Währenddessen gab es weitere Unruhen im Lande, so z.B. in Harzgerode und Jessnitz74. Schließlich hatte der Fürst beschlossen weder die Pfälzische Kirchenordnung insgesamt, noch eine spezielle Halblutherisch-Halbreformierte ganz Anhaltinische Kirchenordnung einzuführen, sondern es bei den Maßnahmen der Jahre 1596/97 zu belassen75.
Auf dem Landtag am 22. Juni 1603 bestätigte der Fürst noch einmal den Landtagsabschied von 1589, und dass er niemanden in seinem Gewissen zwingen wolle, aber gleichzeitig darum bittet, ihn nicht mit Unruhen unter Druck zu setzen76.
2.5. Die Situation seit der Teilung des Fürstentums
Im Gegensatz dazu stehen die Harzgeröder Beschlüsse vom 29. Mai 160577, in denen die Fürsten neben den Einzelheiten der Landesteilung, auch über die “Continuirung des Reformationswerks”78 übereinkommen. Darin beschließen sie auch die Einführung der großen Pfälzischen Agende in den Hauptstädten und die Einführung des kleinen Heidelberger Katechismus in den Kirchen und Schulen der Dörfer.79
Nach der erfolgten Teilung in die Fürstentümer Dessau, Bernburg, Köthen und Zerbst 1606 laufen die weiteren Maßnahmen nicht mehr hundertprozentig synchron, auch wenn man im Teilungsvertrag vom 7.August 1606 beschlossen hatte, überall die gleichen Kirchengebräuche zu behalten.
Im neuen Fürstentum Anhalt-Bernburg ist die Pfälzer Agende erst 1616 eingeführt worden80 ; dort, sowie auch im Köthener Landesteil gab es ab 1616 einen reformierten Kirchenrat81 ; allerdings konnten sich in Köthen einige konfessionelle Enklaven der Reformierung wiedersetzen82. Fürst Ludwig setzte in Köthen neben der Hof-, Kirchen und Kanzleiordnung von 1606, mit denen er eine straffe Verwaltungsordnung in seinem Teil Anhalts schuf, auch verschiedene soziale und pädagogische Maßnahmen durch83, mit denen er sich vermutlich bei seinen Untertanen nicht unbeliebt machte. Von Zerbst und Dessau wird zwar gesagt, dass sie bis 1635 keine der Reformation Rechnung tragende Kirchenordnung besessen haben sollen, aber in den Schulen der Städte wurde bereits der Heidelberger Katechismus gelehrt84. Die strenge reformierte Richtung, die es auf jeden Fall in Zerbst gegeben hat, bestätigt auch die Einsetzung des überaus reformierten Wendelin, als Nachfolger des eher gemäßigten Rektors Bersmann am Gymnasium illustre 161285.
Wie auf diese Maßnahmen nun im Einzelnen reagiert worden ist, lässt sich nur skizzieren, da die von mir erfasste Literatur darüber nur sehr wenige Auskünfte gibt.
Offenbar gab es noch einmal heftigen Widerstand im Jahre 1609, aber scheinbar eher von Seiten der Ritterschaft86. Den sich widersetzenden Beamten aus Sandersleben drohte man, sie zur Rechenschaft vor den Senior oder die Inspektoren des Landschaftswerkes zu laden, nachdem man den Hauptmann bereits entlassen hatte87.
Aber mehr Ereignisse lassen sich nicht finden.
In den hauptsächlichsten Zeremonien war das gesamte Land Anhalt ohnehin schon einige Jahre vorher reformiert worden, so dass diese förmlichen Übertritte von der Bevölkerung nur nebenbei wahrgenommen wurden. Sie hatten “nicht das geringste Interesse mehr” für die theologischen Zänkereien88, außerdem ließen sie Pest und Krieg andere Sorgen haben.
Die letzten Anhaltspunkte liefern die Ereignisse von 1642-1644, als der streng lutherisch erzogene Fürst Johann die Regierung in Zerbst antrat, und der neue Fürst das “Reformationswerk”, an das man sich “zwangsläufig gewöhnt” hatte, wieder rückgängig machen wollte. Dabei stieß er auf eine starke Opposition von Seiten des Volkes, und die Bürgerschaft wollte die traditionelle Huldigung des Fürsten verweigern89. Doch die Bevölkerung musste auch diesen erneuten Konfessionswechsel hinnehmen.
3. Ursachen für die Reaktion der Städte
Vergleicht man die Entwicklung seit Beginn des 16. Jahrhunderts fällt auf, dass der Widerstand der Städte gegen die Zweite Reformation immer Reaktionen auf fürstliche Maßnamen sind.
Die große Zeit der Städte ging zu Ende. Die Einführung lutherischen Reformation war die letzte große eigenständige Errungenschaft der Städte. Eine Folgeerscheinung dieser Reformation war eine Neustrukturierung in den politischen Verhältnissen. Der Kaiser verlor immer mehr Macht, und die Landesfürsten traten dagegen immer stärker auf den Plan. Diese ihrerseits versuchten ihre Macht weiter auszubauen, was auf Kosten der Selbstbestimmung der Städte ging. Die Städte wiederum versuchten so lange wie möglich Eigenständigkeit zu behalten. Vor diesem Hintergrund sind die Ereignisse der Zweiten Reformation in Anhalt zu sehen.
Welche Gründe spielten nun möglicherweise eine Rolle, für die Reaktion der Städte? Wenngleich auch die großen Theologischen Auseinandersetzungen zwischen den Fürsten, den anhaltinischen Elitetheologen, allen voran Amling, und auswärtigen Theologen geführt worden ist, so mag trotzdem auch theologische Gründe für den Widerstand gegeben haben.
Wie schon mehrfach erwähnt, haben die Anhaltiner die lutherischen Bekenntnisse selber eingeführt. Sie können deshalb durchaus auf eine lutherische Tradition zurückgreifen90. Hauptmanns von Börstell berichtet z.B.: dass „sich die einfältigen Leute auf den Dörfern von Jugend auf [an den Lutherischen Katechismus] gewöhnt hätten“91. Eine fürstliche Kommission stellte fest, „dass die städtischen Beamten in Harzgerode und Ballenstedt noch sehr an der Ubiquitätslehre hingen“92.
Doch darf man diesen theologischen Aspekt nicht zu hoch bewerten. Der Bevölkerung fehlte einfach die hohe theologische Bildung, um sich in diesen Fragen wirklich auszukennen. Die Texte dieser Zeit, und allen voran die verschiedenen Bekenntnisse, sind so verklausuliert, dass sogar heute noch Uneinigkeit darüber besteht, in welche Richtung ein Bekenntnis denn zuzuordnen sei93. Wie etwas eingeordnet wurde, entschied letzten Endes die Propaganda der Gegenseite.
Entscheidender dabei waren wohl eher die konkreten Maßnahmen, insbesondere die Abschaffung des Exorzismus und die 4 fürstlichen Maßnahmen von 1596/97.
Während die reformierte Anschauung sehr theoretisch ist, der Glaube sich sozusagen im Kopf und in der Seele abspielt, lässt das Luthertum noch gewisse Freiräume zum „Anfassen“. An Altarbildern kann man dem Analphabeten sehr gut biblische Geschichten und theologische Inhalte vermitteln. Das „Beschauen des Kruzifixes und anderer biblischer Bilder [werden] durch Bewegung des heiligen Geistes ein christliches Herz rühren“94. Eine kahle reformierte Kirche bietet diese Art der christlichen Bildung nicht. Hinzu kommt, dass im frühneuzeitlichen Denken Dämonen, Geister u.ä. eine wichtige Rolle spielten, und man ernsthafte Bedenken um das Seelenheil hatte, wenn man diese nun nicht mehr bei den Kindern austreiben durfte.
Vielleicht spielte bei der Wiedersetzung gegen das Abtragen der Altäre und Bilder auch eine Rolle, dass viele dieser Werke von ortsansässigen Künstlern und Handwerkern geschaffen worden sind95, und auch von Ortsansässigen finanziert worden ist, und diese die Vernichtung dieser Werke möglicherweise bedauert haben. Weiterhin haben auch Einflüsse von außen auf die Städte eingewirkt. Besonders in den Gebieten, die direkt an lutherischen Nachbarterritorien lagen, haben die Schmährufe gegen die “Kryptocalvinisten” aus Anhalt sicherlich ihre Wirkung getan. Die immer wiederholten Beteuerungen der Fürsten, dass man sich nicht als Calvinistisch verstehe96, waren nicht nur nach außen, sondern auch für die Bevölkerung im Lande bestimmt.
Nach den beiden Verfolgungswellen in Kursachsen 1574 und 1591, hatten die Anhaltiner viele philippistische Asylanten aufgenommen (z.B. den berühmten Arzt Caspar Peucer), und sie besetzten bald wichtige Positionen in Anhalt97. Das hat die Bürger nicht nur gegen die Exilanten, sondern auch gegen die philippistisch/ calvinistische Haltung aufgebracht.
Die Geistlichen, die man am Gymnasium illustre geschult hatte, und die gegen die zurückgetretenen Pfarrer ausgetauscht wurden, haben auch ihren Teil zur Unzufriedenheit der Bevölkerung beigetragen. Sie waren nicht nur ungeliebter Ersatz für beliebte Pfarrer, sondern wählten auch sehr brachiale Maßnahmen, um die neuen Verordnungen durchzusetzen. In Bernburg hatte man deshalb sogar einen eingesetzten Pfarrer wieder entlassen müssen, weil dessen Gewaltmaßregeln zu weit geführt haben98.
Dass es offenbar doch nicht so ernst gewesen ist, mit der Bewahrung des rechten Bekenntnisses, zeigen auch die Widerstände bei der Wiedereinführung des Luthertums 1644. Man hatte allerhöchstens die Konfessionswechsel satt, aber im wesentlichen versuchte man da schon wieder, sich auf ein Kräftemessen um die Macht mit dem Fürsten einzulassen.
Unerwähnt gelassen wurde bisher die steuerliche Situation. Die Städte waren die wichtigste Finanzquelle der Fürsten. Darunter besonders stark Zerbst mit 5255 Talern Landsteuer allein im Jahr 158999. In den Jahren 1547, 1555, 1564, 1565, 1579, 1589, 1593, 1603 und 1611 wurden immer wieder Steuern erlassen und vom Landtag genehmigt100. Die finanzielle Situation verschlechterte sich immer mehr, so dass die Bewilligung dieser Steuern durch die Stände, ein geeignetes Druckmittel für die Fürsten bildeten. Allerdings wurde dieses Mittel so gut wie kaum ausgereizt, und man genügte sich mit den Versprechungen der Fürsten, wie zuletzt auch auf dem Gesamtlandtag 1611, dass sie niemanden in seinem Gewissen zwingen wollen101.
Dadurch, dass die Fürsten die Karten nie vollständig auf den Tisch gelegt hatten, entstanden zwar viele Turbulenzen im Lande, aber letztendlich gelang ihnen dadurch schleichend die Einführung der Zweiten Reformation in Anhalt.
4. Schluss
Um ihre einstige Stellung wiederzugewinnen oder um wenigstens nicht alle eigenen Rechte zu verlieren, haben die Städte Anhalts immer wieder versucht den Fürsten Parole zu bieten. So weit es ging, protestierten sie gegen die fürstlichen Neuerungen. Dabei wurde zwar theologisch argumentiert, doch spielten andere Gründe eine viel wesentlichere Rolle. Die bessere Kontrolle der Großstädte durch den Fürsten erleichterte hier die Durchsetzung der Zweiten Reformation. Dass es aber zur gleichen inneren Identifizierung mit reformierten Theologie gekommen ist, wie zuvor mit dem lutherischen Bekenntnis, muss ich anhand der Literaturlage bezweifeln. Auf Grund der heftigen Proteste, die es in den kleineren Städten gegeben hatte, schließe ich auch auf breiten Widerstand in der Bevölkerung der großen Städte, nur das dieser besser unterdrückt wurde.
Bei der Einführung der Zweiten Reformation in den Städten Anhalts zeigt sich ziemlich deutlich der letzte Widerstand der Bürger gegen die Schaffung absolutistischer Verhältnisse, die diese aber auch nicht mehr verhindern konnten.
5. Literaturverzeichnis:
Becker, Heinrich: Die Art des deutschen Reformiertentums nach seiner Ausgestaltung in Anhalt, in: Beiträge zur Anhaltinischen Geschichte, Drittes Heftchen, Köthen 1900.
Becker, Heinrich: Geschichte der Stadt Zerbst: Festschrift zum Stadtjubiläum 1907, Zerbst 1907.
Becker: Reformationsgeschichte der Stadt Zerbst, in: Mitteilungen des Vereins für Anhaltinische Geschichte und Altertumskunde, 1.Band, Dessau 1908, Seite 241-499.
Duncker, H.: Anhalts Bekenntnisstand während der Vereinigung der Fürstentümer unter Joachim Ernst und Johann Georg (1570-1606). Ein Beitrag zur deutschen Kirchengeschichte, Dessau 1892.
Fabricius, Theodor: Lebensbeschreibung des ersten anhaltinischen Superintendenten, in: Zerbster Jahrbuch 16 (1931), S.37-94.
Freitag, Werner: Konfliktfelder und Konfliktparteien im Prozeß der lutherischen und reformierten Konfessionalisierung - des Fürstentum Anhalt und die Hochstifte Halberstadt und Magdeburg im 16. Jahrhundert, in: ARG 92, 2001, S.171-200.
Heppe, H.: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirchen in Deutschland, Elberfeld 1860.
Jablonowski, Ulla: Bausteine zu einer Geschichte der Stadt Dessau, 3. Die Stadt zwischen Reformation und Dreißigjährigem Kriege (3), in: Dessauer Kalender 26 (1982), S.26-39.
Jablonowski, Ulla: Der Einfluß des Calvinismus auf den inneren Aufbau der anhaltinischen Fürstentümer Anfang des 17. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel von Anhalt-Köthen, in: Meinrad Schaab (Hrsg.) Territorialstaat und Calvinismus, Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden- Württemberg, Reihe B Forschungen, 127.Band, Stuttgart 1993, S.149-163.
Münnich, Franz: Geschichte des Gymnasium illustre zu Zerbst 1582-1798, Duderstadt 1960.
Neuser, Wilhelm Heinrich: Die Erforschung der „Zweiten Reformation“ - eine wissenschaftliche Fehlentwicklung, in: Heinz Schilling (Hrsg.), Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland - Das Problem der „Zweiten Reformation“, Gütersloh 1986, S.379-386.
Schmidt, Georg: Die Fürsten von Anhalt - reformierte Konfessionalisierung und überkonfessionelle Einheitsbestrebungen?, in: Reformation in Anhalt. Melanchthon - Fürst Georg III. Katalog zur Ausstellung der Anhaltinischen Landesbücherei Dessau sowie Veröffentlichungen der wissenschaftlichen Beiträge des Kolloquiums vom 5. September 1997 in Dessau, Dessau 1997, S.66-76.
Specht, Reinhold: Geschichte der Stadt Zerbst in 2 Bänden herausgegeben von der Stadt Zerbst anläßlich der 1050 Jahrfeier, Band 1, Dessau 1998.
Specht, Reinhold: Geschichte der Stadt Zerbst in 2 Bänden herausgegeben von der Stadt Zerbst anläßlich der 1050 Jahrfeier, Band 2, Dessau 1998
Wäschke, H.: Anhaltinische Geschichte, Bd.2: Geschichte Anhalts im Zeitalter der Reformation, Köthen 1913.
Wäschke, H.: Anhaltinische Geschichte, Bd.3: Geschichte Anhalts von der Teilung bis zur Wiedervereinigung, Köthen 1913.
[...]
1 Der Begriff der „Zweiten Reformation“ ist umstritten. H. Becker schreibt von der „anhaltinischen Anschauung, [dass Luther] die Reformation bloß angefangen, bloß den Grund gelegt, auf dem die Nachkommen weiter zu bauen die Pflicht haben.“ (Becker: Die Art des deutschen Reformiertentums, S.10f.) W.H.Neuser verwirft den Begriff von der „Zweiten Reformation“ und spricht in Bezug zu Anhalt von der „konsequenten Entwicklung in der Kontinuität der Reformation“, und dass der Begriff „Zweite Reformation“ „theologiegeschichtlich unsinnig“ sei (Vgl. Neuser: Die Erforschung der „Zweiten Reformation“, S.382.) Da dies jedoch nur dem eigenen anhaltinischem Selbstverständnis, keinesfalls aber der damaligen allgemeinen Sicht entspricht, bleibe ich der Einfachheit halber beim Begriff „Zweite Reformation“.
2 Becker: Die Art des deutschen Reformiertentums, S.10-11.
3 Schmidt: Die Fürsten von Anhalt, S.66. Das dies aber höchstens auf das Anhalter Fürstenhaus, nicht aber auf die Bevölkerung des Landes zutrifft, werde ich unten ausführen.
4 Schmidt: Die Fürsten von Anhalt, S.67. Allerdings muss man dabei auch auf die Bemerkung des Fürsten Johann Georgs hinweisen, der in einer Notiz aus dem Jahre 1597 erklärt, dass „er die Lehre Calvins nicht kenne, da er in seinen Schriften nur wenig gelesen [hätte]“ (Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.151.). Auch nach der Auffassung Jablonowskis „spielte [die calvinistische Kirchenzucht] kaum eine Rolle“ (Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus“, S.159.).
5 Vgl. ebd., S.67.
6 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.24.
7 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.3. Nach Jablonowski: “in den Städten und Dörfern Anhalts” erst 1540 (Jablonowski: Bausteine, S.29.)
8 Vgl. Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.124.
9 Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.17.
10 Vgl. Jablonowski: Bausteine, S.27.
11 Jablonowski: Bausteine, S.27.
12 Becker: Reformationsgeschichte der Stadt Zerbst, S.66.
13 Vgl. Specht: Geschichte der Stadt Zerbst, Band 1, S.261.
14 Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.23.
15 Fabricius: Lebensbeschreibung, S.74.
16 Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.23.
17 Fabricius: Lebensbeschreibung, S.80.
18 Ebd., S.77.
19 Diese „Hauptartikel der irrigen Lehre des Doktors“ sind bei Fabricius: Lebensbeschreibung, S.78-79. abgedruckt.
20 Fabricius: Lebensbeschreibung, S.79.
21 Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.23.
22 Vgl. Fabricius: Lebensbeschreibung, S.88.
23 Ebd., S.89.
24 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.30.
25 Vgl. Jablonowski: Bausteine, S.29.
26 Becker: Geschichte der Stadt Zerbst, Festschrift, S.85.
27 Becker: Die Art des deutschen Reformiertentums, S.6.
28 Vgl. Specht: Geschichte der Stadt Zerbst, Band 1, S.262.
29 Ebd.
30 Becker: Die Art des deutschen Reformiertentums, S.7
31 Becker: Geschichte der Stadt Zerbst, Festschrift, S.90.
32 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.31.
33 Abgedruckt bei Heppe: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirchen, S.19-67.
34 Vgl. Heppe: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirchen, S.23.
35 Heppe: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirchen, S.45.
36 Vgl. Specht: Geschichte der Stadt Zerbst, Band 1, S.293.
37 sie wurden vorher in Wittenberg ordiniert
38 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.46.
39 Ebd., S.58.
40 Ebd., S.52.
41 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.45.
42 Abgedruckt bei Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.247-248.
43 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.40.
44 Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus, S.152.
45 Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.471.
46 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.37.
47 Ebd., S.47.
48 Offensichtlich ist dieses Bekenntnis heute auch umstritten. Laut Freitag wurden damit „der calvinistischen Abendmahlslehre Tür und Tor geöffnet“ (Freitag,: Konfliktfelder und Konfliktparteien, S.175.). Zwar trägt das Bekenntnis melanchthonianische Züge, wie in der Formulierung: „mit dem Brot und Wein“, aber insgesamt gesehen ist es überwiegend Lutherisch, wird doch die mündliche Nießung des Abendmahls ausdrücklich betont.
49 Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.46.
50 Laut Duncker hat es erste Erwägungen schon 1588 gegeben vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.55-56.
51 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.31.
52 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.57.
53 Vgl. Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.473.
54 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.37.
55 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.63-64.
56 Vgl. ebd., S.76.
57 Vgl. ebd., S.78-98.
58 Vgl. ebd., S.104.
59 Vgl. ebd., S.111.
60 Vgl. ebd., S.112-113.
61 Vgl. ebd., S.116.
62 Vgl. Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.474.
63 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.123.
64 Vgl. ebd., S.116-139.
65 Vgl. Jablonowski: Bausteine, S.37.
66 Amling musste allein im Jahre 1597 in Zerbst 25 verwaiste Pfarrstellen ersetzen vgl. Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus“, S.158.
67 Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.161.
68 Vgl. ebd., S.174.
69 Vgl. ebd., S.180-188.
70 Vgl. ebd., S.194.
71 Ebd., S.192.
72 Ebd., S.218.
73 Vgl. ebd., S.204.
74 Vgl. ebd., S.219-225.
75 Vgl. ebd., S.225.
76 Vgl. ebd., S.230.
77 Wäschke sieht dieses Datum als „den Akt der Einführung der reformierten Kirche in Anhalt“ (Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.474.), dagegen hält Duncker, dass diese Beschlüsse bis 1606 „überhaupt keine Berücksichtigung gefunden“ hätten vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.240.
78 „Nebenvertrag zwischen fünf Herrn Gebrüder Fürsten zu Anhalt etc. de dato Hazkeroda den 29. Mai 1605“ zitiert bei: Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.238.
79 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.238.
80 Vgl. ebd., S.242.
81 Vgl. Schmidt: Die Fürsten von Anhalt, S.70.
82 Vgl. Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus“, S.157.
83 Vgl. ebd., S.159-163.
84 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.244.
85 Vgl. Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.70-73.
86 Vgl. Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus“, S.157.
87 Vgl. Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 3, S. 15-16.
88 Münnich: Geschichte des Gymnasium illustre, S.92.
89 Vgl. Specht: Geschichte der Stadt Zerbst, Band 2, S.38.
90 Schmidt behauptet nämlich, dass es „in Anhalt keine als lutherisch verstandene Vergangenheit gab“ (Schmidt: Die Fürsten von Anhalt, S.66.).
91 Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.204.
92 Ebd., S.220.
93 Vgl. auch Anmerkung 47.
94 Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.77.
95 Dies geht zumindest aus dem Satz Wäschke‘s hervor: „Daß gelegentlich, und zwar bei größeren Werken, auch fremde Künstler in Anspruch genommen wurden, ist selbstverständlich.“ (Wäschke: Geschichte Anhalts, Bd. 2, S.488.) Somit scheint eben so selbstverständlich, dass es normalerweise ortsansässige Künstler waren.
96 u.A. bei Schmidt: Die Fürsten von Anhalt, S.66. oder Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.59 und auch 151.
97 Vgl. Jablonowski: Der Einfluß des Calvinismus“, S.149.
98 Vgl. Duncker: Anhalts Bekenntnisstand, S.225.
99 Vg. Jablonowski: Bausteine, S.31.
100 Vgl. Becker: Geschichte der Stadt Zerbst, Festschrift.
Häufig gestellte Fragen zur "Einführung der Zweiten Reformation in den Städten Anhalts"
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text analysiert, wie die Städte Anhalts auf die Einführung der Zweiten Reformation reagierten. Er untersucht die politischen und religiösen Hintergründe, die zu diesem Widerstand führten, und beleuchtet die Rolle der Fürsten und der Bevölkerung.
Was ist die "Zweite Reformation"?
Die Zweite Reformation bezieht sich auf die Einführung reformierter Konfessionen (insbesondere Calvinismus) in Gebieten, die zuvor lutherisch waren. In Anhalt wurde diese von den Fürsten vorangetrieben.
Warum waren die Städte mit der Zweiten Reformation nicht einverstanden?
Die Städte hatten sich früh zur lutherischen Reformation bekannt und sahen die Einführung des Calvinismus als einen Eingriff von "oben" an. Der Text argumentiert, dass es nicht nur um theologische Fragen ging, sondern auch um den Verlust städtischer Selbstständigkeit angesichts eines zunehmenden fürstlichen Absolutismus.
Welche Rolle spielten die Fürsten von Anhalt?
Die Fürsten, insbesondere Johann Georg I., versuchten, die reformierte Konfession in Anhalt durchzusetzen. Dies führte zu Konflikten mit Städten, Ritterschaft und Geistlichkeit, die an der lutherischen Tradition festhalten wollten.
Was waren die wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Zweiten Reformation in Anhalt?
Zu den wichtigen Ereignissen gehören der Konkordienstreit, die Abschaffung des Exorzismus bei der Taufe, die Einführung neuer Abendmahlsriten und die Etablierung des Gymnasium illustre in Zerbst.
Wie haben sich die Städte gegen die Zweite Reformation gewehrt?
Der Widerstand der Städte äußerte sich in verschiedenen Formen, darunter die Verweigerung der Umsetzung fürstlicher Anordnungen, die Teilnahme am Abendmahl in lutherischen Nachbargebieten, das Verfassen von Protestbriefen, die Störung von Gottesdiensten und die Beantragung von Entlassungen durch Pfarrer.
Welche Rolle spielte Wolfgang Amling?
Wolfgang Amling war Superintendent in Zerbst und eine Schlüsselfigur bei der Durchsetzung der phillippistischen Theologie. Er versuchte, den Rat der Stadt für seine Pläne zu gewinnen, was aber nicht immer gelang.
Was geschah nach der Teilung des Fürstentums Anhalt?
Nach der Teilung des Fürstentums im Jahr 1606 verlief die Einführung der reformierten Konfession in den einzelnen Teilfürstentümern (Dessau, Bernburg, Köthen, Zerbst) nicht mehr synchron. Es gab weiterhin Widerstand, aber die Bevölkerung hatte sich größtenteils an die Änderungen gewöhnt.
Welche Quellen wurden für diesen Text verwendet?
Der Text basiert auf einer Vielzahl von historischen Quellen und wissenschaftlichen Arbeiten zur Geschichte Anhalts und der Reformation. Eine detaillierte Bibliographie befindet sich am Ende des Dokuments.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Zweite Reformation, Anhalt, Luther, Calvinismus, Städte, Fürsten, Reformation, Konfessionalisierung, Zerbst, Dessau, Wolfgang Amling, Konkordienstreit, Exorzismus, Abendmahl.
- Quote paper
- Justus Vesting (Author), 2001, Die Einführung der Zweiten Reformation in den Städten Anhalts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/105175