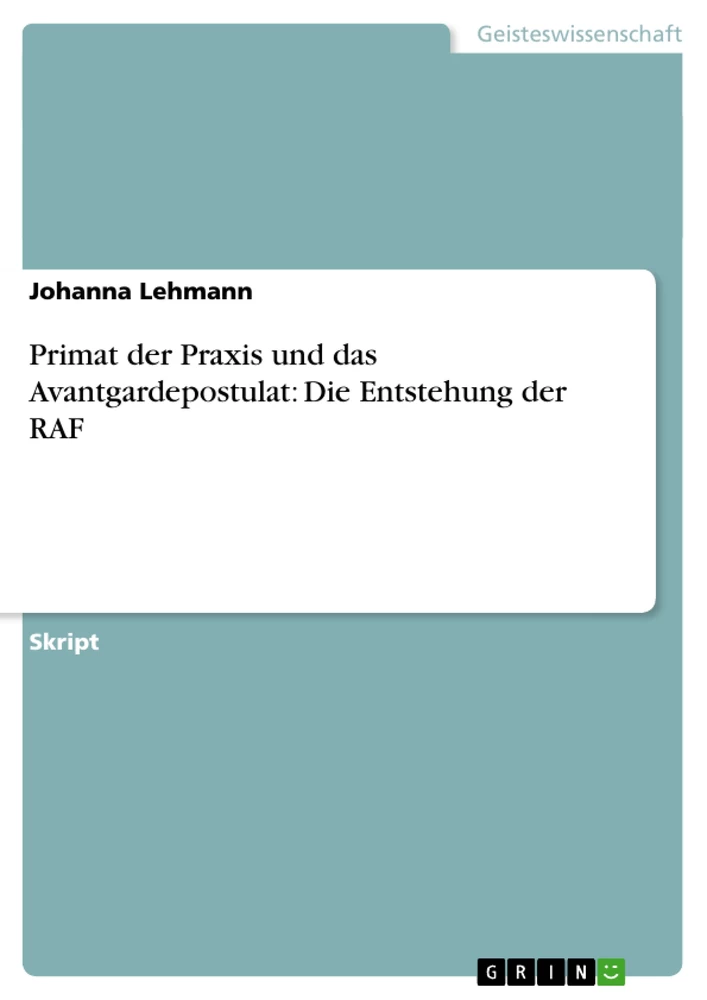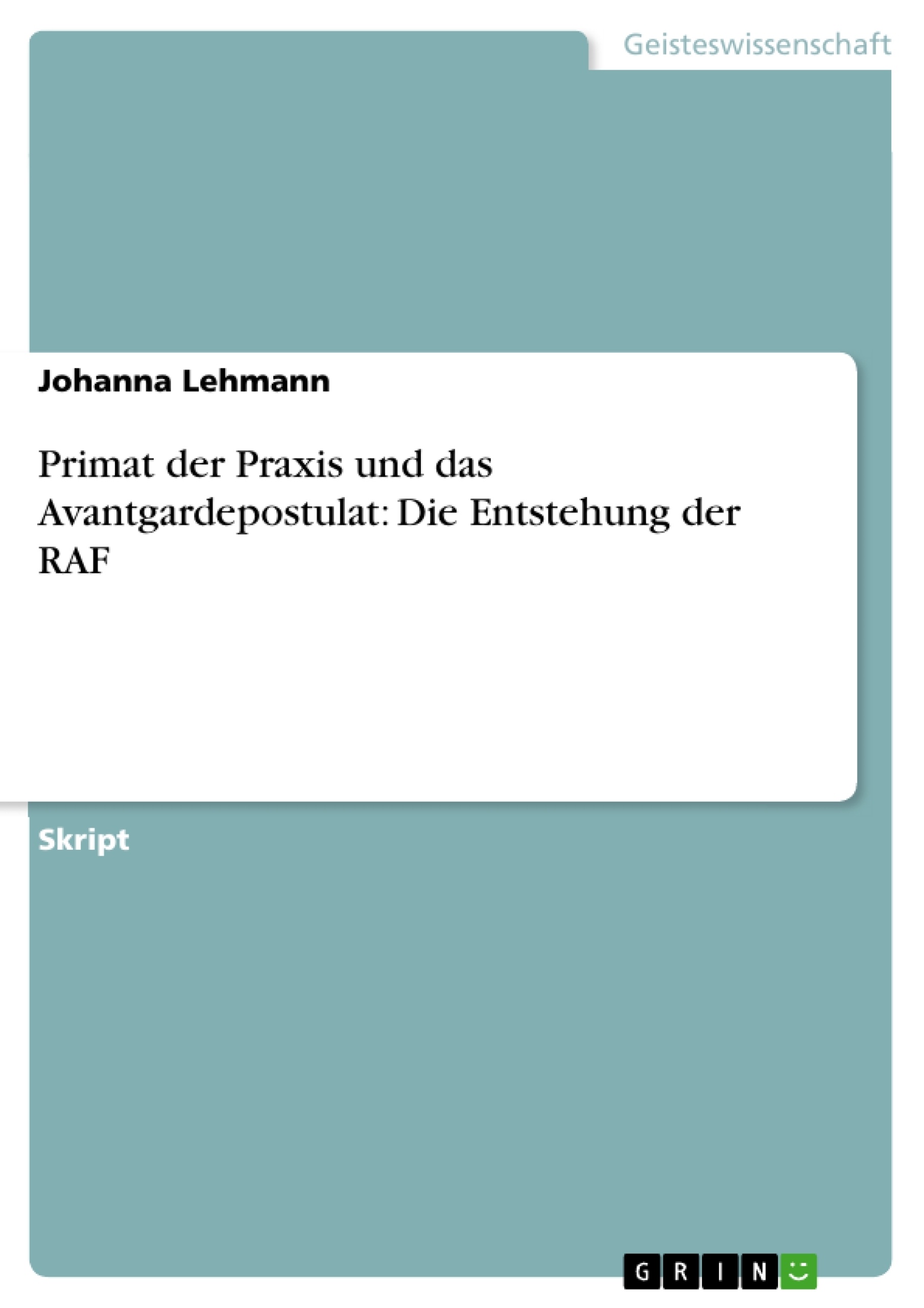Was trieb eine Gruppe junger Menschen an, sich in den Untergrund zu begeben und mit Gewalt eine Revolution erzwingen zu wollen? Diese Analyse beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und das Scheitern der Roten Armee Fraktion (RAF) aus einer soziologischen Perspektive. Im Fokus steht die Frage, inwiefern soziologische Modelle das Handeln der RAF-Aktivisten erklären können, wobei insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Realität untersucht wird. Die Analyse der RAF erfolgt im Kontext der bundesrepublikanischen Geschichte der 1970er Jahre, einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs und der politischen Polarisierung. Es wird untersucht, welche Ziele die RAF verfolgte, welche Mittel sie zur Durchsetzung dieser Ziele einsetzte und warum ihre Strategie letztlich scheiterte. Dabei werden sowohl die ideologischen Grundlagen der RAF, wie das "Avantgardepostulat" und der "Primat der Praxis", als auch die soziopolitischen Bedingungen, die zu ihrer Radikalisierung beitrugen, kritisch beleuchtet. Mit Hilfe einer erweiterten Formel der Wert-Erwartungstheorie, die auf den Arbeiten von Opp und Esser basiert, wird versucht, die Entscheidungsfindungsprozesse der RAF-Mitglieder nachzuvollziehen und die Diskrepanz zwischen ihrer subjektiven Weltsicht und der objektiven gesellschaftlichen Realität zu analysieren. War die RAF eine rationale Organisation, die auf Basis von Kosten-Nutzen-Kalkulationen handelte, oder spielten irrationale Faktoren wie Ideologie, Gruppendynamik und persönliche Motive eine entscheidende Rolle? Diese spannende und aufschlussreiche Untersuchung bietet neue Einblicke in das Phänomen RAF und regt zur Diskussion über die Ursachen und Konsequenzen von politischem Terrorismus an. Sie analysiert die Mechanismen der Radikalisierung, die Rolle von Ideologie und die Bedeutung subjektiver Wahrnehmung für das Verständnis terroristischer Gewalt, und bietet somit einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Geschichte und zur Erforschung extremistischer Bewegungen. Die Analyse der RAF bietet somit wertvolle Einblicke in die Dynamik politischer Gewalt und die komplexen Zusammenhänge zwischen individuellen Entscheidungen, gesellschaftlichen Bedingungen und ideologischen Überzeugungen.
In der heutigen Sitzung wurde die Entstehung der RAF unter soziologischen Gesichtspunkten diskutiert. Welche Ziele hatte die RAF und mit welchen Mitteln sollten diese durchgesetzt werden? Was hat zum Scheitern geführt? In wie weit eignet sich ein soziologisches Modell zur Erklärung des Handeln der Aktivisten der RAF?
Zum Zeitgeschichtlichen Kontext: Die Rote Armee Fraktion formierte sich ca. 1970
- nach der gewaltsamen Befreiung von A. Baader - und hatte es sich zum Ziel gemacht, politische Macht zu erlangen, sowie eine Umwälzung des politischen Systems zu erreichen und den Kapitalismus abzuschaffen. Einen konkreten Plan, Ersatzplan, oder Zukunftsplan war jedoch nicht konzipiert worden. Die Mitglieder der RAF vermochten diese Zukunft nur mit schwammigen, weitreichenden Begriffen zu umschreiben. Der Begriff „Befreiung“ tauchte in diesem Zusammenhang auf und schien/scheint eine sehr wichtige Bedeutung zu haben. Der Aufbau, die Organisation innerhalb der Gruppe folgte keiner festen Struktur, sie orientierten sich an den kämpfenden Einheiten Lateinamerikas. Sie übertrugen das Konzept der Guerilla auf Deutschland, und schnell sprach man von der sog. „Stadtguerilla“. Die RAF wollte das Proletariat für sich gewinnen. Indem sie einzelne, aber wohl geplante Terroranschläge verübte sollte das Proletariat aufgerüttelt werden, und das Potential sein, mit dem man eine Revolution hätte entfachen können. Die RAF sah sich als Vorreiter der Revolution.
Im Anschluss an die vergangene Sitzung, in welcher wir das Phänomen der Bürgerproteste in der DDR von ´89 besprochen haben, und es anhand des Prinzips der Nutzenmaximierung (Formel: P(A) = U - p) für die Wahrscheinlichkeit der Entscheidung des Handelnden für eine Alternative zu erklären versucht haben (Wert-Erwartungstheorie), haben wir diese Formel nun auch für das Verhalten, Handeln der RAF angewandt.
Hier noch einmal die Formel: P(A) ist die Wahrscheinlichkeit für das Ausführen einer Handlung; U stellt die Höhe des Nutzens dar, den der Akteur bei der Wahl einer Alternative erhält; p die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzen eintritt. Herr Lapinski und Herr Müller haben diese Formel gemäß der Abnehmenden Abstraktion erweitert, was zu einer allgemein anwendbaren Formel für die Entstehung von Protesten führte: nach denen von Opp in Bezug auf die Bürgerproteste in der DDR herausgearbeiteten „protestsimulierenden“ und „verhindernden“ Variablen, resultierte folgende, erweiterte Formel:
a) Wahl der Alternative „kein Protest“ à P(Ao) = U(o) - p(o). Hierbei ist U(o) die Zufriedenheit mit den aktuellen Verhältnissen/Zustand, und p(o) ist ca. 1. Die Alternative „kein Protest“ wird dann gewählt, wenn die Zufriedenheit mit der Situation hoch genug ist, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Zufriedenheit bleibt, wenn nicht gehandelt wird, eben ca. 1 beträgt.
b) Wahl der Alternative „Protest“ à
P(A1) = [U(1) - p(1)] - [U(s) - p(s)] +/- [U(su+/-) - p(su+/-)]. Hierbei ist U(1) - p(1) der Nutzen des Protestes und die Wahrscheinlichkeit des Erfolges; ist U(su+) - p(su+) die Höhe und die Wahrscheinlichkeit positiver sozialer Anreize (falls möglich und vorhanden); ist U(s) - p(s) die Höhe der Wahrscheinlichkeit staatlicher Sanktionen; ist U(su-) - p(su-) die Höhe und Wahrscheinlichkeit negativer sozialer Anreize). So ergibt sich die Wahl für die Alternative „Protest“, wenn die Summe von U(1) - p(1) + U(su+) - p(su+) höher ist, als die Summe von U(s) - p(s) + U(su-) - p(su-). Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass (p) (lt. Esser) die subjektiven
Kausalhypothesen über die Konsequenzen von möglichen Handlungen darstellt. Somit folgt, dass die Formel an sich immer aus der subjektiven Sicht des Akteurs heraus angewandt wird. In Bezug zur DDR und den Bürgerprotesten ging Opp davon aus, dass die subjektive Sicht der Akteure, also der Protestteilnehmer, weitestgehend der objektiven Lage entsprach. Demnach konnte also auch mit objektiven Variablen gearbeitet werden. In Bezug auf die Bürgerproteste der DDR und der Wert-Erwartungstheorie von Esser gab es keine „Probleme“, keine Differenzen zwischen der subjektiven Sicht und der objektiven Situation. Gerade aber bei Betrachtung der RAF stellt sich heraus, dass die subjektive Sicht nicht mit der objektiven Lage/Situation übereinstimmt. Vielmehr gibt es zwei unterschiedliche Aspekte. Zum einen die objektiven Daten/Fakten und zum anderen die subjektiven Annahmen über die Situation der Akteure/RAF selbst, welche dann auch das Handeln der Akteure bestimmt. Die rationalen Erklärungen über menschliche Akteure reichen hier nicht aus - die Soziologie muss also die subjektiven Einschätzungen (z.B. Weltbild) unter anderem mit einbeziehen, um dann das Verhalten der RAF erklären zu können.
Zu dieser „Besonderheit“ der RAF - der Glaube an ihre subjektive Wirklichkeit im crassen Kontrast zur objektiven Wirklichkeit - zählen zwei Grundsätze, welche sie sich zu eigen machte. Nämlich das „Avantgardepostulat“ und das des „Primat der Praxis“. Das Avantgardepostulat beinhaltet das Ziel der RAF, nämlich dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die das Proletariat repräsentieren können, bzw. ihre Vorreiter sein können, und dann mit ihren Taten das Proletariat für ihre Idee (politisches System umstürzen und die Abschaffung des Kapitalismus) begeistern zu können, sowie sie zum Mitmachen bewegen zu können. „Primat der Praxis“ - abgeleitet vom Marxismus und Mao Tse Tung - verbindet Theorie und Praxis. Es besagt, dass die Richtigkeit einer Theorie entschieden wird über ihre Durchführbarkeit in der Praxis. Die Mitglieder der RAF mussten also ihre Theorie in die Praxis umwandeln, bevor sie über ihre Richtigkeit, bzw. Funktionalität entscheiden konnten.
Anhand der Fakten/Daten der objektiven Lage lässt sich ein Unterschied zwischen diesen und den subjektiven Einschätzungen feststellen. Objektiv betrachtet waren die Erfolgsaussichten der RAF sehr gering. Es bestand keine Krisensituation in Deutschland, bzw. innerhalb der Bevölkerung, und die „Gegner“ der RAF - die Staatsmacht - war vergleichsweise riesig. Auch die Unterstützung innerhalb der Bevölkerung für die RAF war ungewiss. Diese Variablen aber wechselten. Die nicht-vorhandene Krisensituation entstand mit den zunehmenden Terroranschlägen der RAF, der Staat verstärkte seine Repressionen gegen die RAF massiv, und die Unterstützung innerhalb der Bevölkerung sank, bzw. wandelte sich in negative Energie um, so dass alsbald die revolutionäre Grundlage völlig verschwand. Aus subjektiver Sicht der RAF sah die Situation jedoch anders aus. Die Gruppe war bis über den Zeitpunkt ihrer Verhaftung hinaus davon überzeugt, dass sie starken Rückhalt in der Bevölkerung „genießt“. Die Angst innerhalb der Bevölkerung verursacht, durch die Terroranschläge, sahen sie als eine Art „erwecken“ oder „aufrütteln“ an, und interpretierten die steigenden negativen sozialen Anreize einfach in positive um. Eben so, dass es zu ihren Grundprinzipien, zu ihrer Ideologie passte. Und die vielen politischen Diskussionen schienen sie eher als Bestätigung für ihre Taten anzusehen. Über die staatlichen Sanktionen waren sich die Mitglieder wohl im Klaren, nämlich dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit dem Tode bestraft werden würden oder lebenslange Haft erhalten würde - zumindest die Höchststrafe. Ihr subjektiver Avantgardeanspruch fand objektiv keine Bestätigung, sie konnten ihn nicht mehr innerhalb der Bevölkerung verbreiten. Anstatt aufzuhören, da ihre Wahrscheinlichkeit des Nutzen, des Erfolges, äußerst gering war, bediente sie sich anderer Mechanismen. Die RAF reagierte mit zunehmender Radikalisierung. Und sie bediente sich der Guerillataktik, welche vielleicht in Lateinamerika funktioniert, aber nicht in dem strukturell gänzlich unterschiedlichen Deutschland. Zudem schien die Gruppe „immun“ gegen Kritik zu sein, sowie Selbstüberschätzung zu betreiben. Auch dass sie sich immer erst im Nachhinein zu ihren Anschlägen bekannte vermied die Chance, die Bevölkerung vorweg schon für eine Aktion zu begeistern. Dennoch hätte die RAF mit Auswegen, bzw. anderen Lösungen auf die objektive Situation reagieren können. Sie hatte als Handlungsalternative die Möglichkeit, ganz aufzuhören und die sich sofort aufzulösen, die Möglichkeit, ihre Taktik zu ändern oder sich eben - die gewählte Alternative - zu radikalisieren. Es war scheinbar die einzige Alternative, auch um an ihrem Avantgardepostulat festzuhalten und die Theorie des „Primat der Praxis“ bis zum Ende durchzuführen. Auch die Tatsache, dass es an sich nur zwei - folgenschwere - Alternativen für die RAF in Hinblick auf die Bevölkerung gab, war wichtig. Einerseits die Beteiligung am Protest, glorifizierend, und andererseits die Nicht- Beteiligung, verräterisch.
Häufig gestellte Fragen
Was war der soziologische Kontext der Entstehung der RAF?
Die Rote Armee Fraktion (RAF) formierte sich um 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader. Ihr Ziel war es, politische Macht zu erlangen, das politische System umzuwälzen und den Kapitalismus abzuschaffen. Allerdings gab es keinen konkreten Plan für die Zukunft, und die RAF orientierte sich an Guerilla-Einheiten in Lateinamerika, was zur Bezeichnung "Stadtguerilla" führte. Sie versuchte, das Proletariat durch Terroranschläge aufzurütteln, um eine Revolution zu entfachen.
Welche soziologischen Modelle wurden zur Analyse des Handelns der RAF verwendet?
Die Wert-Erwartungstheorie und das Prinzip der Nutzenmaximierung wurden angewandt, um das Verhalten der RAF zu erklären. Die Formel P(A) = U - p (Wahrscheinlichkeit einer Handlung = Nutzen - Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Nutzens) wurde verwendet und erweitert, um auch soziale Anreize und staatliche Sanktionen einzubeziehen. Es wurde festgestellt, dass die subjektive Sicht der RAF stark von der objektiven Realität abwich, was die Anwendung rationaler Modelle erschwerte.
Was sind das Avantgardepostulat und das Primat der Praxis im Kontext der RAF?
Das Avantgardepostulat besagt, dass die RAF sich als Vorreiter des Proletariats sah, die durch ihre Taten andere begeistern und zur Revolution bewegen könnten. Das "Primat der Praxis", abgeleitet vom Marxismus und Mao Tse Tung, besagt, dass die Richtigkeit einer Theorie durch ihre Durchführbarkeit in der Praxis bewiesen wird. Die RAF musste ihre Theorie in die Praxis umsetzen, um ihre Richtigkeit zu beweisen.
Wie unterschied sich die subjektive Sicht der RAF von der objektiven Realität?
Objektiv betrachtet waren die Erfolgsaussichten der RAF gering, da es keine Krisensituation in Deutschland gab, der Staat mächtig war und die Unterstützung in der Bevölkerung ungewiss war. Die RAF glaubte jedoch an ihren starken Rückhalt in der Bevölkerung, interpretierte die Angst als "Aufrütteln" und wandelte negative soziale Anreize in positive um. Sie hielt an ihrem Avantgardeanspruch fest, auch wenn dieser objektiv nicht bestätigt wurde.
Wie reagierte die RAF auf die Diskrepanz zwischen ihrer subjektiven Sicht und der objektiven Realität?
Anstatt aufzuhören, radikalisierte sich die RAF zunehmend und setzte auf Guerilla-Taktiken. Sie schien immun gegen Kritik und betrieb Selbstüberschätzung. Obwohl sie Handlungsalternativen hatte, wie z.B. das Auflösen der Gruppe oder die Änderung ihrer Taktik, radikalisierte sie sich, um an ihrem Avantgardepostulat und dem Primat der Praxis festzuhalten. Die RAF sah die Beteiligung am Protest als glorreich und die Nicht-Beteiligung als verräterisch.
Warum scheiterten die Erklärungsmodelle für das Verhalten der RAF?
Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (p(1)) war nur noch praktisch zu ermitteln. Der Nutzen (U(1)) lag in der "Befreiung des Menschen" und der "Abschaffung des Kapitalismus". Der Glaube an ihre Grundsätze war so stark, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzten und die Ablehnung in der Bevölkerung ignorierten. Sie sahen sich als Märtyrer und gingen davon aus, ihre Mission nicht zu überleben. Ihre subjektive Einstellung war so stark, dass sie keine andere Handlungsalternative in Betracht zogen.
- Quote paper
- Johanna Lehmann (Author), 2001, Primat der Praxis und das Avantgardepostulat: Die Entstehung der RAF, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104874