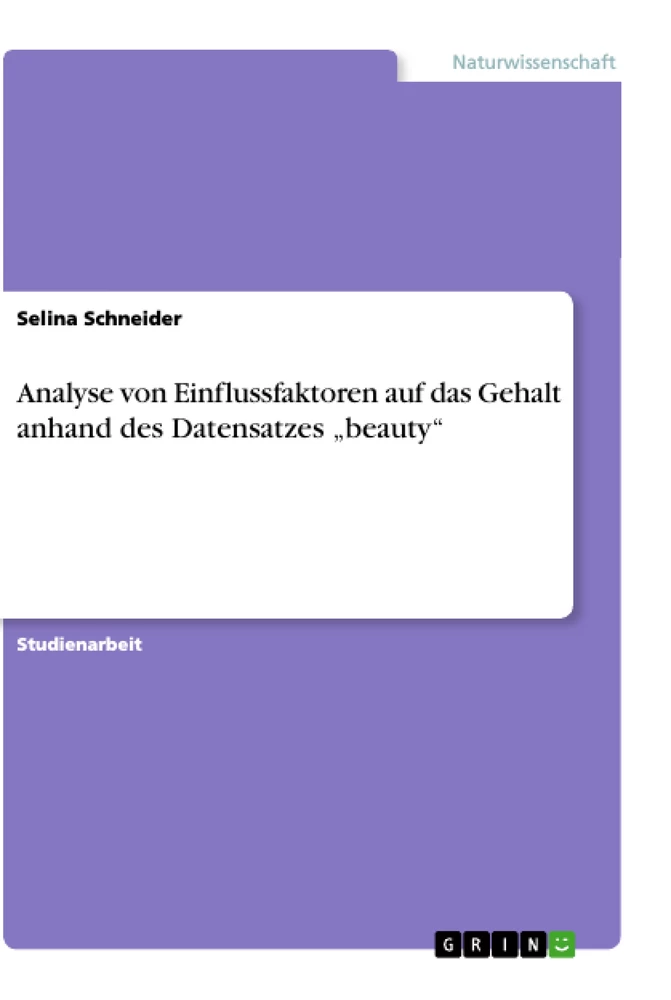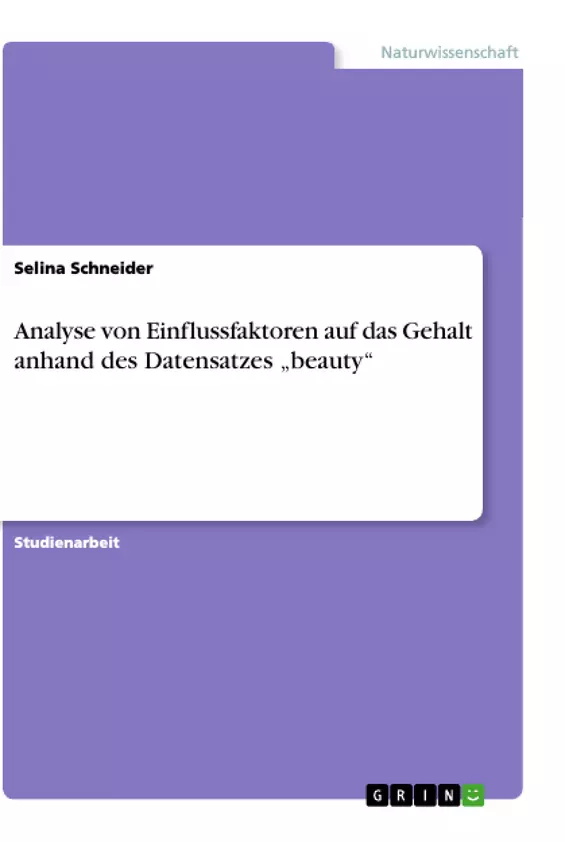Wovon die Vergütung von ArbeitnehmerInnen abhängt und ob ein Zusammenhang mit der Attraktivität existiert, wird im Folgenden mithilfe des Datensatzes "beauty" und des Programms "R Skript" genauer untersucht.
"Bewundert wurde das Schöne seit eh und je." Es gibt bis heute kaum einen Lebensbereich, in dem das Schöne keine zentrale Rolle spielt. Trotz dieser alltäglichen Aufmerksamkeit ist die Definition des Schönheitsbegriffs nicht eindeutig festgelegt. Schönheit hängt von der subjektiven Wahrnehmung jedes Einzelnen ab, aber die "Beurteilung, die einzelne Personen abgeben, … [ist nur] zur Hälfte individuell, zur anderen Hälfte [ist sie] mit anderen geteilt". Was als schön gilt, hängt eng mit der Attraktivität zusammen, und beides wird stark von der Modeindustrie, Medien und auch der eigenen familiären Umgebung geprägt. Von der Geburt an wird der Mensch mit dem Schönheitsbegriff konfrontiert.
So wurde beispielsweise bei einer Attraktivitätsforschung herausgefunden, dass Mütter stärker und häufiger auf ihre Babys reagieren, wenn diese schön sind. Das hat wiederum positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Babys hin zu einem Kind und weiter zu einem Erwachsenen. Denn "hübsche Kinder entwickeln im Laufe ihrer Sozialisation ein höheres Selbstbewusstsein, da sie von klein auf mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit erfahren". Nicht nur von den Eltern, auch in der Schule werden hübsche Kinder oftmals besser benotet trotz gleicher Leistungen. Darüber hinaus werden vor allem in den Medien fast ausschließlich schöne Menschen mit einer Vorbildfunktion präsentiert.
In der Folge strebt die Mehrheit der Gesellschaft nach diesen Vorbildern, da mit ihnen Glück, Liebe und Erfolg, assoziiert werden. Zahlreiche Studien zeigen, dass sich der Vorteile schöner Menschen bis in den Arbeitsmarkt ziehen, denn "[s]ie werden als intelligenter, erfolgreicher, zufriedener, sympathischer, und fleißiger eingeschätzt" und deswegen auch besser vergütet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung des Datensatzes beauty
- Beschreibung der Variablen
- Zusammenhänge der Variablen
- Analyse des Datensatzes beauty
- Hypothesenprüfung H1: wage ~ educ
- Hypothesenprüfung H2: wage ~ exper
- Hypothesenprüfung H3: wage ~ exper + educ + looks
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Attraktivität und Gehalt anhand des Datensatzes "beauty". Der Fokus liegt dabei auf der empirischen Überprüfung von Hypothesen, die einen Zusammenhang zwischen Attraktivität, Bildung, Berufserfahrung und dem Gehalt von Personen herstellen.
- Bedeutung des Schönheitsbegriffs in der Gesellschaft
- Einfluss von Attraktivität auf die Entwicklung des Selbstbewusstseins und die Sozialisation
- Untersuchung des Einflusses von Attraktivität auf den Arbeitsmarkt
- Empirische Analyse des Datensatzes "beauty" mit dem Programm R Skript
- Hypothesenprüfung bezüglich des Zusammenhangs von Attraktivität, Bildung, Berufserfahrung und Gehalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt den Zusammenhang zwischen Attraktivität und Gehalt in den Mittelpunkt und beleuchtet die Bedeutung des Schönheitsbegriffs in verschiedenen Lebensbereichen.
- Beschreibung des Datensatzes beauty: Dieses Kapitel beschreibt die Variablen des Datensatzes "beauty" detailliert und visualisiert sie mithilfe von Kennzahlen und grafischen Darstellungen. Der Fokus liegt auf den Variablen looks, female, educ, exper und wage.
Schlüsselwörter
Attraktivität, Gehalt, Datensatz "beauty", R Skript, Hypothesenprüfung, Bildung, Berufserfahrung, Empirische Analyse, Sozialisation, Selbstbewusstsein, Arbeitsmarkt, Frauen- und Männeranteil
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen Attraktivität und Gehalt?
Ja, die Analyse des Datensatzes "beauty" zeigt, dass attraktive Menschen im Durchschnitt oft besser vergütet werden, da ihnen unbewusst positive Eigenschaften wie Intelligenz und Fleiß zugeschrieben werden.
Wie beeinflusst Schönheit die Sozialisation von Kindern?
Hübsche Kinder erfahren oft mehr Zuwendung von Eltern und Lehrern, was zu einem höheren Selbstbewusstsein führt und ihnen Vorteile im späteren Berufsleben verschafft.
Welche Variablen werden im Datensatz "beauty" untersucht?
Untersucht werden Variablen wie das Aussehen (looks), das Geschlecht (female), die Bildung (educ), die Berufserfahrung (exper) und der Stundenlohn (wage).
Was ist das Programm "R Skript" in diesem Kontext?
R Skript ist ein Werkzeug zur statistischen Datenanalyse, mit dem in dieser Arbeit Hypothesen über die Einflussfaktoren auf das Gehalt empirisch geprüft werden.
Ist die Definition von Schönheit objektiv?
Schönheit ist subjektiv, jedoch zeigt die Forschung, dass Beurteilungen etwa zur Hälfte individuell sind und zur anderen Hälfte mit gesellschaftlich geteilten Standards übereinstimmen.
- Quote paper
- Selina Schneider (Author), 2020, Analyse von Einflussfaktoren auf das Gehalt anhand des Datensatzes „beauty“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1045279