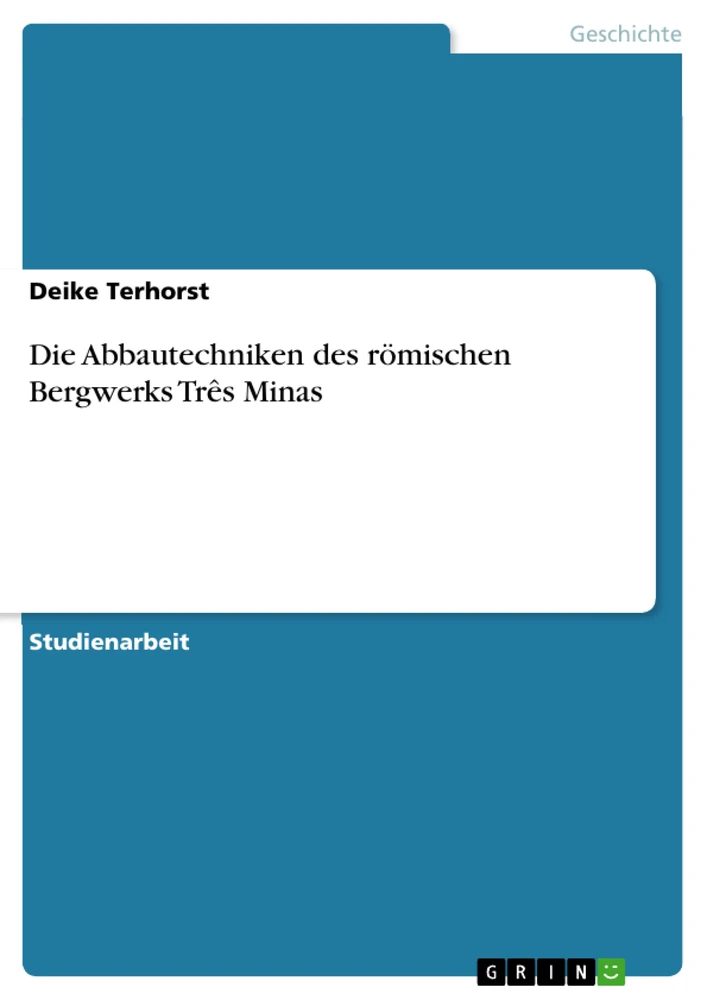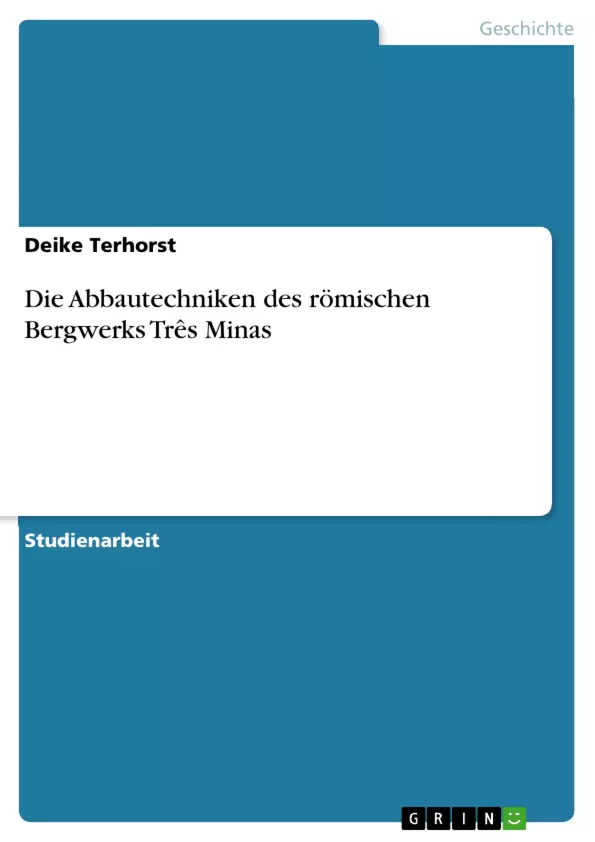Gemessen an den Verlusten antiker Substanz erscheint der Beitrag der Archäologie zur Erforschung des römischen Bergbaus gering. Zu den wenigen Plätzen, die von späteren Eingriffen weitgehend verschont geblieben sind, zählt jedoch der römische Bergwerksbezirk von Três Minas im heutigen Nordportugal. Die vorhandenen Gold-, Silber- und Bronzevorkommen wurden vermutlich vom 1.-3. Jahrhundert n. Chr. unter kaiserlicher Regie im Tage- sowie im Schachtbau gewonnen.
Der Fokus der Arbeit liegt auf den in Três Minas angewandten Abbaumethoden und den dafür notwendigen Gerätschaften. Als literarische Grundlage dienten die Werke von Jürgen Wahl, Regula Wahl-Clerici, Markus Helfert, Annemarie Wiechowski und Britta Ramminger.
Inhaltsverzeichnis
- Quellen- und Forschungslage
- Entstehung des Erzlagers
- Chronologie des Abbaus
- Funktion und Aufbau der Stollenanlagen
- Aufbereitung des Materials
- Trockene Aufbereitung
- Nasse Aufbereitung
- Thermische Aufbereitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Abbautechniken des römischen Bergwerks Três Minas im heutigen Nordportugal. Sie untersucht, wie die antike Abbaustätte entstand, wie die Erze aus dem harten Gestein gelöst und aufbereitet wurden und welche Gerätschaften dafür benötigt wurden.
- Entstehung und Ausdehnung des Erzlagers
- Chronologie des Abbaus und die Bedeutung von Lampenfunden
- Funktion und Aufbau der Stollenanlagen im Zusammenhang mit den Tagebauten
- Die verschiedenen Abbaumethoden und die verwendeten Gerätschaften
- Die Aufbereitung des gewonnenen Materials
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Quellenlage und die Forschungsgeschichte des römischen Bergwerks Três Minas. Es wird dabei auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die die Erforschung des komplexen Stollen- und Schachtsystems aufgrund von mangelnder Präzision der herkömmlichen Vermessungsmethoden verursachte. Die Einführung der 3D-Laserscan-Technologie im Jahr 2010 ermöglichte es jedoch, die Abbaustätte detailliert zu vermessen und wichtige Informationen über die Bauphasen und die verwendeten Techniken zu gewinnen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung des Erzlagers in Três Minas. Es wird die Entstehung der magmatogenen Lagerstätten und die Mineralisation der Zone durch hydrothermale Vorgänge erläutert. Die Erörterung der Herausforderungen, die der unregelmäßige Verlauf der Erzkörper mit sich brachte, führt zur Beschreibung des Tagebaus als effizientes Abbauverfahren.
Im dritten Kapitel wird die Chronologie des Abbaus in Três Minas beleuchtet. Die Erörterung des Abbaubeginns um 26/27 n. Chr. unter Kaiser Augustus und der Bedeutung der Lampenfunde aus den Hauptstollen der „Corta de Covas“ geben Einblicke in die zeitliche Entwicklung des Bergwerks. Die Frage nach der Kontinuität des Betriebs bis ins 3. Jh. n. Chr. wird anhand der spärlichen epigraphischen Zeugnisse diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Funktion und dem Aufbau der Stollenanlagen in Três Minas. Es wird die Bedeutung der Stollenanlagen im Zusammenhang mit den Tagebauten für die Förderung und Wasserlösung beleuchtet. Die Besonderheit der Stollen, die stets Gefälle zu den talseitigen Tagesöffnungen aufweisen, wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Römischer Bergbau, Três Minas, Nordportugal, Abbaumethoden, Tagebau, Stollenanlagen, Aufbereitung, Erze, Gold, Silber, Bronze, 3D-Laserscanner, Plinius Secundus, hydrothermale Vorgänge, magmatogene Lagerstätten.
- Quote paper
- Deike Terhorst (Author), 2018, Die Abbautechniken des römischen Bergwerks Três Minas, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1044697