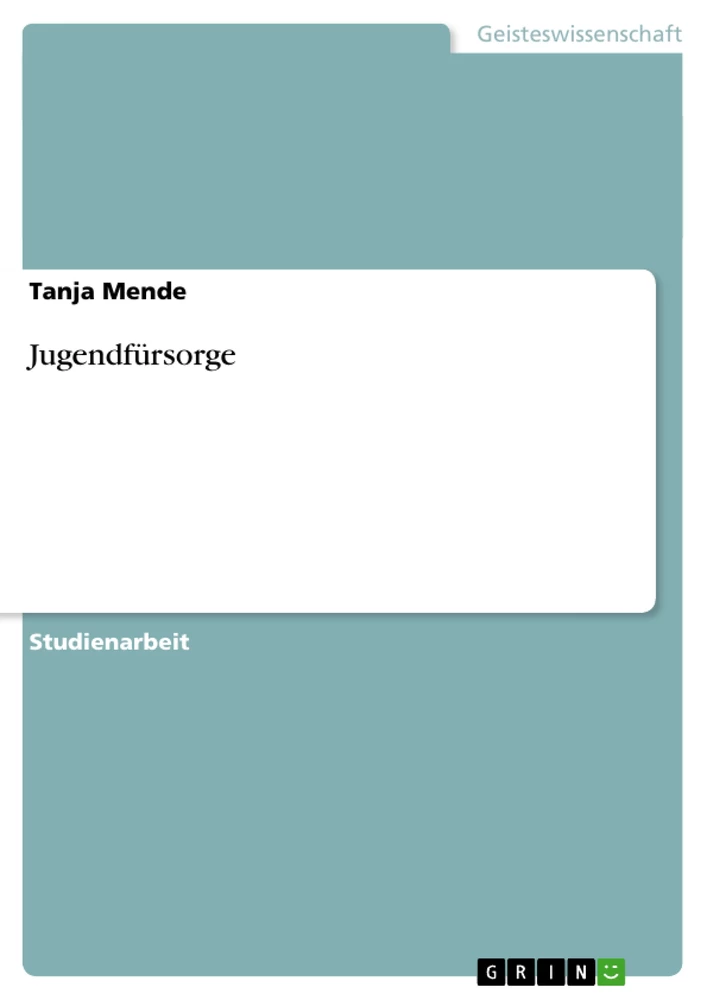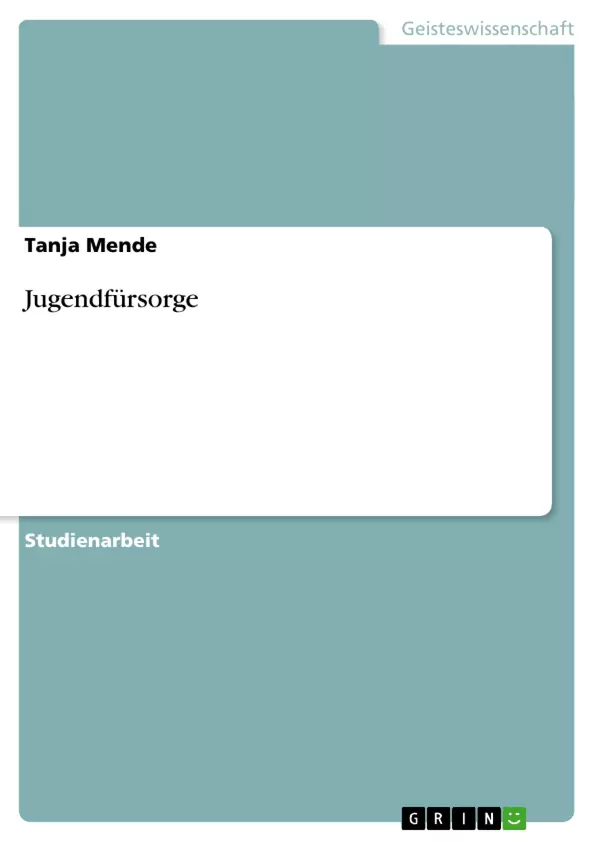Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Begriff der Jugendfürsorge
2.1. Jugendfürsorge: Was ist das?
2.2. Abgrenzung gegen Erziehung und Jugendfürsorge
3. Innere und Äußere Ursachen
3.1. Innere Ursachen oder Anlagen
3.1.1. Die Rolle der Vererbung
3.1.2. Keimesschädigung
3.1.3. Störungen während der Schwangerschaft
3.1.4. Geburtsschädigung
3.2. Äußere Ursachen und Umweltfaktoren
3.2.1. Die naturale Umwelt
3.2.2. Die menschliche Umwelt
3.2.3. Die kulturelle Umwelt
4. Geschichte der öffentlichen Jugendfürsorge
5. Die Reformbestrebung
6. Die Institution das Jugendamt
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In meiner Hausarbeit werde ich mich mit dem Thema der "Jugendfürsorge" beschäftigen. Meinen Themenschwerpunkt lege ich auf die Ursachen für Fürsorgebedürftigkeit, sowie auf den Begriff der Jugendfürsorge. Auch habe ich mich mit der Geschichte, der Reformbestrebung und der Institution Jugendamt beschäftigt.
Die Bücher "Die Geschichte der Jugendfürsorge" von H. Scherpner, "Der blockierte Wohlfahrtsstaat: Unterschichtjugend und Jugendfürsorge in der Weimarer Republik" von
M. Gräser, "Jugendfürsorge" von E. Stern und "Die Fortschritte der Jugendfürsorge" von J. Klumker haben als Grundlage meiner Hausarbeit gedient.
2. Der Begriff der Jugendfürsorge
2.1. Jugendfürsorge: Was ist das?
Unter Jugendfürsorge wird die „organisierte Hilfeleistung der Gesellschaft an einzelnen Gliedern, die in der Gefahr stehen, sich aus dem Gemeinschafts - und Gesellschaftsgefüge, aus ihrer Ordnung und ihrem Leben herauszulösen und ihr zu entgleiten“ (Scherpner 1966, S.10) verstanden, das heißt das die Fürsorge erst vorliegt, sobald der Jugendliche von dem Erziehungsvorgang nicht mehr erfaßt werden kann. Die Jugendfürsorge greift bei Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr ein. Sie greift bei auffälligen Jugendlichen ein, dies bedeutet, Jugendliche, die mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind, Jugendliche die verwahrlost sind bzw. auf den Weg der Verwahrlosung sind. Die Jugendfürsorge bewahrt die Kinder vor der Verwahrlosung und versucht sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie greift nicht in die Erziehung ein, sie ergänzt diese nur durch Sondereinrichtungen. Durch diese Sondereinrichtungen ist die Jugendfürsorge eine Umordnung der Erziehung für ein bestimmtes Individuum, das eine Fehlentwicklung einschlägt, dies bedeutet nicht, daß das Kind als ein Objekt von Erziehungsmaßnahmen gesehen wird, sondern es ist aktiv am Erziehungsgeschehen beteiligt.
2.2. Abgrenzung gegen Erziehung und Jugendfürsorge
Erst einmal haben die beiden Begriffe der Erziehung und Jugendfürsorge eines gemeinsam, bei beiden Begriffen wirkt die ältere Generation auf die jüngere ein. Sie unterscheiden sich jedoch in verschiedenen Aspekten.
Unter Erziehung wird folgendes verstanden „Erziehung ist eine gewollte, planmäßige, von gegebener Liebe zur Seele des Zöglings getragene Einwirkung auf diesen mit der Absicht, die Kulturwerte zu erhalten und zu übertragen, den Zögling gesund, lebenskräftig und lebensfroh zu machen und ihm zu befähigen, die Kultur zu genießen und in der ihm adäquaten Weise an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten“ (Stern 1927, S.15). Weiterhin versucht die Erziehung den Menschen zu individualisieren, sie erfolgt immer in einer Gemeinschaft, sei es in der Familie, der Schulklasse, dem Verein und so weiter. In erster Linie wendet sie sich an die körperlichen und seelischen Belange, sowie an die Entwicklung und Bildung des Jugendlichen.
Die Fürsorge ist demgegenüber der Teil, der auf die Jugendlichen und Kinder eingeht, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, egal ob die Beeinträchtigung der Entwicklung ihre Ursachen in krankhafter Veranlagung oder in äußeren Einflüssen hat. „Die Jugendfürsorge will in erster Linie - im Gegensatz zur Erziehung, welche der Kultur und dem Individuum zugewandt ist - das abnorm geartet oder unter abnormen Bedingungen lebende Individuum schützen und pflegen, seine Interessen der Gesellschaft gegenüber und die Interessen der Gesellschaft dem Individuum gegenüber vertreten, es erziehen und ausbilden, wenn möglich es berufstüchtig zu machen“ (Stern 1927, S.16).
Die Jugendfürsorge ordnet sich der Erziehung ein, sie unterscheidet sich jedoch zur Erziehung in dem Punkt, daß sie die Interessen des Zöglings hervorhebt.
3. Innere und Äußere Ursachen
In diesem Punkt meiner Hausarbeit werde ich versuchen, auf die Ursachen und Störungen, die um die Jahrhundertwende als Tatsache angesehen wurden, einzugehen. Ich halte die Klärung der Ursachen für notwendig, um die Geschichte der Jugendfürsorge besser erläutern zu können.
Im folgenden werde ich auf die Einteilung Sterns (1927) zurückgreifen, nämlich die inneren Ursachen bzw. Anlagen und die Umweltfaktoren.
3.1. Innere Ursachen oder Anlagen
Die inneren Ursachen sind in vier Bereiche unterteilt, in die Rolle der Vererbung, in die Keimesschädigung, in Störungen während der Schwangerschaft und in den Bereich der Geburtsschädigung.
Zuerst muß jedoch unterschieden werden zwischen ererbt und angeboren. Ererbt sind Anlagen und Eigenschaften, die direkt von den Eltern auf das Kind übergehen. Angeboren dagegen sind Störungen der Entwicklung des Kindes im Mutterleib oder Schädigung während der Geburt.
Im folgenden werde ich auf die drei Bereiche der inneren Ursachen eingehen.
3.1.1. Die Rolle der Vererbung
Es werden nur die Anlagen zu einer Krankheit vererbt und nicht die Krankheit als solches, beispielsweise die Anlage zu der Krankheit Tuberkulose und nicht die Krankheit an sich. Dies trifft bei allen Krankheiten zu.
Bei der Rolle der Vererbung ist es sehr wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine krankhafte Keimesbeschaffenheit handelt oder um eine Keimesschädigung.
Unter einer krankhaften Keimesschädigung versteht man den Fehler beim Kopieren der DNS, daher kann man dies nicht direkt als ererbt bezeichnen, sondern eher als angeboren, da die Schädigung nicht von den elterlichen Keimzellen übertragen wird, sondern nur ein Fehler bei der Übertragung der Zellen stattfindet, so daß das als angeboren bezeichnet werden muß. Dagegen ist eine Keimesschädigung eine Störung des Keimes durch äußere Einflüsse.
Eine weitere Form der Vererbung wird als „Progrediente Vererbung“ bezeichnet. Bei der progredienten Vererbung werden die Formen der Erkrankung jeder folgenden Generation schwerer. Die progrediente Vererbung wird nach Morel in vier Phasen unterteilt. Die erste Phase stellt die erste Generation dar, in dieser treten Neigungen zu Exzessen, ein allgemein nervöses Temperament und moralische Skrupellosigkeit auf. In der zweiten Generation, welche die zweite Phase darstellt, treten Neurosen, Alkoholismus, und die Neigung zu Blutungen der Gehirngefäße auf. Die dritte Phase beinhaltet schwere psychische Störungen, intellektuelle Unfähigkeiten und die Neigung zum Selbstmord. In der vierten Phase treten letztendlich Miß- und Hemmungsbildungen, sowie schwere Formen von Schwachsinn auf. Diese vier Phasen treffen nicht auf jedes Individuum zu, es trifft nur auf einzelne Fälle zu.
Weiterhin gibt es die kumulierte Vererbung, unter dieser versteht man eine elterlich, beidseitig erhöhte anlagebedingte Vorbelastung der Eltern durch eine Verwandtschaft. Die Inzucht als solches, darf aber nicht als Krankheitsursache bezeichnet werden, da daß Kind erst erhöht gefährdet ist, sobald die Eltern verwandt sind und wenn beide Elternteile in gleicher Weise mit der Anlage der Krankheit vorbelastet sind. Diese beidseitige elterliche Vorbelastung führt zur verstärkten Ausprägung von negativen Merkmalen, wie zum Beispiel Mißbildung, Schwachsinn und Gewalttätigkeit.
Diese verschiedenen Formen der Vererbung stellen eine Ursache für Fürsorgebedürftigkeit dar, da die Kinder schon durch ererbte Anlagen bzw. Krankheiten fürsorgebedürftig werden.
3.1.2. Keimesschädigung
Bei der Keimesschädigung ist es möglich, daß auch ein unbelasteter und gesunder Mensch durch äußere Einflüsse zum Trinker werden kann, dies hat zur Folge, daß es eine Schädigung der Keimzelle ist, die auch bei dem Nachwuchs Störungen hervorruft. Um die Keimesschädigung besser zu verdeutlichen, werde ich kurz auf die Untersuchung von Kraepelin und Plaut eingehen. Sie untersuchten 29 Familien, in denen der Alkoholismus eine große Rolle spielte, dabei waren 33 Fehlgeburten, 183 Kinder wurden ausgetragen, davon starben bereits 60 im 1. Lebensjahr und kurz danach starben noch weitere 20. Von insgesamt noch 103 lebenden Kindern wurden 98 persönlich untersucht, von diesen waren 35 psychopathisch und 2 bzw. 6 Kinder waren epileptisch, 12 waren imbezill und 3 waren idiotisch und von den übrigen 40 Kindern waren die meisten sehr schwächlich und in der Entwicklung zurückgeblieben. Dieses Beispiel spiegelt den Zusammenhang zwischen Alkoholismus der Eltern und der Krankheit des Kindes wieder, da der Alkoholismus der Eltern eine Keimesschädigung hervorgerufen hat.
3.1.3. Störungen während der Schwangerschaft
Durch die enge Verbundenheit der Mutter mit dem Kind, ist es verständlich, daß Gifte, die im Blutkreislauf der Mutter sind, auf das Kind schädigend übergehen. Früher war neben dem Gift Alkohol, auch noch Blei und Morphinismus sehr verbreitet. Es gibt einige Zahlen, die die Stärke des Giftes Blei widerspiegeln. Von 1000 Frauen hatten 47,6 Fabrikarbeiterinnen Früh- bzw. Fehlgeburten, 86 Arbeiterinnen in der Bleiindustrie und 133,5 Arbeiterinnen, die lange in der Bleiindustrie tätig waren, 78 Frauen waren in einer Schriftgießerei und 37 Frauen hatten eine normale Entbindung. In England ergab eine andere Untersuchung, daß von 77 Bleiarbeiterinnen 15 kinderlos waren und 35 dieser Bleiarbeiterinnen hatten zusammen 90 Fehlgeburten.
Es gibt auch noch andere Störungen, die während der Schwangerschaft auftreten können, dazu gehören Infektionen der Mutter. Das Kind wird zwar durch die Plazenta geschützt, doch auch sie kann nicht alle Keime abwehren und so kann es zu Störungen kommen.
Aber nicht nur Gifte und Infektionen können Störungen hervorrufen, zum Beispiel auch durch Unterernährung und Schwäche der Mutter kann es zu Störungen des Kindes kommen. Unterernährung und Schwäche der Mutter kann bei dem Kind Störungen, wie ein vermindertes Körpergewicht bei der Geburt, sowie eine geringe Lebenskraft des Kindes hervorrufen. Auch wenn die Neugeborenen eine bessere Ernährung erhalten, kann die Störung nicht wieder ausgeglichen werden, denn die Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit bleibt erhalten.
Eine weitere Störung während der Schwangerschaft wird als physikalische Einwirkung bezeichnet. Diese wird in zwei Gruppen unterteilt, zu der ersten Gruppe gehört die abnorme Beschaffenheit der Eihäute, die zu verschiedenen Mißbildungen führt und eine zu geringe Menge des Fruchtwassers. Unter die zweite Gruppe fallen äußere Einwirkungen, wie Unfälle, schwere körperliche Arbeit und körperliche Gewalt.
3.1.4. Geburtsschädigungen
Unter Geburtsschädigung werden Schädigungen während des Geburtsaktes bezeichnet. Zu diesen Schädigungen gehören Infektionen während der Geburt, Nervenverletzungen, sowie Brüche und Quetschungen von Knochen und Weichteilen.
3.2. Äußere Ursachen und Umweltfaktoren
Die Umweltfaktoren bzw. die äußeren Ursachen werden in drei Bereiche unterteilt, in die naturale, kulturelle und soziale Umwelt.
3.2.1. Die naturale Umwelt
Die naturale Umwelt wird in vier Bereiche unterteilt, in das Wetter, das Klima, die Bodenbeschaffenheit und in die Landschaft. Im folgenden werde ich auf diese vier Bereiche eingehen.
Das Wetter ist ein wichtiger Aspekt, da in den Sommermonaten eine höhere Säuglingssterblichkeit vorliegt, als in den kälteren Monaten. Am Stärksten ist jedoch die ärmere Schicht von der Säuglingssterblichkeit betroffen, da sie nicht im vollem Umfang über vollwertige Nahrungsmitteln verfügt, dies kommt bei den Flaschenkindern durch verdorbene Milch zum Ausdruck. Auch das feuchte Wetter ist ein wichtiger Aspekt für die Fürsorgebedürftigkeit, da in der Übergangszeit Infektionen wie Erkältungen auftreten, an denen sich später auch chronische Krankheiten anschließen können. Desweiteren beeinflußt das Fönwetter den Menschen, da dieses die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, aber es steigt auch die allgemeine Reizbarkeit, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Auch die sexuelle Triebsteigerung tritt auf und so liegen in dieser Zeit viele Affektdelikte und Sexualverbrechen vor. Eine weitere Tatsache ist, daß das Wetter in Beziehung zu Verbrechen und Geistesstörungen steht, genauso wie Körperverletzungen oder Beleidigungen weisen in den Sommermonaten eine größere Häufigkeit auf. Auch für den Selbstmord spielt die Temperatur eine große Rolle, die meisten Selbstmorde waren im Juni, Juli und August.
Jetzt komme ich zum zweiten Bereich, der naturalen Umwelt, zu dem Klima. Das Klima ist eine Ursache für größere Reizbarkeit und für Verwahrlosung. Gerade bei warmen Temperaturen ist es eine Ursache für Verwahrlosung, da Menschen einen großen Teil ihres Lebens auf der Straße verbringen und nichts tun. In kühleren Gegenden dagegen neigen die Menschen zum Alkoholismus, da sie viel Alkohol zum Aufwärmen trinken.
Desweiteren werde ich kurz auf die Bodenbeschaffenheit eingehen. Die Bodenbeschaffenheit bestimmt die Qualität des Trinkwassers, denn durch das Fehlen verschiedener Mineralien in diesem, kommt es zu Krankheiten.
Auch die Landschaft ist ein wichtiger Aspekt für die naturale Umwelt, da diese einen Einfluß auf den Gemütszustand hat. Dies zeigt sich besonders durch das Bestreben der Großstädter wieder in die Natur zu kommen.
3.2.2. Die menschliche Umwelt
Die menschliche Umwelt beinhaltet das Umfeld des Kindes und des Jugendlichen, es beginnt schon am Anfang des Lebens mit deren Eltern. So wird ein Jugendlicher beispielsweise kriminell, wenn beispielsweise der Vater ein Verbrecher und die Mutter eine Prostituierte ist, da er in diesem Umfeld von Kindesalter an Verbrechen und Schamlosigkeit beigebracht bekommen hat.
Zuerst muß die Frage „Welche Aufgaben hat die Familie?“ erörtert werden. Erst einmal hat sie die Aufgabe für den Unterhalt des Kindes zu sorgen, desweiteren muß sie für die Wohnung, Ernährung, Kleidung und für eine angemessene Körperpflege des Kindes Sorge tragen. Sobald das Kind erkrankt ist, muß die Familie für die ärztliche Behandlung sorgen. Weiterhin müssen sie sich um die Erziehung kümmern, dies bedeutet, daß die Eltern die seelische und sittliche Entwicklung des Kindes fördern und unterstützen müssen. Genauso wie die Überwachung der regelmäßigen Schulbesuche und das Erledigen von Schularbeiten und letztendlich müssen sie die Beaufsichtigung des Kinder in der Freizeit sicherstellen.
Da es in der Familie oft ein Übermaß an Liebe, oder viel zu wenig Liebe gibt, kann es zu Störungen in der Entwicklung kommen. In diesen Fällen müssen die Aufgaben der Familie von einer anderen Seite übernommen werden, dies trifft bei unehelichen Kindern, Verwaisungen und beim Versagen des Elternhauses zu.
Zuerst werde ich kurz auf die Verwaisung eingehen, dieses bedeutet schon Fürsorgebedürftigkeit, da das Kind auf die Pflege des Erwachsenen angewiesen ist. Wenn beide Elternteile des Kindes verstorben sind, ist das Kind auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen, da die Erwachsenen sich um eine Unterkunft, Verpflegung und Aufsicht kümmern müssen. Das Kind braucht in diesem Fall auch einen Vormund, der für das Kind sorgt. Die Verwaisung ist eine Ursache für verschiedene Störungen des Kindes. Es ist jedoch zu beachten, daß Mutterwaisen schwerer betroffen sind und das diese schwerer kriminell werden, als Voll - oder Vaterwaisen.
Es gibt sehr viele uneheliche Kinder, sie sind überwiegend Fälle der Fürsorgebedürftigkeit. Es muß darüber entschieden werden, ob das Kind bei der Mutter in der Familie der Mutter oder in eine Pflegefamilie gegeben wird. Uneheliche Geburten sind eine weitere Ursache für Störungen. Nach Petersen´s Untersuchung liegt beispielsweise eine hohe Wahrscheinlichkeit vor, daß uneheliche Kinder verwahrlosen und schneller kriminell werden. Dies zeigt, daß die Erziehung der unehelichen Kinder schlechter ist, genauso auch die Berufsausbildung.
Auch das Versagen des Elternhauses führt zu einer Fürsorgebedürftigkeit, da es starke Störungen im Elternhaus gibt, die direkt auf den Jugendlichen einwirken. Im folgenden werde ich kurz auf einige Störungen im Elternhaus eingehen. Oft werden die Kinder im Rausch vom Vater mißhandelt, der Vater entzieht der Familie durch den Alkoholismus Mittel, die sie für die Wohnung und Lebensunterhalt brauchen würden. Wie gerade schon angedeutet, stehen wegen des Alkoholismus weniger Mittel zum Leben zur Verfügung. Der Alkohol stumpft die Betroffenen ab, der Haushalt verwahrlost, die Wohnung verkommt, das Kind erhält zu wenig Nahrung und dadurch ist es einer erhöhten Ansteckungsgefahr gegenüber verschiedenen Krankheiten ausgesetzt und dies alles führt zur Fürsorgebedürftigkeit. Auch muß gesagt werden, daß der Alkoholismus einen schlechten Einfluß auf die Zukunft der Kinder haben kann, sehr viele der Kinder fangen selber an zu trinken, Mädchen verfallen vermehrt der Prostitution.
Eine weitere Störung ist die körperliche Erkrankung der Eltern, da eine Erkrankung in erster Linie eine wirtschaftliche Schädigung nach sich zieht. Eine Krankheit verursacht Lasten und hebt die Verdienstmöglichkeit auf, weiterhin mangelt es an der Aufsicht des Kindes und auch dies führt zu Störungen. Genauso das ständige Miterleben des Leidens kann bei dem Kind zu gesundheitlichen Schäden führen. Auch Einflüsse von anderen Seiten führen zum Versagen des Elternhauses, fremde Personen können schädigende Einflüsse auf das Kind übertragen und die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen. Mit den fremden Personen sind beispielsweise Lehrer gemeint, die einen falschen
Erziehungsstil anwenden, zum Beispiel die Kinder ungerecht behandeln. Schwerwiegender werden die Störungen, sobald der Erzieher gewalttätig wird, das Kind mißhandelt und mißbraucht. Natürlich trifft das letztere nicht nur auf den Erzieher zu, sondern auch auf fremde Personen. Dies führt zu einer ständigen Angst des Kindes vor älteren Menschen.
Dieses alles schließt die menschliche Umwelt als Ursache für Fürsorgebedürftigkeit ein.
3.2.3. Die kulturelle Umwelt
Die kulturelle Umwelt bringt zum Ausdruck, in welchem Maße Umweltfaktoren an der Entwicklung der Fürsorge beteiligt sind. Die Umweltfaktoren setzen sich aus den gesellschaftlichen und den wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Unter gesellschaftlichen Faktoren wird der Verfall der Normen verstanden und zu den wirtschaftlichen Faktoren zählen die Armut, das Wohnungselend, der Beruf und die Arbeit, die Stadt und das Land, der Alkoholgenuß des Kindes, die Schundliteratur und das Kino, sowie andere Faktoren. Im folgenden werde ich auf die wirtschaftlichen Faktoren eingehen, doch werde ich nicht auf alle eingehen, da es den Rahmen der Hausarbeit sprengen würde.
Unter Armut versteht man, daß die zum Leben erforderlichen Mittel nicht aufgebracht werden können. Die Großstädter sind von der Armut am Stärksten betroffen, da sie den wirtschaftlichen Krisen sehr viel stärker ausgesetzt sind. Weiterhin sind die Familienbeziehungen in der Großstadt nicht mehr so eng, da jeder sein eigenes Leben zu leben versucht. Auch die Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Faktor der Armut, da viele Familien unter Kurzarbeit leiden oder der Ernährer arbeitslos ist und von daher das Einkommen sehr gering ist, so daß das Geld für die Wohnung und eine angemessene Ernährung oft nicht reicht. Durch das geringe Einkommen ist auch verständlich, daß es zu verschiedenen Erkrankungen kommt, wie zum Beispiel Unterernährung. Desweiteren ist in der armen Schicht auch eine hohe Kindersterblichkeit zu beobachten, da die Kinder nicht lang genug gestillt werden können und es von daher Flaschenkinder sind und die Nahrung, die sie zu sich nehmen, oft verdorben ist. Auch die Verwahrlosung steht im engen Zusammenhang mit der Armut, da die Kinder zu wenig Kleidung und Schuhe besitzen, dies stellt die körperliche Verwahrlosung dar. Auf der anderen Seite steht noch die sittliche Verwahrlosung, diese beinhaltet, daß die Kinder schon sehr früh zum Betteln angestiftet werden und dieses letztendlich zur Kriminalität führt.
Als nächstes werde ich mich mit dem zweiten wirtschaftlichen Faktor, dem Wohnungselend beschäftigen. Dieses beinhaltet erst einmal die soziale Frage, nämlich die Wohnungsfrage überhaupt. Durch die Industrialisierung kam es zu einem rapiden Bevölkerungswachstum, doch der Wohnungsbau konnte diesem Wachstum nicht standhalten. Die Wohnung hatte die Bedeutung von Schutz, in erster Linie Schutz vor der Witterung, in Bezug auf Stürme und Niederschläge. Doch ist es eine finstere und verunreinigte Wohnung, treten verschiedene Krankheiten auf, ist es eine feuchte Wohnung, treten häufig Erkältungskrankheiten auf und heiße Wohnungen sind besonders für Säuglinge schädlich. Desweiteren waren viele Menschen auf Untermieter angewiesen, so daß sie ihre Miete bezahlen konnten, und durch diesen Umstand war die Ansteckungsgefahr gegenüber verschiedenen Krankheiten recht groß.
Der dritte Faktor beinhaltet den Beruf und die Arbeit. Es wurde die Berufsberatung gegründet, um die Jugendlichen von den ungelernten Berufen fernzuhalten und sie sollte den Jugendlichen helfen einen passenden Beruf entsprechend ihren Fähigkeiten zu finden. Die Wahl des falschen Berufes zieht zwei negative Auswirkungen nach sich, einerseits kann der Jugendliche die ihm aufgetragenen Leistungen nicht bewältigen und wird schließlich vorzeitlich vom Lehrherr entlassen und findet kaum eine andere Lehrstelle, da er als faul und untüchtig gilt. Zum anderen wirkt eine Entlassung negativ auf den Jugendlichen ein, da er sich selbst auch als faul einstufen wird und weiterhin ist es eine große Enttäuschung für ihn, da er große Erwartungen in sich und seine Lehre investiert hat, so treten Minderwertigkeitskomplexe ein. Aber nicht nur die richtige Wahl des Lehrberufes ist entscheidend, oftmals wird der Lehrling nur als billige Arbeitskraft gesehen und ausgenutzt. Durch diese falsche Behandlung des Jugendlichen wird diesem die Berufsfreude genommen.
Die falsche Berufswahl zieht kurz gesagt folgende Wirkungen nach sich, einmal die rasche Abnutzung des Jugendlichen, eine erhöhte Unfallgefahr, berufliche Unzufriedenheit, einen häufigen Berufswechsel, sowie eine Gesundheitsschädigung.
Ein weiteres Problem stellt auch die Kinderarbeit dar, da die Jugendlichen vor der Lehre schon lange Zeit arbeiten mußten und dadurch an einer Lehrstelle nicht interessiert waren. Dies ist auch ein Grund für eine Kündigung und stellt eine wichtige Ursache der Fürsorgebedürftigkeit dar.
Nun wende ich mich dem nächsten Faktor zu, dem Faktor Stadt und Land. Wie schon erwähnt, sind die Lebensbedingung ein wichtiger Bestandteil der Fürsorgebedürftigkeit und so sind die Lebensbereiche Stadt und Land sehr wichtig. Auf dem Land sind die körperlichen Arbeiten sehr gesundheitsschädigend und dadurch werden diese Jugendlichen eher fürsorgebedürftig. In der Stadt dagegen ist die Selbstmordrate erheblich größer, als auf dem Land. Weiterhin ist der Alkoholismus und die Arbeitslosigkeit auch eine wichtige Ursache für die Fürsorge. Auch die Verwahrlosung und Kriminalität ist bei Stadtkindern sehr stak vertreten, es fängt beim Schulschwänzen an und geht über Betteln bis hin zum Diebstahl. Desweiteren sind Stadtkinder wesentlich schneller reif, als Landkinder, sie sind selbständiger, da sie durch die Arbeit der Mutter schon früh auf sich allein gestellt sind. Auch durch diese Punkte werden die Kinder und Jugendlichen fürsorgebedürftig.
Der nächste Faktor auf den ich kurz eingehen werde, ist der Alkoholgenuß bei Kindern und Jugendlichen. Es ist bekannt, daß Kinder und Jugendliche schon im frühen Alter angefangen, Alkohol zu konsumieren und auch dieses führt zur Fürsorgebedürftigkeit, da unter dem Einfluß von Alkohol viele Verbrechen, sowie auch ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfinden, was auch Krankheiten nach sich ziehen kann. Jetzt werde ich noch auf einen Faktor eingehen, auf die sogenannten anderen Faktoren, zu diese zählen die Schule, eine falsche Lebensweise und die Kriegs - sowie Nachkriegszeit. Die Schule kann zu verschiedenen Störungen führen, da die Kinder in einem geschlossenen Raum längere Zeit still sitzen müssen und nur geistig arbeiten. Zu der falschen Lebensweise zählt die unzureichende Ernährung, sowie die Kleidung, die Störungen hervorrufen. Während der Kriegszeit fehlte es an der strengen Erziehung der Väter, da diese eingezogen waren, dadurch fehlte die Achtung vor anderen Menschen. Verbrechen fanden statt, da diese vom Krieg gezeigt wurden und die Jugendlichen dies als ein Vorbild angesehen haben. Dies alles führt zur Fürsorgebedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen.
Abschließend ist zu erwähnen, daß die Ursachen für die Fürsorgebedürftigkeit sehr vielseitig sind und sich nicht an einem Punkt festmachen lassen.
4. Geschichte der öffentlichen Jugendfürsorge
In diesem Punkt meiner Hausarbeit werde ich mich mit der Geschichte der Jugendfürsorge im Zeitraum von Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1924 beschäftigen.
Die Wurzeln der Jugendfürsorge lagen in der Kinder - und Armenfürsorge. Der Rechtsstaat lehnte Eingriffe in die Erziehung der Armenkinder allgemein ab, er griff jedoch in vereinzelten Fällen ein, wenn das Wohl des Kindes stark gefährdet war, da er aufgrund seiner Stellung dazu gezwungen wurde. Die Armenkinder erhielten mit ihren Eltern eine Unterstützung, die sich auf das Notwendigste beschränkte. Waren sie verwaist, wurden sie in Anstalten und Familien untergebracht, so daß die wirtschaftlichen und sozialen Belange gesichert waren. Desweiteren mußte aber auch für die erzieherischen Belange gesorgt werden, aus diesem Grund wurde die allgemeine Volksschulpflicht eingeführt, doch diese stand den Belangen der Eltern und der Industrie gegenüber, da die Kinder immer als billige Arbeitskraft angesehen wurden. Doch der Kinderfürsorge ist ein wichtiges Teilgebiet verloren gegangen, dieses waren die Armenkinder. Die Volksschule bereitete die Kinder auf das Berufsleben vor, doch die Armenkinder waren von dieser Schulform ausgeschlossen. An Stelle der Fürsorge der Armenkinder trat die Form der freien Erziehungsfürsorge. Die Erziehungsfürsorge war eine private Organisation und wurde vom Staat unterstützt.
In Preußen bildeten sich durch den Minister von Altenstein verschiedene Kinderrettungsvereine, die die mißhandelten Kinder in Rettungshäuser brachten und der Aufgabe nachgingen, die Erziehungsanstalten, in denen Kinder mißhandelt wurden, zu schließen. Desweiteren setzte er sich mit den Ursachen der Jugendkriminalität und der Verwahrlosung auseinander und verkündete 1826 die Verordnung zum Schutz der Kinder. Er wies in dieser, auf Maßnahmen hin, wie diese Kinder geschützt werden könnten. Von Altenstein fing damit bei der Ernennung von Vormündern für Waisen und unehelichen Kindern an. Darüber hinaus sorgte er dafür, daß die Kinder, die in schlechten Familienverhältnissen lebten, aus den Familien herausgenommen wurden. Weiterhin setzte er eine strenge Durchführung des Schulzwanges durch und abschließend ließ er die Fabriken stärker kontrollieren, in denen die Kinder arbeiteten. Diese Verordnung führte jedoch zu keiner Verbesserung der Verhältnisse und so war der Staat Mitte des Jahrhunderts gezwungen, verschiedene Schutzvorschriften zu erlassen. Diese hatten aber keine erzieherischen und fürsorglichen Belange, sie schützten nur vor Gewalt. Und so versuchte von Altenstein weiterhin den Schutz der Fabrikkinder durchzusetzen, da die Kinder an Maschinen eingesetzt wurden und dadurch schweren gesundheitlichen und sittlichen Gefahren ausgesetzt waren. Doch die Schutzbestimmung scheiterte erneut, und so versuchte er den ununterbrochenen Schulunterricht für die arbeitenden Kinder zu erzwingen. Desweiteren erwiesen die militärischen Musterungen, daß die Kinderarbeit schwere Gesundheitsschäden hervorrief und so konnte von Altenstein 1839 endlich eine Vorschrift über die Fabrikarbeiten erlassen. Diese Vorschrift beinhaltete, daß Kinder unter neun Jahren keiner gewerblichen Arbeit nachgehen durften, daß die Nacht - und Sonntagsarbeit für die neun bis zwölfjährigen verboten wurde und das die Arbeitszeit zuerst auf zwölf Stunden und später auf zehn Stunden beschränkt wurde. Weiterhin durften Kinder im Schulalter nur beschäftigt werden, wenn sie mindestens drei Jahre der Schulpflicht nachgegangen waren, dieses bildete die Grundlage des Arbeitsschutzes für die Kinder und Jugendlichen. Dieses konnte jedoch nur sehr langsam durchgesetzt werden, da die Industrie Widerstand leistete. Zunächst war das Gesetz des Arbeitsschutzes von der Polizei zu überprüfen, sie hatte die Aufgabe alle Betriebe zu kontrollieren, später übernahm dieses aber der Frauenverein.
Ein weiterer Kindernotstand waren die Pflegekinder, für diese war auch ein polizeiliches Eingreifen notwendig, da die meisten keinen Vormund hatten. Meistens waren es uneheliche Kinder, die oft in den ersten Lebenswochen von ihren Müttern gegen eine Abfindungssumme in Pflegestellen gegeben worden waren und starben, da es arme Pflegestelle waren und die Kinder in ihnen nicht ordnungsgemäß gepflegt werden konnten. 1840 wurde in Preußen die "polizeiliche Pflegestellenerlaubnis und - beaufsichtigung eingeführt" (Scherpner 1966, S.159). Kinder, die jünger als vier Jahre alt waren, durften nur durch eine polizeiliche Genehmigung abgegeben werden, dieses wurde später auch vom Frauenverein übernommen. Weiterhin gab es für die Entwicklung der Kinder - und Jugendfürsorge einen weiteren Ansatz. In Leipzig wurden 1825 Ziehkinderanstalten für uneheliche Ziehkinder errichtet. Diese Organisation war auch mit der Armenpflege verknüpft. Durch diese Institution wurde der Pflegekinderschutz zu einer fürsorglichen Maßnahme, sie sollte nicht nur Schäden der Kinder verhindern, sondern auch deren Situation positiv verändern. Dieses war eine freiwillige Berufsaufsicht und reichte nicht aus. Dadurch wurde 1858 ein Ziehkinderarzt und eine Pflegerin eingestellt, die die Wohnungs - sowie Pflegeverhältnisse zu kontrollieren hatten und die Mißstände der Polizei melden mußten.
1878 wurde in Hessen das Gesetz zum Schutz der Pflegekinder erlassen, dieses beinhaltete eine Anmeldepflicht für die Kinder die in Kost gegeben wurden. Durch dieses Gesetz wollte man frühzeitig die Pflegekinder erfassen, so daß man sie später besser überwachen konnte. Der Pflegekinderschutz war in unzählige Polizeiverordnungen aufgeteilt und stellte nur eine allgemeine Richtlinie dar, doch die polizeilichen Maßnahmen durften in die elterlichen Rechte nicht eingreifen.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandte man sich der schutzbedürftigen Jugend zu, den kriminellen und verwahrlosten. 1794 wurden die Kinder aus dem Strafrecht herausgenommen und der Kinderfürsorge im Rahmen der Armenpflege überlassen. Dieser Weg wurde im 19. Jahrhundert aufgegeben. Dagegen gab es starke Angriffe gegen den Ansatz der gemeinsamen Unterbringung der straffälligen Jugendlichen und Erwachsenen. Durch diese Angriffe wurden Besserungsanstalten für Jugendliche, sowie Jugendabteilungen in schon bestehenden Strafanstalten errichtet. Auch hier setzte sich von Altenstein für eine erzieherische Behandlung der Jugendlichen ein, so daß in Preußen Lehr - und Unterrichtsanstalten für die straffälligen Jugendlichen errichtet wurden. Beim Justizministerium setzte er sich für eine Nacherziehung vorbestrafter Jugendlicher ein. Er wies auch auf die Unzweckmäßigkeit von Geldstrafen und kurzfristigen Gefängnisstrafen hin, sowie auf die schädliche Wirkung zu harter und zu langer Strafen.
1851 wurde der Begriff der erforderlichen Einsicht im Strafgesetzbuch aufgenommen und von dort ging er 1871 in das Reichsstrafgesetzbuch ein. Unter diesem Begriff wurde verstanden, daß "Personen unter sechzehn Jahren, die "sans discernement", also ohne die erforderliche Einsicht- wie es später im deutschen Strafrecht formuliert wurde - eine Straftat begangen hatten, konnten freigesprochen werden, doch konnte das Gericht ihre Unterbringung in eine Besserungsanstalt, bis höchstens zum zwanzigsten Lebensjahr, anordnen" (Scherpner 1966, S.161). Doch es gab noch einen weiteren Fortschritt in dem RSTGB und zwar die Strafmündigkeitsgrenze, diese besagte, daß Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr nicht strafmündig waren, dieses bedeutete, daß diese Kinder trotz eines Vergehens nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten, da ihnen die erforderliche Einsicht fehlte. Bei den zwölf bis achtzehnjährigen, die nur bedingt strafmündig waren, mußte erst geprüft werden, ob diese die nötige Einsicht besaßen, fehlte die Einsicht wurden sie freigesprochen, sie konnten nur in eine Besserungsanstalt eingewiesen werden. Desweiteren wurde diejenigen, die bedingt strafmündig waren, die also auch die erforderliche Einsicht hatten, wesentlich milder bestraft, als ein erwachsener Straftäter. Doch in dieser Fassung des RSTGB blieb die Frage unbeantwortet "was mit denjenigen strafunmündigen Kindern geschehen sollte, die sich erhebliche Straftaten zuschulden kommen lassen, oder mit den bedingt Strafmündigen, denen die notwendige Einsicht gefehlt hatte." (Scherpner 1966, S.162). Diese Lücke im RSTGB wurde in verschiedenen Bundesstaaten, durch verschiedene Reformen geschlossen. In Süddeutschland durch das Polizeistrafgesetz, in den sächsischen Ländern durch das Volksschulgesetz. Durch diese Uneinheitlichkeit der verschiedenen Staaten wurde das RSTGB 1876 durch die Zwangserziehung §55 ergänzt. Kinder unter zwölf Jahren konnten durch diese Ergänzung in Erziehungs - und Besserungsanstalten eingewiesen werden.
In Preußen wurden Erziehungs - und Zwangserziehungsbehörden errichtet. Sie befaßten sich mit den erzieherischen und organisatorischen Aufgaben der Zwangserziehung, diese waren für die strafunmündigen Jugendlichen. Die Zwangserziehung für die zwölf bis sechzehnjährigen, bei denen es an der Einsicht mangelte, wurden in eigene Zwangserziehungsanstalten eingeliefert, die den Strafvollzugsbehörden unterstanden. Das Neue an dieser Entwicklung war, daß die Unterbringung in die Erziehungsanstalten, in die Hand des Vormundschaftsgerichtes gelegt wurde. So setzte sich das Gebiet der Jugendfürsorge langsam durch, genauso auch die Erziehung der gefährdeten und verwahrlosten Jugendlichen.
Am 1.1.1900 trat das BGB in Kraft, wodurch es zu Rückschritten kam, da das Elternrecht als ein selbständiges Recht angesehen wurde und Eingriffe seitens des Staates, sofern sie bei der Gefährdung von Kindern und Jugendlichen notwendig waren, nur auf das Notwendigste minimiert wurden. Das Eingreifen in die elterliche Gewalt war nur bei einem nachweisbaren schuldhaften Verhalten der Eltern gegenüber dem Kind nach dem §1666 des BGB´s gestattet. Durch die Einführung des BGB`s wurde der Begriff der Zwangserziehung abgeschafft und der Begriff der Jugendfürsorge eingeführt. Die Fürsorgeerziehung konnte in verschiedenen Bereichen angeordnet werden, sobald das Kind eine Straftat begangen hat, wenn man den Eltern ein schuldhaftes Verhalten nachweisen konnte und sie mußte eingreifen, sobald eine objektive Verwahrlosung vorlag.
Die Fürsorgeerziehung wurde von Land zu Land auf verschiedene Behörden übertragen, in Preußen wurde sie den Provinzen als kommunale Selbstverwaltungskörperschaften übertragen, dieses waren große Verbände mit Verwaltungserfahrung. Die kleinen Städte, die Kreisstädte, sowie die finanzschwachen Gemeinden stellten keine Anträge auf Fürsorgeerziehung, da sie den finanziellen Belastungen nicht gewachsen waren, sie konnten sich dieses nicht leisten.
Im nächsten Punkt meiner Hausarbeit werde ich auf die Reformbestrebungen der Jugendfürsorge eingehen, um die Geschichte zu vervollständigen.
5. Die Reformbestrebung
Im folgenden werde ich die Reformbestrebung in der deutschen Jugendfürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts an erläutern.
Die Reformbestrebung ging dahin, daß die Gesetze, die Lücken aufwiesen, durch neue Reformen bzw. Verordnungen vervollständigt wurden. Es wurden verschiedene Vereine und Organisationen gebildet, in Frankreich waren es beispielsweise Krippen, in Deutschland verbreiteten sich diese Einrichtungen jedoch nicht, da die Sterblichkeit der Säuglinge durch künstliche Ernährung sehr groß waren. In Deutschland errichtete man sogenannte Stillstuben, um die Säuglingssterblichkeit zu verringern. Die Stillstuben waren so aufgebaut, daß Mütter für das Stillen der Kinder Prämien erhielten, so daß die Säuglingssterblichkeit zurückging, da sie in dieser Zeit nicht arbeiten mußten. Weiterhin wurden Schulkinderfürsorgen errichtet, deren Aufgabe bestand in der Überwachung des Gesundheitszustandes des Kindes durch Schulärzte, sowie die Überwachung der hygienischen Zustände in den Schulen. Aus dieser Fürsorge entwickelte sich in allen Schulzweigen die Erholungsfürsorge für Schulkinder.
Dieser schnelle Aufbau der Fürsorgestellen für die Unterschicht wäre nicht möglich gewesen, wenn sich nicht zeitgleich Sozialversicherungen entwickelt hätten. Auch die Krankenversicherung wurde in dieser Zeit ausgebaut und die Mutterschutzvorschrift entstand. Diese vielseitige Gesundheitsfürsorge war eine freiwillige Leistung der Kommunen, besonders in den Großstädten, wo sich die Einwohnerzahl sehr schnell steigerte, breitete sich die Wohnungsnot und das Kinderelend aus. Um diese Menschen zu schützen, ist die Gesundheitsfürsorge wichtig.
Für die Jugendfürsorge ist die Berufsvormundschaft ein bedeutsames Gebiet, diese betraf die verwaisten und unehelichen Kinder. Aus dieser Berufsvormundschaft entwickelte sich die Einzelvormundschaft. Diese Einzelvormundschaft stellte jedem einzelnem Kind einen persönlichen Vormund, sie war immer eine soziale und gesellschaftliche Institution, da sie die Erziehung und Versorgung selbst übernommen hatte, später wurde sie jedoch eine Rechtsinstitution. Diese Rechtsinstitution übernahm nur noch die rechtlichen Befugnisse der Eltern und übergab die anderen Bereichen, wie z.B. die persönliche Sorge den Pflegefamilien und Anstalten. Weiterhin entwickelte sich die Anstaltsvormundschaft, die sich nur in vereinzelten Städten ausbreitete, diese hatte zum Inhalt, daß verwaiste Kinder im Waisenhaus unter der Vormundschaft der Einrichtung standen. Diese Institutionen gingen jedoch nicht nur der Vormundschaft nach, sondern auch den polizeilichen Rechten des Kindes.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde immer mehr auf diese Anstaltsvormundschaften zurückgegriffen, da man feststellte, daß die Einzelvormundschaft bei den unehelichen Kindern nicht wirkte. In vielen Fällen wurde der Mutter oder dem Vater des unehelichen Kindes die Vormundschaft übertragen, nur konnten die meisten Mütter bzw. Väter dieser Aufgabe der Vormundschaft nicht nachkommen. Meistens kamen sie aus den unteren Schichten, sie mußten arbeiten und verdienten nicht genug Geld, um das Kind ordnungsgemäß zu versorgen und zu pflegen, oft reichte das Geld nicht für die Ernährung und angemessene Kleidung.
Der Arzt Dr. Taube gründete 1886 die Generalvormundschaft für uneheliche Kinder in Leipzig. Um 1900 waren alle unehelichen Kinder aus Leipzig, egal ob sie sich in Pflege oder bei der Mutter befanden, von der Geburt bis zur Schulentlassung der Generalvormundschaft unterstellt. Dieses Taubsche System war also ein Vorläufer der Amtsvormundschaft des Jugendamtes, welches für uneheliche Kinder zuständig war.
Desweiteren führte dieses System 1924 das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ein. Durch dieses System und Reichsjugendwohlfahrtsgesetz verbesserte sich die soziale und wirtschaftliche Lage der Mütter sehr, da sich die Generalvormundschaft direkt nach der Geburt um die Rechte des unehelichen Kindes gegen den Erzeuger kümmerte. Mit der Einführung des BGB`s drohte der Entwicklung der Vormundschaft ein großer Rückschlag, da die Schöpfer des BGB`s nicht die Bedeutung der Jugendfürsorge erkannten und nur noch die Einzelvormundschaft bewilligten, obwohl die Berufsvormundschaft große Erfolge gezeigt hatte. Nach langen Kämpfen erreichte Taube und die Vertreter der Städte, die Leipzig gefolgt waren, daß ähnlich wie bei der Fürsorgeerziehung ein Kompromiß geschlossen wurde. Dieser Kompromiß wurde im BGB Art.136 festgelegt und besagte, daß "es der Landesgesetzgebung überlassen, neben, die auf Grund des BGB bestehende Form der ehrenamtlichen Einzelvormundschaft unter bestimmten Voraussetzungen der Berufsvormundschaft zu stellen" (Scherpner 1966, S.172), das heißt, die Entscheidung lag bei den Ländern. Dieses konnte von einem Beamten und von "einer unter staatlicher Verwaltung oder Aufsicht stehenden Erziehungs - oder Verpflegungsanstalt" (Scherpner 1966, S.172) ausgeübt werden. Desweiteren galt die Berufsvormundschaft bis zur Volljährigkeit, jedoch konnte diese durch das Vormundschaftsgericht beendet werden und anstelle dieser trat im Interesse des Minderjährigen eine Einzelvormundschaft in Kraft. Daran ist zu erkennen, daß um die Jahrhundertwende neue Entwicklungen auf Einzelgebieten der Fürsoge entstanden sind.
Aufgrund der starken sozialen Spannungen, sowie durch den wirtschaftlichen Aufschwung, wurde das Interesse der Öffentlichkeit an der Not der gefährdeten Jugendlichen geweckt, so daß der Staat und die Kommunen ihre Bemühungen steigerten. Das Ergebnis dieser Steigerung war jedoch, daß sich das Gebiet der Fürsorge auf verschiedene Behörden zersplitterte. Diese Behörden waren die Polizei, die Gewerbeaufsicht, die Pflegekinderaufsichtsbehörde, die Armen - und Waisenämter, die Ortsbehörde, das Gesundheitsamt, das Vormundschaftsgericht und das Strafgericht. Diese arbeiteten jedoch alle mit bzw. nebeneinander her.
Um gegen diese Zersplitterung der Jugendfürsorge anzugehen, setzte sich 1900 die Reformbewegung ein, diese trug der Überzeugung bei, daß Jugendfürsorge eine Form der Erziehung ist. Desweiteren läßt sich diese in zwei Bereiche unterteilen, zum einen sollte die Armenfürsorge durch eine Reform neu geregelt werden und als ein eigenständiges Gebiet der Fürsorge anerkannt werden. Die armenpflegerischen Aufgaben sollten auf größere Verbände übertragen werden, dadurch erhoffte man sich, die Mißstände auf dem Land zu eliminieren, da sie sich den Verpflichtungen aus dem Unterstützungswohnsitzgesetz von 1870 entzogen und die Waisen, die unehelichen Kinder, sowie die Kostkinder keinem Vormund unterlagen, waren sie der Abschiebung ausgesetzt. Zum anderen sollte eine soziale Ausgestaltung der Fürsorge ein höheres Niveau der Kinderarmenpflege sicherstellen, dieses sollte durch die Berufsvormundschaft erreicht werden. Die Armenpflege der Minderjährigen sollte dagegen von den Armenämtern gelöst werden. Durch diese Umstrukturierung wuchs "die Idee einer selbständigen örtlichen Behörde, die die gesamte Jugendfürsorge in allen ihren Zweigen unter dem Gesichtspunkt der Erziehung zusammenfaßte" (Scherpner 1966, S.173).
Durch die von Taube entwickelte Berufsvormundschaft sah man den Kernpunkt der Jugendfürsorge. Klumker war einer der Vertreter und trieb die Weiterentwicklung dieser Idee schnell voran. Zuerst spürte er die Aufgabe und Arbeitsmethoden der praktischen sozialen Arbeit auf und vertiefte seine Erkenntnisse dieser sozialen Zusammenhänge. Danach ordnete er zuerst die Einzelaktionen der privaten Wohltätigkeit der Stadt. Weiterhin gründete er einen Verein, um besser und schneller forschen zu können und so wurde er darauf aufmerksam, daß uneheliche Kinder, sowie deren Mütter in einer Notlage waren. Aufgrund dessen ließ er sich als Vorsitzender des Vereins von Fall zu Fall als Vormund dieser Kinder ernennen und so wurde dieser Verein zum Träger der Berufsvormundschaft. Durch diese Übernahme der Berufsvormundschaft hatte er alle rechtlichen Grundlagen für die Erziehung der Minderjährigen. Weiterhin übernahm ein Arzt die Auswahl der Pflegestellen und die Beaufsichtigung der Minderjährigen, auch wenn sie in der Familie lebten. Der Arzt wurde von ehrenamtlichen und später von beruflichen Helfer/innen unterstützt, die in speziellen Kursen auf das Gebiet der Fürsorge geschult worden waren. Mit dieser wachsenden Zahl der Vormundschaften wurde die Vertretung der Rechtsansprüche der unehelichen Kinder ausgestaltet, jedoch war die rechtliche Funktion für Klumker "nur die kleinere nebensächliche Seite der Sache" (Scherpner 1966, S.174), für ihn stand vielmehr im Mittelpunkt, die fehlende Elternsorge zu ersetzen. Durch die Erfolge, die diese Vereinsvormundschaft erzielte, wurden dem Verein auch Vormundschaften und Pflegschaften bei gefährdeten Kindern übertragen, somit wurden dem Verein auch schwierigere Erziehungsaufgaben zugeteilt. Bei manchen Jugendlichen war es notwendig, sie einige Zeit zu beobachten, um die weitere Erziehung leiten zu können. Für diese Beobachtungen wurde ein sogenanntes Beobachtungsheim in Verbindung mit einer Lehr - und Arbeitskolonie für Schwachbegabte errichtet, für seelisch gestörte Kinder wurde in einer Irrenanstalt eine Beobachtungsabteilung geschaffen. Nach diesem Vorbild ernannten sich verschiedene Vereine, wie z.B. 1904 der Berliner Kinderrettungsverein. Dieser und all die anderen Vereine, die sich entwickelten, stellten eine Vorstufe zur späteren behördlichen Jugendfürsorge dar. 1906 wurden Auskunfts - und Beratungsstellen errichtet, die in Rechtsfällen eingriffen, weiterhin erweiterten sie das Fachwissen der Mitglieder durch Veröffentlichung und Schulungskursen.
In der Zwischenzeit haben einige Städte schon den Versuch unternommen, alle Zweige der Jugendfürsorge miteinander zu verbinden. Für die städtischen Pflegekinder schlossen sich die Pflegekinderaufsichten, der Gemeindewaisenrat und die Armenpflege für Kinder zusammen. 1909 gelang es Dr. Petersen, dem Direktor eines Waisenhauses aus Hamburg, durch seine Mitwirkung bei der Landesgesetzgebung die gesamte Jugendfürsorge und die Leitung der öffentlichen Waisen und Erziehungsanstalten in eine Behörde zusammenzuschließen. So grenzte sich die Jugendfürsorge langsam von der öffentlichen Fürsorge ab. Nur auf dem Gebiet der privaten Fürsorge herrschte noch immer ein Nebeneinander, sowie ein Gegeneinander arbeiten. Neben den Vereinen, die auf örtlicher Basis tätig waren und sich nur mit bestimmten Notständen befaßten, gab es noch Vereine, die für größere Bezirke tätig waren und sich mit jedem Notstand befaßten.
1910 wurde die Abgrenzung zwischen der privaten und der öffentlichen Fürsorge, auf der Königsberger Tagung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit diskutiert. Es wurde die Forderung nach einem Jugendamt erhoben und diskutiert. Das Jugendamt sollte eine Behörde sein, die die örtliche Jugendfürsorge zusammenschloß und eine Verbindung mit den privaten Bestrebungen herstellte. Die Verwirklichung dieser Behörde zeigte große Schwierigkeiten auf, da die einzelnen Zweige der Jugendfürsorge auf verschiedene Rechtsgrundlagen beruhten, jedoch war an einer Änderung des BGB´s zu denken.
In diesen Jahren wurde die erzieherische Aufgabe der Jugendfürsorge von immer weiteren Kreisen angesehen und so versuchte man die strafrichterlichen Behandlungen der Jugendlichen einzuschränken, da es noch immer sehr eng mit dem Strafjustiz der Erwachsenen verbunden war.
Frankfurt a.M. und Köln errichteten die ersten Jugendgerichte, in diesen wurden einem Richter die Strafsachen für die zwölf bis achtzehnjährigen Jugendlichen übertragen. Er hatte die Möglichkeit, erzieherisch auf den jugendlichen Rechtsbrecher einzuwirken. Der Strafvollzug an Jugendlichen wurde völlig von dem der Erwachsenen getrennt, es wurden Jugendgefängnisse errichtet. 1923 erhielt dieser Zweig der Jugendfürsorge eine gesetzlich verankerte Organisation. Der Fortschritt der Medizin, Psychiatrie und Psychologie brachte der Jugendfürsorge eine Differenzierung der Einrichtungen, genauso wurden neue pädagogische Erziehungsmethoden entwickelt.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges brachte alle Bestrebungen der Neuordnung der Jugendfürsorge zum Zusammenbruch, jedoch erzielten die ersten Kriegstage auf einem Gebiet der Jugendfürsorge Erfolge. Die unehelichen Kindern, deren Väter eingezogen wurden, bekamen durch die Kriegsunterstützung vom Reichstag. Die Armenpflege führte zu einer weiteren Zersplitterung der Kinder - und Jugendfürsorge, denn die Kriegswaisen wurden neu geschaffenen Behörden übertragen. Desweiteren wurde durch den Krieg die Neuordnung der Grundlagen der Jugendfürsorge eingeführt, da das Interesse an einer gesunden Jugend immer stärker wurde.
Am Jugendfürsorgetag 1918 trafen sich die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege, sowie das Archiv Deutscher Berufsvormünder. Sie forderten einstimmig das Reichsjugendamtsgesetz. Aber erst durch die Weimarer Verfassung wurde das Gesetz erlassen, so daß die gesamte Jugendfürsorge der rechtsgesetzlichen Regelung unterlag. Nur durch die Ablegung der Aufgaben der Jugendpflege tauchte die Forderung eines gesamten Jugendrechtes in einem einheitlichen Gesetz auf und im Juli 1922 wurde nach jahrelanger Verhandlung das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz erlassen, doch aufgrund der schwierigen Finanzlage wurde es erst am 1.4.1924 in Kraft gesetzt.
6. Die Institution das Jugendamt
Um die Jahrhundertwende entstanden zahlreiche Vereine und Dachverbände, die sich mit der Jugendfürsorge beschäftigten. Zu den Vereinen bildeten sich zusätzliche Organisationen, in denen die Bestrebungen zusammengefaßt wurden. Diese waren Informationsstellen, richteten Kongresse aus und verbreiteten Zeitschriften, Sammelwerke und Einzelpublikationen, in denen sie über die Jugendfürsorge berichteten. Einige Beispiele dafür sind das Archiv deutscher Berufsvormünder, das die Verbreitung professioneller Vormundschaften von Amtswegen betrieb und die Centrale für private Fürsorge in Frankfurt, eine Gründung des sozial engagierten Metallindustriellen Wilhelm Merton.
Die vereinzelten Organisationen arbeiteten zusammen und standen trotzdem in Konkurrenz zueinander. Desweiteren gab es viele personelle Überschneidungen auf dem Gebiet der Aktivitäten und der Kommunikation in der Fachöffentlichkeit. Diese Organisationen forderten zwei sogenannte Trends, zum einen die Vereinheitlichung und Koordination, und zum anderen die Professionalität der Jugendarbeiter. Unter Vereinheitlichung verstand man, daß alle Vereine, Verbände, sowie alle Organisationen nach den gleichen Grundsätzen arbeiteten, doch diese Grundsätze kamen auf keinen gemeinsamen Nenner durch die Selbständigkeit der einzelnen Institutionen. Unter der Professionalität der Jugendarbeiter verstand man, daß diese dementsprechend geschult wurden, das heißt entsprechend ihrem Einsatzgebiet: Anstalten, Fürsorgevereine und Behörden. Als Abschluß dieser Entwicklung wurde an der Frankfurter Universität ein Lehrstuhl unter Christian Jasper Klumker eingerichtet, der von Wilhelm Merton gefördert wurde. Durch ständige Fortbildungsmaßnahmen in den mittleren Ebenen und dementsprechender Literatur förderte man die sozialpädagogischen Institutionen.
Diese beiden Trends fanden sich später in der Institution "Jugendamt" wieder. Gegen Ende der Vorkriegszeit wurden in vielen Gemeinden die zuständigen Behörden sowie Vereine und Verbände zu Kollegialorganen zusammengefaßt, maßgebend für diese Art der Organisationen war das 1910 in Hamburg von Johannes Petersen gegründete Jugendamt.
Das Jugendamt stellte das bis dahin fehlende Glied zwischen Tätigkeiten der freien Fürsorgeverbände - und vereine und den Aktivitäten der Behörden dar.
7. Fazit
Zum Schluß meiner Hausarbeit stelle ich fest, daß die Jugendfürsorge ihre Anfänge sehr viel früher hatte, als ich es vor Beginn meiner Hausarbeit erwartet hatte. Ich war überrascht, welche Höhen und Tiefen die Jugendfürsorge durchlaufen mußte, bevor aus ihr die Institution "Jugendamt" wurde. Der Weg zum Jugendamt war durch viele Rückschritte und Veränderungen geprägt.
Weiterhin überraschte mich, daß die Aufgabe des Staates durch Vereine bzw. von einzelnen Personen übernommen worden ist und sich so überhaupt um die bedürftigen Jugendlichen gekümmert wurde. Es war bemerkenswert, daß es damals schon vereinzelte Personen gab, die das Problem der Fürsorgebedürftigkeit bei Jugendlichen erkannt haben und das Problem schrittweise angegangen sind. Sie waren in meinen Augen die eigentlichen Gründer der Jugendfürsorge und damit letztendlich des Jugendamtes. Desweiteren mußte ich erkennen, daß die Wurzeln der Jugendfürsorge in der Bedürftigkeit der Kinder lag, dies spiegelte sich sehr deutlich in den Ursachen der Jugendfürsorge wider.
Zu Beginn meiner Hausarbeit habe ich die Vielseitigkeit des Themas "Jugendfürsorge" als nicht so groß eingeschätzt. Es werden dort sehr viele Hintergründe angesprochen, die ich zuerst nicht im direkten Zusammenhang mit dem Thema gesehen habe, zum Beispiel vereinzelte Ursachen.
8. Literaturverzeichnis
- Gräser, M. Der blockierte Wohlfahrtsstaat: Unterschichtjugend und Jugendfürsorge in der Weimarer Republik. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1995
- Hering, S. & Münchmeier. Geschichte der Sozialem Arbeit. Eine Einführung. Juventa Verlag, Weinheim und München, 2000
- Klumker, J. Fortschritte der Jugendfürsorge. Hermann Beyer und Söhne, 1924
- Scherpner, H. Geschichte der Jugendfürsorge. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1966
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument zur Jugendfürsorge?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachevorschau zum Thema Jugendfürsorge. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Beschreibungen der Ursachen für Fürsorgebedürftigkeit, die Geschichte der Jugendfürsorge, Reformbestrebungen, die Institution Jugendamt und ein Fazit.
Was sind die Hauptthemen, die in dem Dokument behandelt werden?
Die Hauptthemen sind: der Begriff der Jugendfürsorge, innere und äußere Ursachen von Fürsorgebedürftigkeit, die Geschichte der öffentlichen Jugendfürsorge, Reformbestrebungen, die Institution Jugendamt, und ein Fazit.
Welche inneren Ursachen für Fürsorgebedürftigkeit werden diskutiert?
Die inneren Ursachen umfassen die Rolle der Vererbung, Keimesschädigung, Störungen während der Schwangerschaft und Geburtsschädigungen.
Welche äußeren Ursachen und Umweltfaktoren werden im Zusammenhang mit Fürsorgebedürftigkeit genannt?
Die äußeren Ursachen und Umweltfaktoren werden in naturale Umwelt (Wetter, Klima, Bodenbeschaffenheit, Landschaft), menschliche Umwelt (Familie, Versagen des Elternhauses, uneheliche Kinder, Verwaisung) und kulturelle Umwelt (gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren wie Armut, Wohnungselend, Beruf und Arbeit, Stadt und Land, Alkoholgenuß des Kindes, Schundliteratur und Kino) unterteilt.
Was wird über die Geschichte der öffentlichen Jugendfürsorge gesagt?
Die Geschichte wird vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1924 betrachtet. Die Wurzeln liegen in der Kinder- und Armenfürsorge. Es werden die Rolle von Minister von Altenstein, die Einführung der Schulpflicht, der Schutz der Fabrikkinder und die polizeiliche Pflegestellenerlaubnis und -beaufsichtigung thematisiert. Auch die Entwicklung des Strafrechts für Jugendliche und das Inkrafttreten des BGB werden behandelt.
Was sind die Reformbestrebungen im Bereich der Jugendfürsorge?
Die Reformbestrebungen zielen auf die Vervollständigung der Gesetze, die Schaffung von Fürsorgestellen (z.B. Stillstuben), die Einführung der Schulkinderfürsorge und die Entwicklung der Berufsvormundschaft. Es werden die Rolle von Dr. Taube und Klumker, die Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes und die Diskussionen über die Abgrenzung zwischen privater und öffentlicher Fürsorge behandelt.
Wie wird die Institution "Jugendamt" beschrieben?
Die Entstehung des Jugendamtes wird als Ergebnis der Bemühungen um Vereinheitlichung, Koordination und Professionalität in der Jugendfürsorge dargestellt. Das Jugendamt soll das fehlende Glied zwischen der freien Fürsorge und den Aktivitäten der Behörden darstellen. Es werden Kollegialorgane genannt, die zur Zeit des Krieges gegründet wurden, und sich der Not der Waisenkinder annahmen.
Welche Bücher dienten als Grundlage für die Hausarbeit?
Die Bücher "Die Geschichte der Jugendfürsorge" von H. Scherpner, "Der blockierte Wohlfahrtsstaat: Unterschichtjugend und Jugendfürsorge in der Weimarer Republik" von M. Gräser, "Jugendfürsorge" von E. Stern und "Die Fortschritte der Jugendfürsorge" von J. Klumker haben als Grundlage der Hausarbeit gedient.
- Quote paper
- Tanja Mende (Author), 2001, Jugendfürsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104385