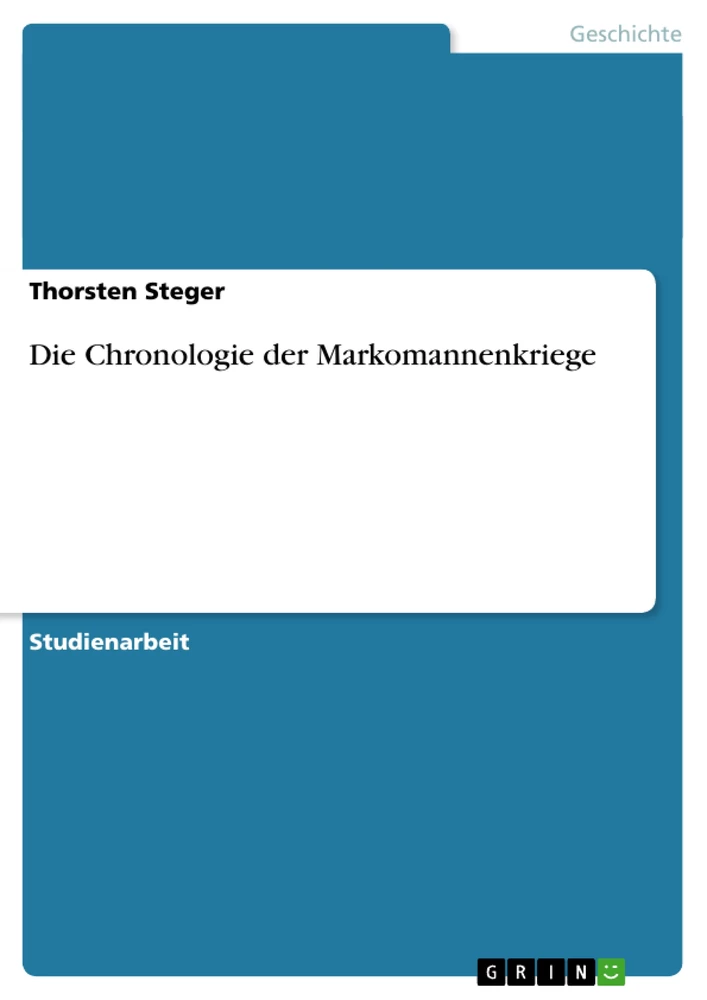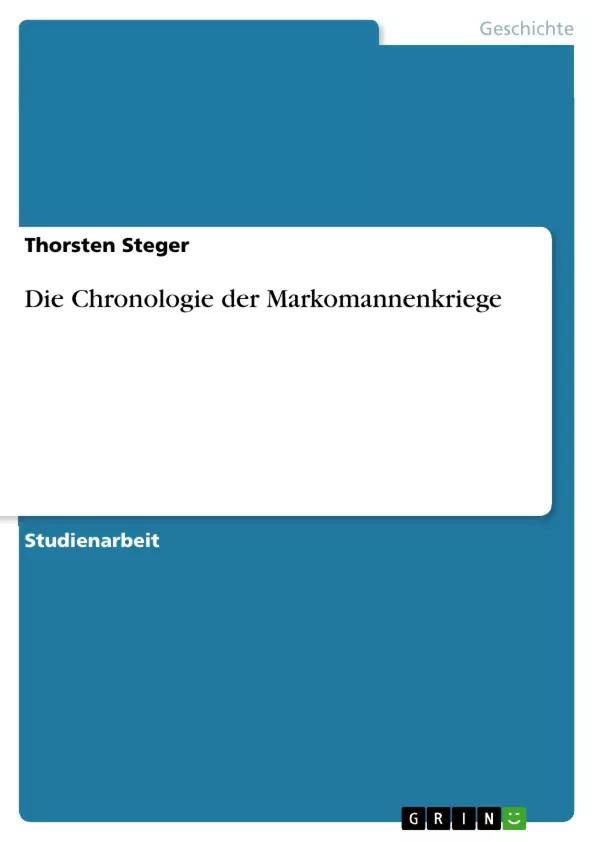Wie lassen sich die Schleier der Vergangenheit lüften, wenn die Quellenlage spärlich undInterpretationsspielräume allgegenwärtig sind? Diese Frage steht im Zentrum dieser Untersuchung der Markomannenkriege, einer Epoche, die Historiker seit jeher vor Herausforderungen stellt. Anhand zweier exemplarischer Fallstudien – der verheerenden Invasion Italiens und des legendären Regenwunders – werden die komplexen Methoden der Quellendeutung und die daraus resultierenden, oft widersprüchlichen Chronologien beleuchtet. Die Analyse stützt sich auf ein breites Spektrum an historischen Zeugnissen, von den fragmentarischen Überlieferungen des Cassius Dio über die bildgewaltigen Szenen der Markussäule bis hin zu numismatischen Erkenntnissen, die neue Perspektiven auf die Ereignisse eröffnen. Dabei werden nicht nur die Aussagen der einzelnen Quellen kritisch hinterfragt, sondern auch die verschiedenen Forschungsansätze und ihre jeweiligen Schwächen und Stärken detailliert dargestellt. War der Einfall in Italien tatsächlich eine Folge des verheerenden Löwenopfers, wie Lukian berichtet, oder doch ein späteres Ereignis? Und wie lässt sich das viel diskutierte Regenwunder in den zeitlichen Kontext der Markomannenkriege einordnen, wenn die Datierung der Markussäule selbst umstritten ist? Die Untersuchung zeigt, dass eine Synthese der verschiedenen Quellen und Disziplinen unerlässlich ist, um ein möglichst vollständiges und wissenschaftlich fundiertes Bild der Ereignisse zu erhalten. Doch auch dann bleiben Fragen offen, und die Notwendigkeit weiterer Forschungsergebnisse wird deutlich. Tauchen Sie ein in die spannende Welt der römischen Geschichte und begleiten Sie uns auf der Suche nach Antworten auf die ungelösten Rätsel der Markomannenkriege. Entdecken Sie, wie die sorgfältige Analyse von Münzen, Inschriften und literarischen Zeugnissen dazu beitragen kann, die Vergangenheit neu zu beleuchten und scheinbar feststehende Tatsachen zu hinterfragen. Erfahren Sie mehr über die militärischen Strategien des Marcus Aurelius, die politischen Intrigen am Hofe und die religiösen Vorstellungen der Zeit. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Interpretationen der Quellen überraschen und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil über die Chronologie und den Verlauf dieser entscheidenden Epoche der römischen Geschichte. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand, sondern regt auch zu weiterführenden Überlegungen und Diskussionen an.
Inhaltsverzeichnis
1. Markomannenkriege: Ein vieldiskutiertes Problem mit mehreren Lösungsansätzen
2. Die Quellen und ihr Aussagewert
2.1 schriftliche Quellen
2.2 Die Markussäule
2.3 Bedeutung der Synthese der Quellen
3. Fallbeispiel „Invasion Italiens“
3.1 Aussagen der Quellen
3.2 Interpretation der schriftlichen Quellen
3.3 Eine rein numismatische Analyse nach W. Scheidel
3.3.1 Die Münzemissionen der Jahre 170/171
3.3.2 Bedeutung der Münzemissionen und die Verbindung mit den schriftlichen Quellen
3.4 A. Garzettis Ansatz: eine echte Alternative?
3.4.1 Der Einrichtungszeitpunkt der praetentura als Hauptargument
3.5 Weitere Lösungsansätze
3.6 Ausschließbarkeit anderer Ansätze
4. Fallbeispiel „Regenwunder“
4.1 Aussagen der Quellen
4.1.1 schriftliche Quellen
4.1.2 Die Markussäule
4.2 Datierung nach schriftlichen Quellen
4.3 Scheinbarer Widerspruch der Säule und Folge der Notwendigkeit der Datierung der Säule
4.4. Analyse des Bilderfrieses
4.4.1 Klärung der Darstellungsordnung
4.4.2 Datierung der Säule
4.4.2.1 Nichtdarstellung des Commodus
4.4.2.2 Die Funktion der Victoria
4.4.2.3 Der Anfang des Frieses: ein Problem? 12
4.4.3 anachronische Darstellung des Regenwunders
4.5 Dio: ein echter Beweis
4.6 Ergebnisse der Säulendatierung und Folge für das Regenwunder
5. Notwendigkeit weiterer Forschungsergebnisse
Die Chronologie der Markomannenkriege:
verschiedene Ansätze der Quellendeutung anhand der Beispiele „Invasion Italiens“ und „das Regenwunder“
1. Bereits mehrere Historiker haben zur Problematik der Markomannenkriege Abhandlungen verfaßt, die sich angesichts der spärlichen, unzuverlässigen und schwer zu deutenden Quellen widersprechen, sich gegenseitig widerlegen und somit ein vielfältiges Spektrum bieten, aus dem herauszulesen sein wird, wie die geschichtlichen Ereignisse tatsächlich ihren Verlauf nahmen. Die vielen verschiedenen Thesen, die zur chronologischen Abfolge der Markomannenkriege bereits existieren, zeigen, daß immer noch Uneinigkeit in der Wissenschaft herrscht, wie nun genau mit den vorhandenen Quellen umzugehen ist und inwieweit sie sich überhaupt für eine exakte Analyse eignen. 2. Hauptsächlich beschränkt sich dabei die Auswahl auf 3 Quellen, die fragmentarischen Überlieferungen des Werkes von Cassius Dio, den beiden Historiae Augustae (HA) über Marcus Aurelius und Lucius Verus, welche für die beiden vorliegenden Fälle wohl eine her untergeordnete Rolle spielt, sowie der Markussäule auf der Piazza Colonna in Rom.
Weiterhin stehen Münzen, Inschriften, Urkunden sowie Anmerkungen einiger anderer historischer Persönlichkeiten in Briefen, Werken, etc. zur Verfügung, an denen die überlieferten Ereignisse festgemacht werden.
2.1 Die schriftlichen Quellen sind aufgrund ihrer oftmals fehlenden Data nur schwer auf ein zeitliches Gerüst fixierbar, außerdem bedürfen sie einer kritischen Bewertung hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, Schreibabsichten und den Entstehungsumständen.
So wird Cassius Dio von Martin Hose als ein Historiker beschrieben, der nicht moralisch belehrend wirken, sondern eher machtpolitische Gefüge aufzeigen will. Dio kennzeichne Auslassungen, schlechte Quellen oder nenne die Ziele
seiner Geschichtsschreibung. 1 Diese Bewertung spiegelt die allgemeine Tendenz wider, Cassius Dio zu den eher verläßlichen Quellen zu zählen, problematisch ist nur, daß die Zahl der überlieferten Fragmente, erstens sehr gering ist und zweitens diese teilweise nur in einer kommentierten Abschrift erhalten sind.
Die Historia Augusta Verus (HAV) und vor allem die Historia Augusta Marcus Antoninus (HAM) sind ein sehr ausführliches Werk vermutlich eines Autors, verfaßt irgendwann zwischen den Enden des 3. und 4. Jahrhunderts. Als Quelle sind sie sowohl sehr wertvoll, als auch sehr problematisch, da sie sich erstens wahrscheinlich der Quelle eines gewissen Marius Maximus bedienen, der zwar wahrscheinlich Zugang zu wichtigen historischen Daten hatte, aber unter Anbringung von Skandalgeschichten einen eher dem Sensationellen verpflichteten Schreibstil pflegte, und die HA zweitens teilweise selbst oft stark ausschmücken.2
2.2 Einer anderen Art von Schwierigkeit begegnet die wissenschaftliche Analyse in der Frage der Markussäule. Sie trägt einen Bilderfries mit über 100 Einzelszenen, fertiggestellt Ende des 2. Jahrhunderts, und ist deshalb problematisch, da sie erstens ikonografische Deutung notwendig macht, zweitens sie mit ziemlicher Sicherheit erst ab den Geschehnissen um 172/174(?) ansetzt, wobei der genaue Zeitpunkt aber umstritten ist und drittens nur Szenen dargestellt sind, die sich auf ein direktes Wirken des Kaisers bei den Truppen beziehen.1
2.3 So läßt nur eine Synthese der drei Hauptquellen und diverser Nebenquellen unter Anwendung der Erkenntnisse der Numismatik und Epigraphik läßt eine Interpretation zu, die auf einigermaßen gesicherter wissenschaftlicher Basis steht.
3. Dies zeigt sich auch an den Fallbeispielen „Invasion Oberitaliens“ und „das Regenwunder“.
3.1 Für die Invasion Italiens stehen an schriftlichen Quellen nur 3 kleinere Textauszüge zur Verfügung. Zum Ersten berichtet Cassius Dio von einem Einfall der Germanen über den Rhein bis nach Italien, bei dem sie den Römern großen Schaden zufügen, weiterhin daß Marcus zur Verteidigung die beiden Unterfeldherrn Pompeianus und Pertinax entsendet, welche die Germanen besiegen2. Zum Zweiten existiert ein Schmähpamphlet des Lukianos, in welchem er versucht, den Propheten Alexander in ein schlechtes Licht zu rücken. In diesem Zusammenhang spricht er von einem Orakel des Alexander, woraufhin die römische Seite jedoch ihre größte Niederlage erlitt, und „unmittelbar darauf die Ereignisse um Aquileia folgten, wobei die Stadt fast eingenommen worden wäre“.3 Drittens bezieht sich Ammianus Marcellinus anläßlich eines Quadeneinfalls in Mähren und der Slowakei im Jahr 374 auf Überfälle, die Belagerung von Aquileia, und die Zerstörung von Opitergium durch Überquerung der Iulischen Alpen, wobei Marcus dem Feind kaum Einhalt gebieten konnte.4 Außerdem erzählt die HAM von der Gefangennahme der letzten Eindringlinge bei ihrem Rückzug über die Donau, wodurch Beutegut sichergestellt werden konnte.5
3.2 Zusammenfassend sagen die Quellen aus, daß die Römer nach einer Niederlage, nicht unbedingt unmittelbar, aber doch gewiß in der Folgezeit, einen Einfall germanischer Truppen in den norditalienischen Raum hinnehmen müssen, bei dem großer Schaden entsteht, so zum Beispiel die Zerstörung Opitergiums, und auch Aquileia bedroht scheint. Durch Intervention mittels zweier Feldherrn gelingt es jedoch, den Feind zurückzuschlagen.
Die zeitliche Einordnung gestaltet sich nun schwierig. Angenommen der Sieg war als bedeutend in der römischen Welt anerkannt, was angesichts der Tatsache daß Feinde bis ins Kernland des Imperiums vorgedrungen waren, plausibel ist, so wird darauf sicherlich eine Proklamation zum Imperator (IMP) gefolgt sein. Dies wird nun von vielen der IMP VI6 Ende des Jahres 171 zugeordnet, zusammen mit der Verkündung eines Sieges über die Germanen. A.R. Birley argumentiert hier weiterhin, daß die Münzemissionen der Jahre 170/171 ganz deutlich einen ungünstigen Kriegsverlauf widerspiegeln, da sie an die Treue und Eintracht des Heeres appellieren1 und auch ansonsten jeglicher Siegesmeldung entbehren.
Auch der Ausbau der Hafenstadt Salona in den Jahren 170/1712 deutet auf eine ernste Lage hin, denn hier scheint ein Befestigung vorgenommen worden zu sein, die die Verbindung nach Italien aufrecht erhalten sollte.3 Ebenfalls etwa in dieser Zeit erhielt Valerius Maximus den Befehl, mit einer Flotte sowie starkem Kavallerieschutz den Nachschub für die Heere in Pannonien auf der Donau zu sichern, da diese ja durch die Invasoren von den Versorgungsbasen abgeschnitten waren.4 Ein Hinweis auf eine im Land zu spürende Panik, könnte der kaiserliche Erlaß sein, den Marcus bekanntgeben mußte, der für den Ausbau der Stadtbefestigung die Erlaubnis des Kaisers notwendig machte.5 Mehrere Anzeichen liegen also auf der Hand, daß es in den Jahren 170/171 zumindest eine Erschütterung des ewigen Reiches stattfand. Nun, es wurden Tiberius Claudius Pompeianus und P. Helvius Pertinax mit der Aufgabe der Verteidigung der Heimat betraut, die sie auch nach einiger Zeit erfüllen konnten.6 Die nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen in Noricum und Raetien7 werden ins Jahr 171 datiert.8
Nur der Beginn der Invasion läßt sich nicht festlegen, da die Münzemissionen des Jahres 170, die eine adlocutio und eine profectio zeigen, aber keine weiteren Siegesmeldungen bringen, sich eventuell nur auf die Ereignisse im Osten beziehen könnten, und ansonsten sich fürs Jahr 170 bisher keine weiteren zwingenden Beweise finden ließen. A.R. Birley räumt hier die Möglichkeit ein, daß Italien erst Anfang des Jahres 171 ernsthaft in Bedrohung geraten war.9
3.3 Unabhängig von der Vorgehensweise der Quellendeutung wie bei Birley versucht Walter Scheidel zu einer rein numismatischen Deutung der Ereignisse gelangen, indem er die Münzemissionen sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in Einzelheiten betrachtet.1 Wichtig ist hierbei, die Emissionsabfolge genau zu rekonstruieren2, um Abweichungen und Emissionsbrüche deutlich zu machen.
W. Scheidel verweist in diesem Zusammenhang auf die Fehler von Kollegen, die Münzemissionen als ununterbrochene, jährliche Schichten ansehen, und somit Brüche übersehen.3
3.3.1 Nach Szaivert beginnt das Jahr 170 mit der 19. Emission der Regierungszeit des Marcus, die von einem Aufbruch des Kaisers persönlich zum Feldzug, erkennbar durch Adlocutio Augusti, Profectio und Fortuna Redux, spricht. Die Victoria dieser Serie wird als Hoffnung auf oder Erinnerung an Siege interpretiert, eventuell auch als Spiegel der Ereignisse im östlichen Donauraum.4 Nach circa 4 Monaten bricht jedoch diese Emission abrupt ab, und wird durch eine anders gestaltete 20. Emission ersetzt, die als Reverslegende nur Gottheiten darstellt, welche zumeist in kriegerischem Stil gehalten sind. Sie wird bis zum Ende des Jahres fortgeführt und 171 von der stilistisch kaum differierenden 21. Emission abgelöst, diese ab der Mitte des Jahres dann von der 22. Emission gefolgt. Sie bringt zusätzlich den Appell an die Treue und Eintracht des Heeres, sowie Verweise auf die vota decennalia. Erst die 23. Emission meldet wieder Siege, die IMP VI und den Hinweis VIC/GER.5
3.3.2 Anhand einer zusammenhängenden Argumentation läßt sich nun eine zeitliche Struktur errichten. So ist der Bruch von der 19. auf die 20. Emission Merkmal für ein einschneidendes Ereignis. So wird der vorher angekündigte Feldzug bei den folgenden Münzausgaben bis zum dritten Quartal 171 verschwiegen. W. Scheidel verwendet für den Prägetyp der 20. und 21. Emission den Begriff „Verlegenheitsprägung“, da sie, bis auf sehr wenige Ausnehmen, keine konkreten Aussagen über den Verlauf des Jahres treffen, es fehlen vielleicht kaiserliche Befehle. Daher ist gerade die aussagelose Bildtypologie der Reverse bei genauerer Betrachtung vielleicht doch für die Interpretation von Nutzen, vermitteln sie zudem noch beinahe ausschließlich eine kriegerische Stimmung. Darüber hinaus ein Indiz für kriegerische Vorgänge ist die vorwiegende Ausgabe der Währung in Denaren, da sie das vor allem für die Truppenbesoldung gedachte Nominal sind. Auch gab es keine Meldungen an die Zivilbevölkerung, Offiziere und Donativempfänger. Ein weiteres Anzeichen dafür, daß sich das Reich in einer prekären Situation befand, ist das Ausbleiben der Prägung der der Selbstdarstellung des Kaisers dienenden Medaillone für das Jahr 171, die ihn als siegreichen Feldherrn zeigen. Diese blieben in anderen Krisenzeiten nicht aus.1 Betrachtet man diese Thesen nun in ihrer Gesamtheit, scheint es W. Scheidel gelungen, „literarische Quellen nachträglich in das durch die Rekonstruktion geschaffene chronologische Gerüst einzufügen, wodurch es ermöglicht wird, die bisher gängigen Kombinationen und Deduktionen auf eine neue, tragfähigere Grundlage zu stellen.“2 Damit ist vielleicht auch das Problem Birleys beseitigt, der den Zeitpunkt des Beginns der Invasion nicht zwingend festlegen konnte. Wegen des Aufbruchs zum Feldzug, des Pamphlets Lukians, mit dem Löwenopfer wahrscheinlich am Beginn eben dieses Feldzuges und dem scharfen Emissionsbruch im 2. Quartal 170 spricht hier vieles bereits für das Frühjahr 170.
W. Scheidel datiert weiterhin die Befestigung Salonas3 und den Befehl zur Sicherung des Nachschubs4 bereits ins Jahr 170.1 Im Allgemeinen folgt W.
Scheidel nun der Darstellung wie sie bereits A. R. Birley vorgenommen hat. Erst das Eintreten der Siegesmeldungen und des IMP VI ab der 23. Emission im Sommer des Jahres 171 läßt den Schluß zu, daß die Römer die Lage wieder unter Kontrolle hatten, und dann im Jahr 172 eine neue Offensive beginnen konnten, wie die 24. Emission zeigt.2
3.4 Diese doch schlüssige Argumentation könnte nun die These A. Garzettis widerlegen, der eine Invasion bereits ins Jahr 167 datiert.
3.4.1 Garzetti vertritt die Meinung, daß der Einfall später aufgrund der praetentura unmöglich war, zumal er nur von kleineren Feindesverbänden ausgeht, die in Oberitalien zwar ihr Unwesen trieben, doch in keinster Weise eine Bedrohung für das Imperium darstellten und die später geschaffene praetentura hätten überwinden können. So habe bereits die Truppenkonzentration in Rom, die sich dann auf Aquileia zubewegte, die Eindringlinge zur Flucht gezwungen, woraufhin Marcus IMP V wurde, und die praetentura Italiae et Alpium schuf, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern.3
A. Garzetti geht davon aus, daß die Münzemissionen der Jahre 170/171 sich nur auf einen mißlichen Verlauf des Feldzuges beziehen, dies konnte W. Scheidel (s. o.) jedoch bereits ausdrücklich widerlegen. Ferner unterschlägt Garzetti im Textdokument Lukians den Schluß, der ausdrücklich die Invasion als ein (direkt) an das Löwenopfer anschließende Ereignis erwähnt, und legt das Löwenopfer an den Beginn des Feldzuges 172.4 Das oft genannte Argument, daß die praetentura ein späteres Übergreifen der Feinde unmöglich gemacht hätte, stützt sich bei Garzetti mit auf seine These, daß es sich nur um kleinere Feindesverbände handelte, doch ist hier wiederum die Negierung der Geschlossenheit des Lukiantextes zu beachten. Es ist davon auszugehen, daß bei einer römischen Niederlage mit 20.000 Toten das Heer der Germanen nicht gerade klein gewesen sein muß. Weitverbreitet ist auch die Interpretation, daß mit dem Durchbrechen der Alpen1 ein Durchbrechen der römischen Verteidigung (praetentura) gemeint ist. Außerdem erscheint es fragwürdig, weshalb, wenn es nur kleinere Feindgruppen waren, nicht sofort Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, unabhängig von einer kaiserlichen Streitmacht, die in Rom auf ihre Zusammenstellung wartete. Auch Birley hat sich mit der Argumentation für das Jahr 167 anhand der Schaffung der praetentura im Zusammenhang mit den Arbeiten A. Degrassis und W: Zwikkers kritisch auseinandergesetzt, sie zwar nicht eindeutig widerlegt, ihr aber einiges an Kraft genommen.2 Dem bleibt noch anzufügen daß bei einer römischen Truppenkonzentration im Vorfeld der Alpen und dem Donauraum aus Anlaß eines Feldzuges die Notwendigkeit eines zusätzlichen Grenzschutzes vielleicht nicht mehr einleuchtend schien.
3.5 Anderen Vorschlägen, die eine Invasion als Anlaß zum Aufbruch zum Feldzug 168 sehen, ist bereits oftmals widersprochen, so war der Feldzug ja bereits von langer Hand geplant, denn es wurden ja seit ca. 165 beständig neue Truppen ausgehoben. Und auch W. Scheidel spricht im bezug auf wissenschaftliche Kollegen von einem Fehlen jeglicher Anhaltspunkte für eine Bedrohung Italiens.1 für diese Zeit. Der Emissionsbruch im Jahre 169 nämlich dürfte wohl ausschließlich auf den Tod des Verus zu beziehen sein.
3.6 In der Summe der angeführten Argumente und Meinungen zu diesem Thema spricht doch einiges für das Datum 170/171, zumal ja, würde man das Ereignis auf einen anderen Zeitpunkt legen, eine Leerstelle bleiben, die kaum mit dem Übergriff der Kostoboken auf dem Balkan gefüllt werden könnte, denn W. Scheidel hat hier aufgrund seiner numismatischen Deutung eine doch bedeutende Erschütterung des römischen Reiches festgestellt. Auch die schriftlichen Quellen deuten in ihrer Gesamtheit eher auf eine äußerst bedrohliche Situation hin. Anhand epigraphischer Daten und der Lebensläufe von einigen Feldherrn, die sich passend einfügen lassen, entsteht hier der Eindruck eines in sich doch stimmigen Gesamtbildes.
4. Auch das zweite Fallbeispiel wurde viel diskutiert, ist es nämlich dank seiner Spektakularität des Ereignisses und dank der Abbildung auf der Markussäule weithin bekannt. Bereits im ausgehenden Altertum herrschte eine rege Meinungsvielfalt, da es im Hinblick auf seine religiöse Komponente für verschiedene Persönlichkeiten von Bedeutung war.
4.1 So gibt es auch neben den Hauptquellen Cassius Dio, HAM, und Markussäule eine Vielzahl weiter Texte, die sich auf diesen Vorfall beziehen.
4.1.1 Dio schildert das Ereignis sehr ausführlich2, das Textfragment ist nur von Xiphilinos Stellungnahme unterbrochen3. Dio berichtet von einem Krieg mit den Quaden, in dessen Verlauf es zu einer Schlacht kommt, bei der den Römer aufgrund von Wassermangel eine Niederlage droht, ein aufziehendes Gewitter jedoch die Römer mit Wasser versorgt und den Feinden gleichzeitig mit Blitzschlägen Schäden zufügt. Für diesen Sieg bekommt Markus den IMP VII verliehen, was er auch dem Senat berichtet. Die HAM erwähnt in einem kurzem Satz nur das Regenwunder selbst,4 ebenso wie Tertullian in zwei Schriften kurz darauf eingeht.5 In Hieronymus Übersetzung von Eusebs Chronik ist zu erfahren, daß der (ein) betroffene(r) Feldherr Pertinax war, er sich im Gebiet der Quaden aufhielt, und Germanen und Sarmaten an der Schlacht teilnahmen. Ferner erzählt er von einem Brief des Marc Aurel, der das Regenwunder den christlichen Gebeten zuschreiben soll.6 Auch Orosius geht auf jenen Brief ein, seine übrige Schilderung gleicht den oben angeführten.7
4.1.2 Neben den schriftlichen Quellen eine bedeutende Rolle im Fortgang der Argumentation wird die Markussäule spielen, die zu Ehren des Kaisers nach seinem Tod errichtet wurde, und erst ca. 193 fertiggestellt wurde. Im heutigen wissenschaftlichen Gebrauch wird der etwa 245m lange Bilderfries der Markussäule in 116 Szenen unterteilt, das Regenwunder nimmt dabei eine sehr frühe Position mit Szene 16 am Fuß der Säule ein.8
Abgebildet ist ein Regengott, aus dessen Haar das Wasser fließt. Unter seinen ausgebreiteten Armen kämpfen Römer gegen Germanen, bereits gefallene Germanen liegen am Boden, andere Römer halten ihre Schilde hoch um sich vor dem Regen zu schützen. Der Zusammenhang zwischen den schriftlichen Quellen und dem Fries der Säule liegt zumindest dieses eine Mal hier klar vor Augen, diesem Ansatz ist nicht zu widersprochen.
Es wird sich aber noch zeigen, daß oft versucht wurde, Zusammenhänge zwischen Münzen, Quellen und anderen Abbildungen der Säule herzustellen oder zu negieren, um der jeweils eigenen Interpretation mehr Spielraum einzuräumen. Auf jeden Fall ist die Szene zuerst in den Kontext der gesamten Säule zu stellen, um eine Datierung einigermaßen gesichert werden zu lassen.
4.2 Vorneweg müßte man eigentlich beim reinen Studium der schriftlichen Quellen einräumen, daß das Regenwunder nur zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben kann, nämlich im Sommer des Jahres 174. Das Jahr deshalb, da die Quellen eindeutig von der IMP VII sprechen, die im Zusammenhang mit der Schlacht des Regenwunders verliehen wurde, und die numismatischen Forschungsergebnisse diese auf den Herbst des Jahres 174 legen.1 Nun, und Sommer ist eben die Jahreszeit in der es in Mitteleuropa wohl einzig und allein möglich sein wird, an Wassermangel und Hitze zu leiden und dann von einem Gewittersturm überrascht zu werden.
4.3 Doch hier könnte man verführt sein, anzunehmen, daß die Markussäule etwas anderes aussagt. Denn da die Regenwunderszene bereits am Beginn der Säule zu sehen ist, viele Forschermeinungen aber davon sprechen, daß die Markussäule bereits im Jahr 172 ansetzt, scheint hier doch ein Widerspruch vorzuliegen. Doch ist dieser Widerspruch vielleicht einfacher aus der Welt zu räumen, als man denkt?
4.4 Wenn man H. Wolff glauben mag, ja, doch ist sicherlich die im Lauf der ständigen wissenschaftliche Diskussion entstandene, gegenseitig auf sich aufbauende Argumentation es wert, sich im weiteren Verlauf ihrer ebenfalls zu widmen. So befaßten sich bereits vor der Jahrhundertwende A. von Domaszewski, Th. Mommsen, sowie Petersen und Harnack mit dem Regenwunder bzw. der Markussäule und kamen teils zu wichtigen, teils zu nichtigen Schlüssen.
4.4.1 Voraussetzung für eine Miteinbeziehung der bildlichen Darstellung in einen Interpretationsansatz der zeitlichen Abläufe ist, davon auszugehen, daß die Szenenfolge chronologisch angeordnet ist. Diese Vermutung liegt deshalb schon nahe, da eine Alternative fehlt. Eine thematische Gliederung ist auch in Ansätzen nicht zu erkennen. Und da ja auch die Trajanssäule nach diesem Prinzip bebildert ist, wie auch H. Wolff bemerkt, der außerdem in der Victoria in Szene 55 noch ein eindeutig chronologisches Indiz. sieht1,(s. u.) ist dies wohl die plausibelste Lösung.
4.4.2 Nachdem die Darstellungsordnung geklärt ist, ist es nun an der Zeit festzustellen, welche Jahre auf der Säule überhaupt dargestellt sind. Hier gehen die Meinungen weit auseinander, einige sprechen von einer ausschließlichen Abbildung des ersten Markomannenkrieges, andere sowohl vom ersten bis 175 als auch vom zweiten bis 180 bzw. 179. Im Zusammenhang damit divergieren auch die Ansichten über den Zeitpunkt des zeitlichen Beginns des Reliefs, und dies ist ein Punkt der Argumentation, das Regenwunder neu zu datieren.
4.4.2.1 Vorauszuschicken ist hier, daß die Säule natürlich ein Monument ist, welches das erfolgreiche Wirken des Kaisers bei den Truppen und somit Ereignisse im Zusammenhang mit seiner Person darstellt.2 Da es aber auch keinen Beleg dafür gibt, daß sich Commodus bei der kämpfenden Truppe aufhielt noch einen Anlaß, ihn abzubilden, da es ja ein Lobesmonument zu Ehren des Marcus war, gilt dies natürlich auch für das Argument, daß Commodus nicht auf dem zweiten Teil des Frieses abgebildet ist, und somit die Säule nur die Kriegsjahre bis 175 zeige.3 Dies zeigt sich auch daran, daß trotz des vollständigen Namens columna centenaria divi Marci et Faustinae4 diese nirgends auf den Bildern zu finden ist.5
Zu diesem Gedanken, der eine ausschließliche Datierung der Säule auf die Jahre bis 175 gegenstandslos machen soll, gesellen sich weitere.
Da die Säule erst nach dem Tod des Kaisers errichtet wurde, läßt sich eben auch kein Grund finden weshalb der zweite Krieg nicht dargestellt sein sollte, zumal dieser ja sehr erfolgreich war.
4.4.2.2 Auch A. v. Domaszewski läßt sich hier widerlegen. Das Argument, daß die Victoria in Szene 55 die Kriege gegen Germanen bis 172 und gegen Sarmaten bis 175 trenne, widerspricht sich bereits selbst, da noch nach 172 gegen Germanen gekämpft wurde.1 Außerdem ist die Victoria, parallel zur Trajanssäule ein treffendes Motiv, die beiden Kriege an der Grenze 175 zu scheiden, zudem noch an der passenderen Stelle. Vielleicht wird mit ihr auch der Triumph des Jahres 176 bei der Rückkehr der Augusti versinnbildlicht.2
4.4.2.3 Desweiteren ist davon auszugehen, daß die ersten Kriegsjahre nicht sehr erfolgreich verliefen, und somit die Darstellung der großen Erfolge der weiteren Kriegsjahre des ersten und zweiten Krieges überwiegen,3 oder, daß eben zum großen Teil Ereignisse dargestellt werden, die sich auf ein Wirken des Kaisers bei den Truppen beziehen.4
Dies erklärt das Fehlen von Darstellungen vor dem Regenwunder. Im Zusammenhang damit läßt sich auch argumentieren, daß der Anfang der Säule nicht unbedingt mit der Adlocutio-Prägung und dem Übergang über einen Fluß des Jahres 172 gleichzusetzen ist, da ja davon ausgegangen werden kann, daß der Kaiser mit den Truppen ein Winterlager südlich der Donau bezog und somit jährlich das Überschreiten der Donau erfolgte.5
Auch vermag H. Wolff eine Argumentation anhand von Münzprägungen zur religio augusti, einer Errichtung eines Tempels und der fälligen Dankbarkeit des Kaisers gegenüber einer Gottheit einleuchtend zu hinterfragen, und ihr somit zumindest den Boden der Glaubwürdigkeit zu entziehen.6
4.4.3 Ein Ansatz blieb bisher außen vor. So scheint es doch auch möglich zu sein, daß vielleicht das Regenwunder in der Abbildung nach vorne gezogen wurde, sei es aus religiösen oder ästhetischen Gründen, nur um einfach das besondere Ereignis an einen Punkt der Säule zu bringen, der nicht zu weit vom Auge des Betrachters entfernt ist.1 Allein diese gewichtigen Argumente lassen die bisherige breit anerkannte Forschungsmeinung fragwürdig erscheinen.
4.5 Der Versuch Domaszewskis schließlich, die Echtheit der Dionischen Fragmente zu verneinen, mit dem Hinweis auf eine christliche Interpolation seitens des Mönches Xiphilin und der staatsrechtlichen Unmöglichkeit der Verleihung des IMP durch den Kaiser selbst, obwohl ja Dio hier klar die Besonderheit des kaiserlichen Vorgehens erklärt, bleibt doch nur verzweifelt.2
4.6 Die Summe der Argumente scheint nun geradezu zu erdrücken, ganz klar liegen nun Evidenzen vor, die das Nachfolgende unterstützen: Auf der Säule kommen beide Kriege zur Abbildung, getrennt durch die Victoria. Der Beginn der Säule läßt sich immer noch nicht genau festmachen, dies ist aber nicht relevant für die Datierung des Regenwunders, das eindeutig durch Dio auf das Jahr 174 durch die IMP VII festgelegt ist.
5. So scheint nun die Widersprüchlichkeit gelöst zu sein und es wird sich im weiteren Verlauf der Jahre und der wissenschaftlichen Diskussion zeigen, inwieweit diesen Deutungsansätzen ein Bein gestellt werden kann. Vielleicht wird die zweifelsfreie Lösung der Probleme „Invasion Italiens“ und „das Regenwunder“ niemals möglich sein, wenn nicht gänzlich neue Beweise die richtige Spur eindeutig zuweisen.
Literatur:
A. Birley, Marc Aurel: Kaiser und Philosoph, München 1968, S. 270-379,409- 415,427-432
Karl Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, Von Augustus bis zu Konstantin, München, 1988, S. 336-341
Corpus Inscriptionum Latinarum I-XVI, Berlin, 1863 ff.
Das Corpus Iuris Civilis (Romani), Band 4, Leipzig ,1832, Aalen, 1984
H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, 3 Bde., Berlin, 1892 - 1916
Albino Garzetti, From Tiberius to the Antonines, London, 1974, S. 480-506
R. Göbl, Antike Numismatik I, München 1978
H.W. Goetz und K.W. Welwei, Altes Germanien, Band 2, Darmstadt, 1995, S. 282-327
Martin Hose, Erneuerung der Vergangenheit: Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio, Stuttgart, 1994 356 - 451 L´Année Épigraphique. Revue des publication épigraphiques relatives à l´antiquité romaine, Paris 1956
H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, Antoninus Pius to Commodus, M. Aurelius, London 1940
Th. Mommsen. Das Regenwunder der Markussäule. Hermes 30, Berlin, 1895, S. 90-106
P. Oliva, Pannonia and the Onset of Crisis in the Roman Empire, Prag 1962, S. 258-310
W. Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, München, 1990, S. 1-18
W. Szaivert, Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161-192), Wien, 1986 (Moneta Imperii Romani, Bd. 18) Christine Trzatzka-Richter, Furor teutonicus, Trier, 1991, S. 227-233
H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Markussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 9-29
Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege
[...]
1 Martin Hose, Erneuerung der Vergangenheit: Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio, Stuttgart, 1994, S. 444-447
2 Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 410-412
1 H. Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege, S. 74
2 Cassius Dio 71, 3, 2-4
3 Lukianos, Pseudomantis 48
4 Ammianus Marcellinus, 29, 6, 1
5 HA Marcus 21,10
6 H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, Antoninus Pius to Commodus, M. Aurelius, London 1940, Nr 1388 u.a.
1 H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, Antoninus Pius to Commodus, M. Aurelius, London 1940, Nr. 1394 u.a.; 1395 ff.
2 H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, 3 Bde., Berlin, 1892 - 1916, 2287
3 Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 304
4 L´Année Épigraphique. Revue des publication épigraphiques relatives à l´antiquité romaine, Paris 1956, 124; Birley S. 303; bereits von E. Birley in die Jahre 170-175 datiert
5 Das Corpus Iuris Civilis (Romani), Band 4, Leipzig ,1832, Aalen, 1984, 50, 10, 6, S.1196; Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 304
6 Dio 71, 3, 1-2; HA Pertinax 2, 4
7 HA Pertinax 2, 6
8 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S, 17; mit bezug auf R. Egger, Gnomon 18, 1942, S. 331; H. -G. Kolbe, Der Pertinaxstein aus Brühl, BJ 162, 1962, S. 417; sowie weitere Forschungsergebnisse siehe W. Scheidel, Anm. 79
9 Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 305
1 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 1-18; er folgt hier der Einteilung von Wolfgang Szaivert,(s. u. Anm. 1, S.5)
2 nach W. Szaivert, Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161-192), Wien, 1986 (Moneta Imperii Romani, Bd. 18)
3 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 2-3
4 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 9
5 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 8-11, S. 16, Münzen Nr. 172 - 228
1 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die
2 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 13
3 H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, 3 Bde., Berlin, 1892 - 1916, 2287
4 L´Année Épigraphique. Revue des publication épigraphiques relatives à l´antiquité romaine, Paris 1956, 124; Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968 S. 303; bereits von E. Birley in die Jahre 170-175 datiert
1 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 15
2 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 16 mit Bezug auf W. Szaivert, Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161- 192), Wien, 1986 (Moneta Imperii Romani, Bd. 18), S. 205
3 Albino Garzetti, From Tiberius to the Antonines, London, 1974, S. 486-488
4 Albino Garzetti, From Tiberius to the Antonines, London, 1974, S. 493
1 Cassius Dio 71, 3, 2
2 Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 428-429
1 Walter Scheidel, Der Germaneneinfall in Oberitalien unter Marcus Aurelius und die Emissionsabfolge der kaiserlichen Reichsprägung, Chiron 20, 1990, S. 8
2 Cassius Dio 71, 8 u. 10
3 Cassius Dio 71, 9
4 HAM 24, 3-4
5 Tertullian, Apologeticum 5,6; Tertullian, Ad Scapulam 4,7
6 Hieronymus, Chronik a. 2189-2192
7 Orosius, Historiae adversum paganos 7, 15, 6-11
8 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 9
1 H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, Antoninus Pius to Commodus, M. Aurelius, Nr. 1483 ff.
1 H. Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege, S. 73; bezieht sich auf seinen Artikel Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 18
2 H. Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege, S. 73
3 H. Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege, S. 74; H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 19/20, S. 22
4 Corpus Inscriptionum Latinarum I-XVI, Berlin, 1863 ff., Band VI 1585 A l. 5
5 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 21
1 1 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 12/13; verweist auch auf Inschriften, die diese Periode des Krieges eindeutig als eine zur damaligen Zeit als Einheit angesehene ausweisen, ILS 1112/1326/1327
2 H. Wolff, Die Markussäule als Quelle für die Markomannenkriege, S. 74; H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 12
3 Th. Mommsen, Das Regenwunder der Markussäule. Hermes 30, Berlin, 1895, S.94
4 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S.20-22
5 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 16; siehe dort auch Anm. 57, nach C. H. Dodd sei Marcus sogar im Winter 172/173 nach Rom zurückgekehrt
6 H. Wolff, Welchen Zeitraum stellt der Bilderfries der Marcussäule dar?, Ostbairische Grenzmarken 32, 1990, S. 14/15/16
1 auch A. Birley erwähnt diese Möglichkeit, Anthony Birley, Mark Aurel: Kaiser und Philosoph, München, 1968, S. 414
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen der Markomannenkriege, die in diesem Text behandelt werden?
Der Text konzentriert sich auf die Chronologie der Markomannenkriege und verschiedene Ansätze zur Interpretation von Quellen, insbesondere anhand der Beispiele "Invasion Italiens" und "das Regenwunder". Er untersucht auch, inwieweit widersprüchliche Quellen zur chronologischen Abfolge der Kriege führen.
Welche Quellen werden bei der Analyse der Markomannenkriege verwendet?
Die Hauptquellen sind die fragmentarischen Überlieferungen von Cassius Dio, die Historiae Augustae (HA) über Marcus Aurelius und Lucius Verus sowie die Markussäule auf der Piazza Colonna in Rom. Weiterhin werden Münzen, Inschriften, Urkunden und Anmerkungen anderer historischer Persönlichkeiten berücksichtigt.
Warum sind die schriftlichen Quellen problematisch?
Die schriftlichen Quellen sind oft schwer zeitlich einzuordnen, da ihnen Daten fehlen. Außerdem bedürfen sie einer kritischen Bewertung hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, Schreibabsichten und Entstehungsumstände. Cassius Dio wird beispielsweise als eher verlässliche Quelle betrachtet, aber die überlieferten Fragmente sind sehr gering und teilweise nur in kommentierten Abschriften erhalten. Die Historia Augusta ist sehr ausführlich, aber problematisch, da sie sich wahrscheinlich der Quelle Marius Maximus bedient und teilweise stark ausschmückt.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Analyse der Markussäule?
Die Markussäule trägt einen Bilderfries mit über 100 Einzelszenen und erfordert ikonografische Deutung. Sie setzt mit ziemlicher Sicherheit erst ab den Geschehnissen um 172/174(?) an, wobei der genaue Zeitpunkt umstritten ist, und es werden nur Szenen dargestellt, die sich auf ein direktes Wirken des Kaisers bei den Truppen beziehen.
Wie kann eine gesicherte wissenschaftliche Basis für die Interpretation der Quellen geschaffen werden?
Nur eine Synthese der drei Hauptquellen und diverser Nebenquellen unter Anwendung der Erkenntnisse der Numismatik und Epigraphik ermöglicht eine Interpretation, die auf einigermaßen gesicherter wissenschaftlicher Basis steht.
Was wird über die "Invasion Oberitaliens" berichtet?
Die Quellen berichten von einem Einfall germanischer Truppen in den norditalienischen Raum, bei dem großer Schaden entsteht, einschließlich der Zerstörung Opitergiums und der Bedrohung Aquileias. Durch Intervention mittels zweier Feldherrn gelingt es jedoch, den Feind zurückzuschlagen.
Wie wird die "Invasion Oberitaliens" zeitlich eingeordnet?
Die zeitliche Einordnung ist schwierig. Viele ordnen den Sieg und die Proklamation zum Imperator (IMP) VI Ende des Jahres 171 zu, zusammen mit der Verkündung eines Sieges über die Germanen. Münzemissionen der Jahre 170/171 spiegeln einen ungünstigen Kriegsverlauf wider, und der Ausbau der Hafenstadt Salona deutet auf eine ernste Lage hin.
Was ist der numismatische Ansatz von Walter Scheidel?
Walter Scheidel versucht, zu einer rein numismatischen Deutung der Ereignisse zu gelangen, indem er die Münzemissionen sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in Einzelheiten betrachtet. Wichtig ist hierbei, die Emissionsabfolge genau zu rekonstruieren, um Abweichungen und Emissionsbrüche deutlich zu machen.
Was wird über das "Regenwunder" berichtet?
Dio schildert ausführlich einen Krieg mit den Quaden, in dessen Verlauf es zu einer Schlacht kommt, bei der den Römern aufgrund von Wassermangel eine Niederlage droht. Ein aufziehendes Gewitter versorgt jedoch die Römer mit Wasser und fügt den Feinden gleichzeitig mit Blitzschlägen Schäden zu. Für diesen Sieg bekommt Markus den IMP VII verliehen.
Wie ist das "Regenwunder" auf der Markussäule dargestellt?
Auf der Markussäule ist ein Regengott abgebildet, aus dessen Haar das Wasser fließt. Unter seinen ausgebreiteten Armen kämpfen Römer gegen Germanen. Römer halten Schilde hoch, um sich vor dem Regen zu schützen. Die Szene ist relativ früh am Fuß der Säule dargestellt.
Wann soll das "Regenwunder" stattgefunden haben?
Basierend auf den schriftlichen Quellen und den numismatischen Forschungsergebnissen, die die IMP VII auf den Herbst des Jahres 174 legen, wird das Regenwunder im Sommer des Jahres 174 datiert.
Welche Argumente gibt es für die Datierung der Markussäule im Zusammenhang mit dem "Regenwunder"?
Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, welche Jahre auf der Säule dargestellt sind. Einige sprechen von einer ausschließlichen Abbildung des ersten Markomannenkrieges, andere sowohl vom ersten bis 175 als auch vom zweiten bis 180 bzw. 179. Die Annahme, dass die Szenenfolge chronologisch angeordnet ist, ist plausibel. Es ist auch möglich, dass die Darstellung des "Regenwunders" aus religiösen oder ästhetischen Gründen vorgezogen wurde.
- Arbeit zitieren
- Thorsten Steger (Autor:in), 1998, Die Chronologie der Markomannenkriege, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/104298