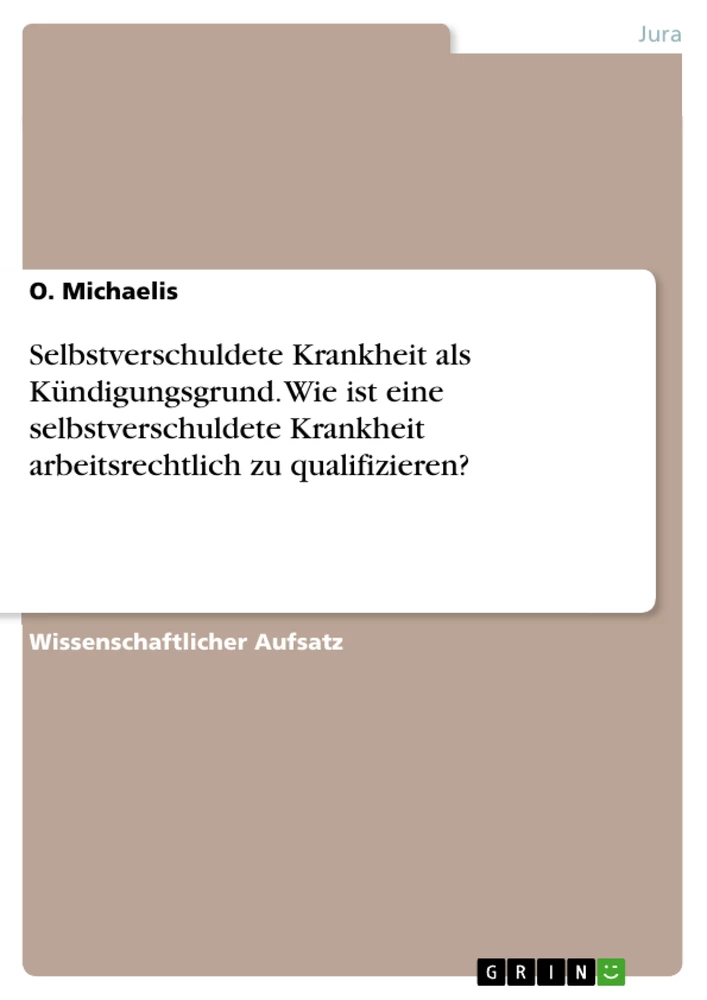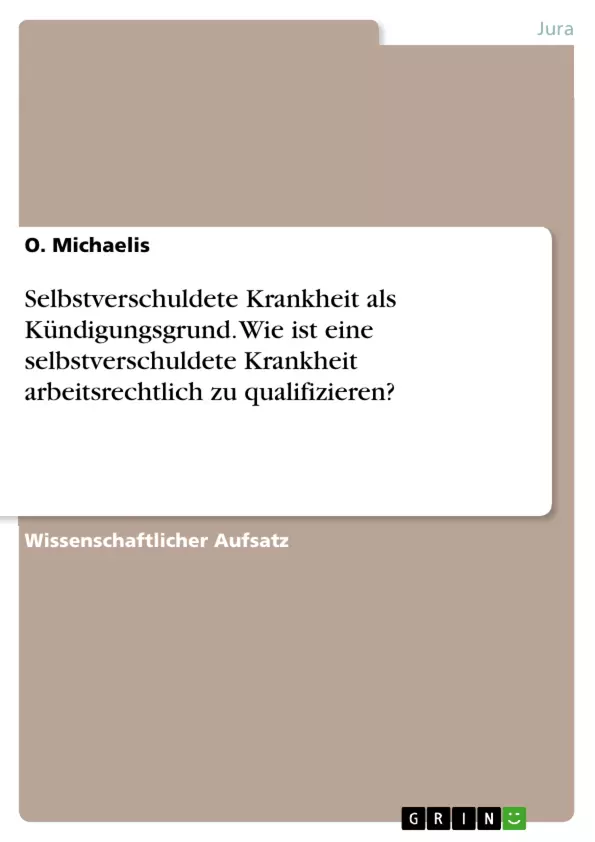Wer eine gefährliche Sportart ausübt und sich dabei verletzt, riskiert seinen Arbeitsplatz. Und wenn man "durch eigene Blödheit" schon erkrankt, erhält man auch keine Entgeltfortzahlung. Diese oder ähnliche Aussagen geistern massenhaft durch die Medien. Doch ist das zutreffend und wenn ja, womit lässt sich eine solche Kündigung begründen? Wie ist eine selbstverschuldete Krankheit arbeitsrechtlich zu qualifizieren? Kann sie zu einer Kündigung des Arbeitnehmers führen?
Ein Arbeitsverhältnis ist ein typisches Dauerschuldverhältnis, bei dem der Arbeitnehmer zur Leistung der weisungsgebundenen Arbeit und der Arbeitgeber zur Leistung der versprochenen Vergütung verpflichtet ist. So sind für das Arbeitsverhältnis grundsätzlich auch die Regelungen des allgemeinen Schuldrechts anwendbar – insbesondere hinsichtlich des Leistungsstörungsrechts. Auch ist ein Arbeitsverhältnis ständigen Veränderungen und Anpassungen im Unternehmen ausgesetzt, wodurch es eines besonderen Schutzes bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund
- I. Allgemeine Einordnung
- 1. Der arbeitsrechtliche Bestandsschutz
- 2. Die Bedeutung des Betriebsrates
- II. Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
- III. Krankheit als Kündigungsgrund
- IV. Die selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund
- 1. Grundsatz
- 2. Beispiele selbstverschuldeter personenbedingter Kündigungsgründe
- I. Allgemeine Einordnung
- C. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Aspekte selbstverschuldeter Krankheiten als Kündigungsgrund im Arbeitsrecht. Ziel ist es, die relevanten Rechtsgrundlagen zu beleuchten und die Praxis anhand von Beispielen zu verdeutlichen.
- Arbeitsrechtlicher Bestandsschutz und seine Grenzen
- Die Rolle des Betriebsrates bei Kündigungen
- Krankheit als Kündigungsgrund: Kausalität und Verschulden
- Unterscheidung verschiedener Arten von Krankheiten im Kontext von Kündigungen
- Beispiele für selbstverschuldete Krankheiten als Kündigungsgrund
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die kontroverse Frage, ob eine selbstverschuldete Erkrankung einen Kündigungsgrund darstellen kann, und beleuchtet die öffentliche Wahrnehmung dieser Problematik. Sie führt in die Thematik ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage.
B. Selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und gliedert sich in mehrere Unterkapitel. Es beginnt mit einer allgemeinen Einordnung des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzes und der Bedeutung des Betriebsrates im Kündigungsprozess. Anschließend wird die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses unter verschiedenen Gesichtspunkten (zeitlich und kausal) betrachtet, um den Kontext für die Diskussion um krankheitsbedingte Kündigungen zu schaffen. Das Kapitel behandelt ausführlich die Krankheit als Kündigungsgrund, differenziert zwischen verschiedenen Arten von Krankheiten und analysiert die Rechtsfolgen. Der Schwerpunkt liegt auf der selbstverschuldeten Krankheit als Kündigungsgrund, mit einer detaillierten Erörterung der Grundsätze und einer Vielzahl von Beispielen, die verschiedene Sportarten und Verhaltensweisen umfassen, um die komplexen Aspekte dieser Rechtsfrage zu beleuchten. Dabei wird die juristische Argumentation für jeden Fall erläutert.
Schlüsselwörter
Selbstverschuldete Krankheit, Kündigungsgrund, Arbeitsrecht, Bestandsschutz, Betriebsrat, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Kausalität, Verschulden, Kündigung, Langzeitkrankheit, Kurzerkrankung, Dauerarbeitsunfähigkeit, Sportverletzung, Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Rechtsfolgen.
Häufig gestellte Fragen zu: Selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Aspekte selbstverschuldeter Krankheiten als Kündigungsgrund im deutschen Arbeitsrecht. Sie beleuchtet die relevanten Rechtsgrundlagen und verdeutlicht die Praxis anhand von Beispielen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den arbeitsrechtlichen Bestandsschutz und seine Grenzen, die Rolle des Betriebsrates bei Kündigungen, Krankheit als Kündigungsgrund (Kausalität und Verschulden), verschiedene Arten von Krankheiten im Kontext von Kündigungen und Beispiele für selbstverschuldete Krankheiten als Kündigungsgrund (einschließlich juristischer Argumentation).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil ("Selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund"), der in Unterkapitel zur allgemeinen Einordnung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Krankheit als Kündigungsgrund und selbstverschuldeter Krankheit als Kündigungsgrund gegliedert ist, und einem Ergebnis. Der Hauptteil analysiert detailliert die Grundsätze und bietet zahlreiche Beispiele.
Welche Aspekte des arbeitsrechtlichen Bestandsschutzes werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den arbeitsrechtlichen Bestandsschutz und seine Grenzen im Kontext von krankheitsbedingten Kündigungen. Die Bedeutung des Betriebsrates im Kündigungsprozess wird ebenfalls ausführlich behandelt.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Betriebsrates bei Kündigungen, insbesondere im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Kündigungen. Seine Bedeutung im Kündigungsprozess wird beleuchtet.
Welche Arten von Krankheiten werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Arten von Krankheiten im Kontext von Kündigungen, um die komplexen Aspekte der Rechtsfrage zu beleuchten. Beispiele umfassen Langzeit- und Kurzerkrankungen sowie die Dauerarbeitsunfähigkeit.
Welche Beispiele für selbstverschuldete Krankheiten werden genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele für selbstverschuldete Krankheiten als Kündigungsgrund, die verschiedene Sportarten und Verhaltensweisen umfassen, wie z.B. Sportverletzungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Selbstverschuldete Krankheit, Kündigungsgrund, Arbeitsrecht, Bestandsschutz, Betriebsrat, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Kausalität, Verschulden, Kündigung, Langzeitkrankheit, Kurzerkrankung, Dauerarbeitsunfähigkeit, Sportverletzung, Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Rechtsfolgen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, unter welchen Bedingungen eine selbstverschuldete Erkrankung einen Kündigungsgrund darstellen kann.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der Volltext der Arbeit enthält detaillierte Informationen zu allen genannten Aspekten. Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse der rechtlichen Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis.
- Quote paper
- O. Michaelis (Author), 2021, Selbstverschuldete Krankheit als Kündigungsgrund. Wie ist eine selbstverschuldete Krankheit arbeitsrechtlich zu qualifizieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1040806