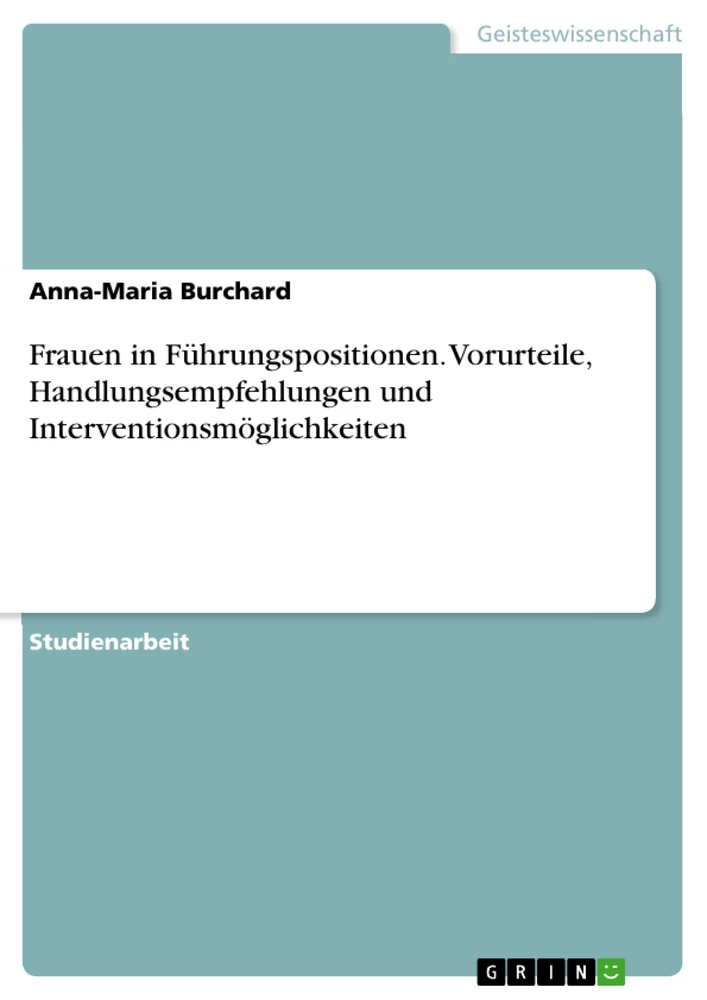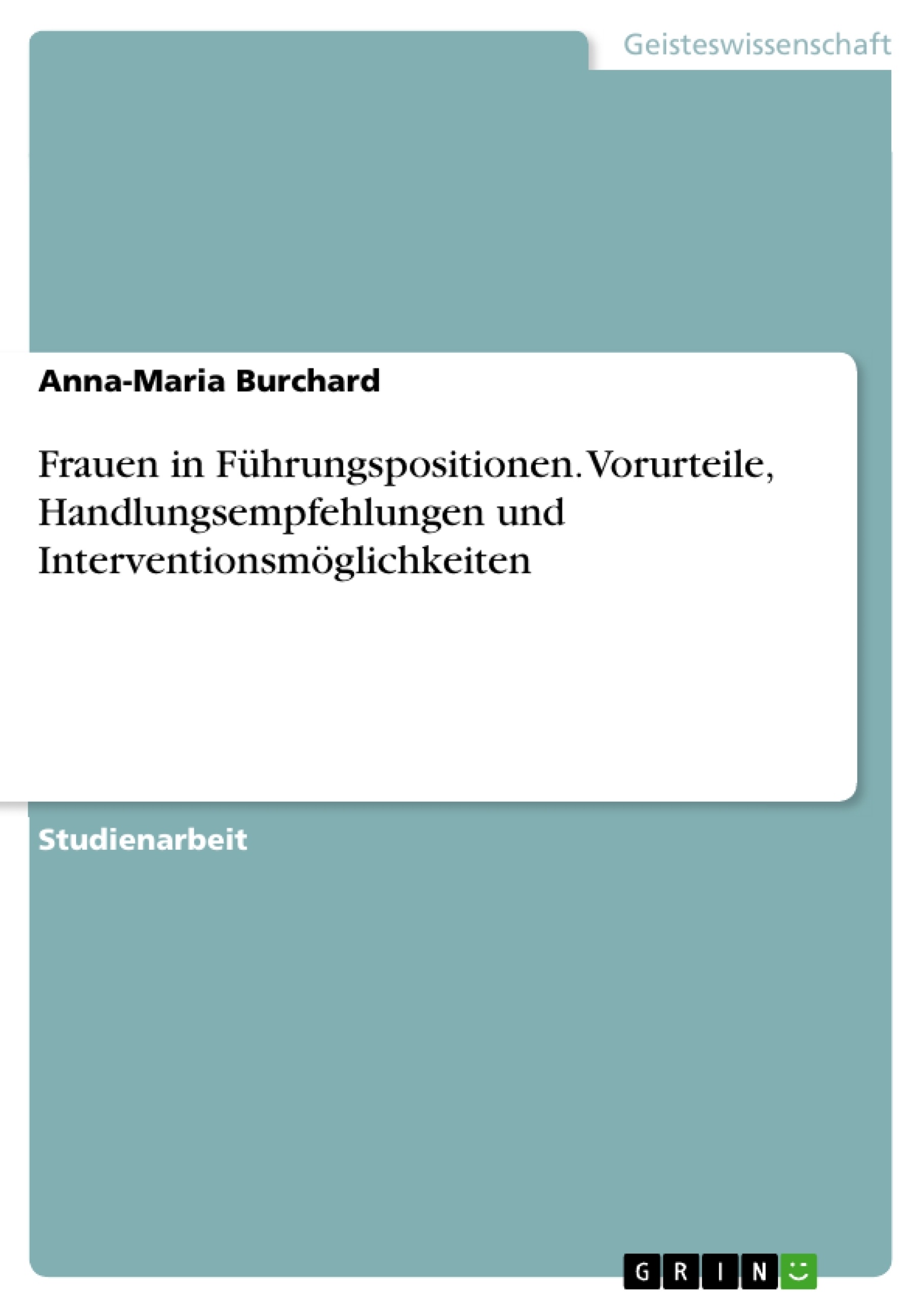Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit Frauen in Führungspositionen und dessen Vorurteile, Handlungsempfehlungen und Interventionsmöglichkeiten.
Obwohl der Frauenanteil an den Erwerbstätigen insgesamt deutlich zugenommen hat, beschränkt sich ihre Berufswahl immer noch häufig auf ein begrenztes Spektrum an Tätigkeiten, gleichzeitig zeigen sich seit Anfang der neunziger Jahre nur geringe Veränderungen der Frauenanteile in einzelnen Berufsgruppen. Empirische Analysen bestätigen, dass von den 42,1 % der erwerbstätigen Frauen sich nur 3,7 % in Führungspositionen befinden, obwohl festzustellen ist, dass ein hoher Frauenanteil in Führungspositionen sich nicht nur äußerst positiv auf die ökonomische und soziale Ebene auswirkt, sondern von Frauen geführte Unternehmen im Durchschnitt auch doppelt so schnell wachsen wie von Männern geleitete Unternehmen. Daher stellt sich die Frage, warum Frauen trotz gewandelter Geschlechterrollen, eines hohen Bildungsniveaus und einer daraus resultierenden hohen Qualifizierung, vielfältiger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und gesetzlicher Regelungen noch immer in Leitungsfunktionen unterrepräsentiert sind?
Die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich aus wissenschaftlicher Sicht nicht leicht, denn anhand von Erkenntnissen diverser Studien ist es zwar möglich, Aussagen über die Anzahl von Frauen in Führungspositionen zu treffen und deren Entwicklung zu begutachten, jedoch sind die tatsächlichen Gründe für den geringen Frauenanteil bisher schwer zu interpretieren. Hinzu kommt, dass laut der Soziologin Barbara Maria Blattert die formale Gleichberechtigung und das Recht auf Chancengleichheit mitnichten garantieren, dass die Gleichstellung tatsächlich verwirklicht wird. Darüber hinaus kann genannter Umstand sogar missbraucht werden, um eine bestehende Ungleichheit zum individuellen Problem zu deklarieren, was die Benachteiligung von Frauen als individuelles Problem an die Betroffenen zurückgibt und somit dazu führt, bereits Erreichtes zu deformieren, da bis dato Einsichten in strukturelle Zusammenhänge oftmals unberücksichtigt bleiben.
Worauf ist es nun zurückzuführen, dass Frauen im Bereich der Erwerbsarbeit diskriminiert werden und die Ressourcen von Frauen bislang nicht ausreichend genutzt werden? Reicht eine einfache Vereinbarkeitsproblematik von Familie und beruflicher Karriere aus, den geringen Frauenanteil in oberen Führungsfunktionen zu erklären?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorurteile
- 2.1 Definition Vorurteil
- 2.2 Merkmale von Vorurteilen
- 2.3 Entstehung von Vorurteilen
- 2.4 Vorurteile gegenüber Frauen
- 2.5 Vor- und Nachteile von Vorurteilen
- 3. Praxisbeispiele
- 3.1 Das Ökonomie-Vorurteil
- 3.2 Das Kompetenz-Vorurteil
- 3.3 Das Motivations-Vorurteil
- 4. Handlungsempfehlungen und Interventionsmöglichkeiten
- 4.1 Trainings zur Sensibilisierung
- 4.2 Transparente Recruitingprozesse
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Thema Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen und analysiert die Gründe für deren Unterrepräsentanz. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Entstehung und Auswirkungen von Vorurteilen zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für die Förderung von Chancengleichheit zu erarbeiten.
- Definition und Merkmale von Vorurteilen
- Entstehung von Vorurteilen gegenüber Frauen
- Praxisbeispiele von Vorurteilen in der Arbeitswelt
- Handlungsempfehlungen zur Sensibilisierung und Intervention
- Diskussion der Herausforderungen bei der Förderung von Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen dar und erläutert die Forschungsfrage, die sich mit den Ursachen dieser Ungleichheit befasst.
- Kapitel 2: Vorurteile: Dieses Kapitel definiert Vorurteile, beschreibt ihre Merkmale und Entstehung sowie spezifische Vorurteile gegenüber Frauen. Zudem werden die Vor- und Nachteile von Vorurteilen beleuchtet.
- Kapitel 3: Praxisbeispiele: Hier werden konkrete Beispiele für Vorurteile gegenüber Frauen in der Arbeitswelt vorgestellt, wie das Ökonomie-Vorurteil, das Kompetenz-Vorurteil und das Motivations-Vorurteil.
- Kapitel 4: Handlungsempfehlungen und Interventionsmöglichkeiten: Dieses Kapitel bietet Handlungsempfehlungen zur Sensibilisierung und Intervention, um Vorurteile abzubauen und Chancengleichheit zu fördern. Hier werden Trainingsmaßnahmen und transparente Recruitingprozesse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Vorurteile, Frauen, Führungspositionen, Chancengleichheit, Sensibilisierung, Intervention, Arbeitswelt, Ökonomie-Vorurteil, Kompetenz-Vorurteil, Motivations-Vorurteil, Recruitingprozesse.
- Quote paper
- Anna-Maria Burchard (Author), 2021, Frauen in Führungspositionen. Vorurteile, Handlungsempfehlungen und Interventionsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1038086