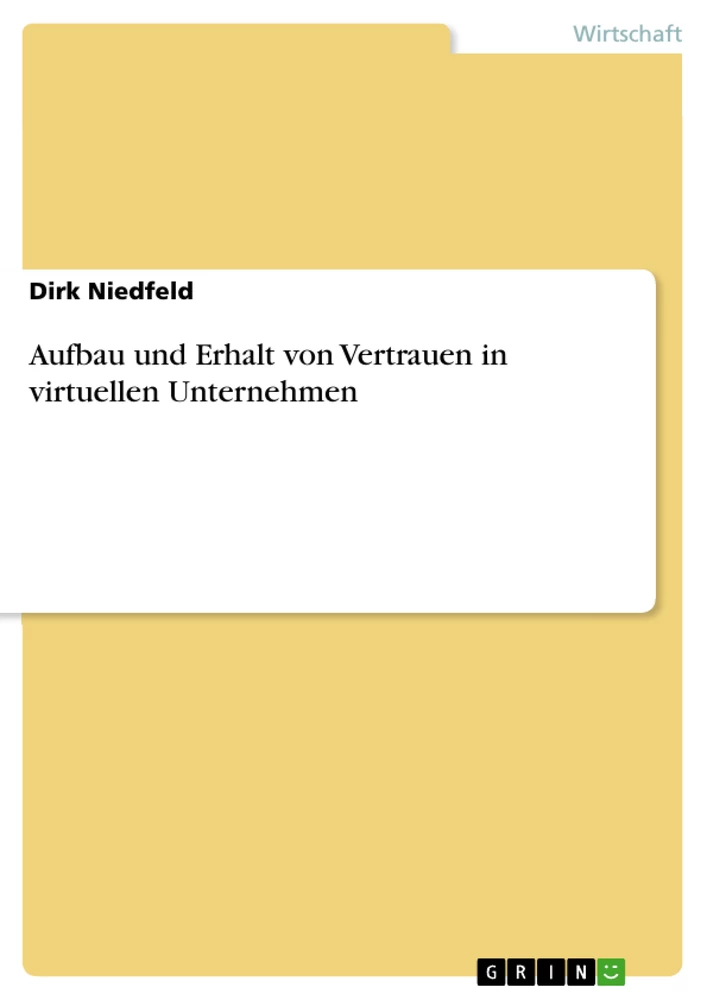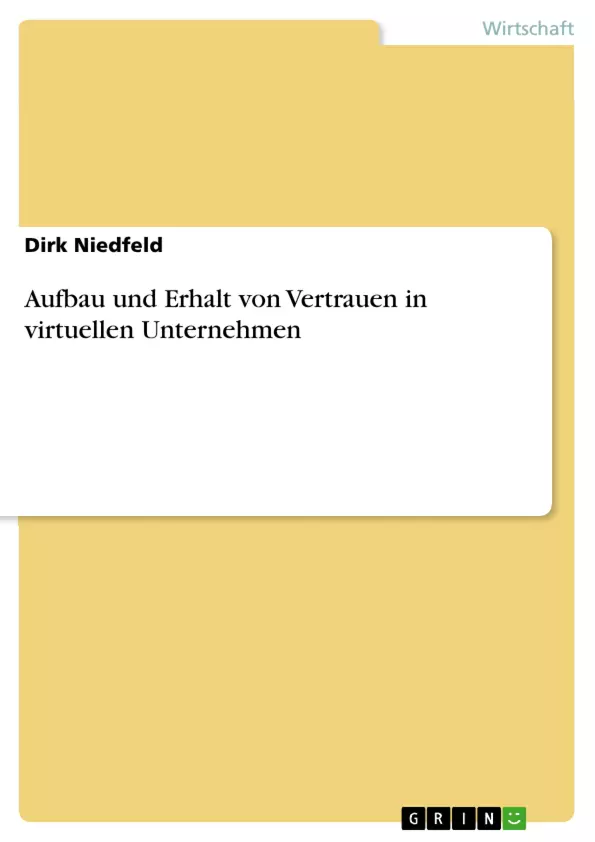Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
2. Begriffserklärung
2.1 Virtuell
2.2 Unternehmen
2.3 Vertrauen
3. Vertrauen in virtuellen Unternehmen
3.1 Traditionelle Absicherung zwischen Unternehmen
3.2 Aufbau von Vertrauen in virtuellen Unternehmen
3.2.1 Erfolgsvoraussetzungen für VU
3.2.2 Bedeutung von Vertrauen in virtuellen Unternehmen
3.2.3 Vertrauenskultur der Firma TCG
3.2.4 Vertrauen statt Führungsautorität
3.3 Erhalt von Vertrauen
3.3.1 Pflege des aufgebauten Vertrauens
3.3.2 Kein Missbrauch gewonnener Daten
3.4 Hindernisse die gegen alleiniges Vertrauen spreche n
4. Schlussbemerkung
5. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
Das Konzept des virtuellen Unternehmens als Kooperationsform zwischen Individuen entstand Anfang der 90er Jahre in den USA und basiert weitgehend auf selbständigen Einzelunternehmern und –Unternehmerinnen, auch Selbstangestellte, Freelancer oder Lebensunternehmer genannt, die sich bei flexiblem Einsatz auf freier Vertragsbasis zu einer temporären Organisation zusammenschließen und in diesem Rahmen qualifizierte Dienstleitungen erbringen. Nach Abschluss des Projekts bzw. des Auftrags löst sich diese Kooperationsform wieder auf und es entstehen wieder selbständige Partner.
In der Wissenschaft, die sich - zumindest im angloamerikanischen Raum – bereits Anfang der 90er Jahre mit derartigen Kooperationsformen beschäftigt hatte, hat sich der Begriff „Virtuelle Unternehmen“ zur Beschreibung derartiger Phänomene durchgesetzt.
Dabei erfolgt die Verwendung dieses Begriffs häufig undifferenziert, so wird sowohl der gesamte Untersuchungsraum, der die flexiblen Kooperationen, die einzelnen Kooperationspartner und ein eventuelles Kooperationsnetzwerk einschließt, als auch die einzelne flexible Kooperation als „Virtuelles Unternehmen“ bezeichnet. Folgt man, wie die Mehrzahl der Autoren, der letzten Definition, dann ist zu klären wie sich diese Elemente in das Untersuchungsfeld einfügen.
Weitere Definitionen finden sich u. a. in Scholz, Byrne und Wolter[1] Ziel der Arbeit wird es sein, dem Leser zu verdeutlichen, wie in VU Vertrauen aufgebaut und dieses dann erfolgreich erhalten werden kann. Dazu wird in der Arbeit in Kapitel 3.1 zuerst auf traditionelle Absicherungskonstrukte von Unternehmen eingegangen. Der Punkt 3.2 zeigt welche Bedeutung V. in VU hat, wie dieses aufgebaut wird und das die Führungsautorität einen negativen Einfluss auf V. ausübt. In Kapitel 3.3 werden Punkte aufgeführt, wie sich das gewonnene Vertrauen erhalten lässt. Eine abschließende Zusammenfassung findet sich in Kapitel 4.
2. Begriffserklärung
Folgender Abschnitt versucht die Begriffe „virtuell“ „Unternehmen“ und „Vertrauen“ kurz und präzise zu beschreiben.
2.1 Virtuell
Virtuell beinhaltet den Aspekt, dass Attribute oder Funktionen einer Sache auftreten, die Sache selbst aber nicht real vorhanden ist. Diesen Aspekt greifen Davidow/Malone[2] auf, wenn sie virtuelle Produkte oder Dienstleistungen beschreiben: „The ideal virtual product of service is one that is produced instantaneously and customized in response to customer demand. It mostly exists even before it is produced. Its concept, design, and manufacture are stored in the minds of cooperating teams, in computers, and in flexible production lines.“ Im Zusammenhang von VU bedeutet "Virtuell" dabei, dass das interorganisationale Netzwerk nach außen als homogener und eigenständiger Marktpartner in Erscheinung tritt, real jedoch nicht als örtlich klar bestimmbares Unternehmen identifiziert werden kann ("Als -ob-Unternehmen").
2.2 Unternehmen
Gablers Wirtschaftslexikon definiert ein Unternehmen als eine örtlich nicht gebundene, wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit, in der auf nachhaltig ertragbringende Leistung gezielt wird. Wesensnotwendig ist die Tätigkeit eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, der oder die Geschäftspolitik einheitlich nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung bzw. größtmöglicher Rentabilität ausrichtet und entweder privates Eigentum oder das ihm oder ihr anvertraute Kapital der Unternehmung etwaiger Unternehmerwagnis aussetzt.[3]
2.3 Vertrauen
V. bezeichnet eine Erwartung eines V.gebers in die für ihn folgenreiche Handlungsweise eines Vertrauensnehmers, die enttäuscht werden kann. In wirtschaftlichen Beziehungen kommt V., bzw. eine entsprechende Reputation als vertrauenswürdiger Interaktionspartner, eine zunehmend wichtigere Rolle zu.
3. Vertrauen in virtuellen Unternehmen
3.1 Traditionelle Absicherung zwischen Unternehmen
Traditionelle Unternehmen haben sich aufgrund der Tatsache, dass Anstrengungen des Vertragspartners nicht beurteilbar oder versteckte Absichten des Vertragspartners zwangsläufig nicht sichtbar sind, mit formalen Vertragsabschlüssen abgesichert.[4] Es herrschte bei den Kooperationspartnern ein Absicherungsbedürfnis, dass umso höher war, je strategisch bedeutsamer und komplexer die zu erbringende Leistung ist. Die virtuelle Unternehmung verzichtet jedoch aufgrund ihres dynamischen Charakters weitgehend auf die vertragliche Absicherung. Beziehungsverträge und das damit verbundene Vertrauen stehen im Vordergrund. Das Vertrauen wird umso wichtiger, je mehr sich die Unternehmen untereinander vernetzen.
3.2 Aufbau von Vertrauen in virtuellen Unternehmen
3.2.1 Erfolgsvoraussetzungen für VU
Als Grundlage für den Erfolg von virtuellen Unternehmen lässt sich feststellen, dass das persönliche Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist. Aus Umfragen ist ersichtlich, dass Firmen niemals einem Netzwerk beitreten würden, virtuell oder wie auch immer, wenn sie nicht die Führungspersönlichkeiten des anderen Unternehmens persönlich kennen würden. In einem VU sollten keine Geheimnisse gegenüber den anderen existieren. Kernkompetenzen müssen zur Verfügung gestellt und der persönliche Kontakt gepflegt werden.
Im Projekt muss es das Ziel sein, mit allen beteiligten Partnern eine Gesamtkommunikation zu erreichen. Neben der Voraussetzung einer technischen muss auch der menschlichen Seite Zeit eingeräumt werden, um Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit zu schaffen.
3.2.2 Bedeutung von Vertrauen in virtuellen Unternehmen
Einer der Grundsätze virtueller Unternehmen ist der Verzicht auf formale, vertraglich einklagbare Absprachen. Damit es bei den Beteiligten nicht zu opportunistischem Verhalten kommt, sind planvolle Stabilisierungsmaßnahmen notwendig. Wenn die beteiligten Firmen zum Beispiel eine gemeinsame Wertvorstellung anstreben oder eine Vertrauenskultur aufbauen, können sie dieses Risiko senken. Dass Vertrauenskapital angestrebt wird, zeigt sich in zwei Punkten. Zum einem streben die Unternehmen einen guten Ruf an, zum anderen werden Faktoren gepflegt, die das Management von Vertrauenskapital begünstigen. Das dem Ansehen der Unternehmen ein großer Wert beigemessen wird, kann man daran sehen, dass die Unternehmen selbst dann eine Konsenslösung anstreben, wenn sie in einer rechtlich besseren Position dastehen. Die Arbeit an einem guten Ruf lässt sich als Darstellung der Unternehmensinternen Werte nach außen verstehen. Wenn ein Unternehmen eine sehr gute Qualität von Produkten und Leistungen bietet und zugesagte Leistungen immer einhält, Geschäftsbeziehungen zuverlässig abwickelt und für Kulanz und guten Stil bekannt ist, dann werden mögliche Partnerunternehmen diesem Unternehmen mehr Vertrauen entgegenbringen.
Das Management von Vertrauenskapital kann unter anderem durch kooperative Zusammenarbeit, durch die persönlichen Eigenschaften der Akteure und durch deren Motivation positiv beeinflusst werden. Ohne einer bestimmten Konsensbereitschaft und der damit verbundenen sozialen Kompetenz kann kaum Vertrauen bei potentiellen Partnern aufgebaut werden. Diese weichen Faktoren werden durch eine Untersuchung von Muskatewitz[5] belegt. In der Untersuchung zeigte sich, dass Mittelständische Unternehmen Persönlichkeitsentwicklung, Menschenführung und Kommunikation eine permanent sich erhöhende Bedeutung beimessen.
Laut Hand y[6] spielt Vertrauen bei diesen Kooperationsbeziehungen die Schlüsselrolle. Man sollte sich nicht den billigsten Partner, den mit der Kernkompetenz Nummer 1 einkaufen, sondern den wählen, zu dem ich eine irgendwie geartete Form von Vertrauensbeziehung habe oder aufgrund irgendwelcher Parameter (Nähe, gleiche Muttergesellschaft) aufbauen kann.
3.2.3 Vertrauenskultur der Firma TCG
In virtuellen Unternehmen spielt Vertrauen deshalb einen entscheidenden Faktor, da die vertragliche Absicherung fehlt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der generelle Aufbau von V. und gemeinsamen Werten und Normen zwischen Unternehmen durch langfristige Zusammenarbeit erreicht werden kann. Darum ist es notwendig, dass sich beide Partnerunternehmen an schriftlich dokumentierte und undokumentierte Regeln der Zusammenarbeit halten.
In dem Buch Mathews (1994) läßt sich eine Firma finden, die dieses Prinzip verfolgt. Die Firma TCG besteht aus insgesamt 24 mittelständischen Firmen die sich auf einem bestimmten EDV-Bereich spezialisiert haben. Wenn eine dieser Firmen einen Auftrag von außen bekommt, wird dieser mit Hilfe der Schwesterfirmen abgewickelt. Dabei kann man sich die interne Struktur von TCG in Form eines Netzwerkes vorstellen. Ein von außen kommender Betrachter sieht allerdings nur die Firma TCG. Um besonders erfolgreich zu sein, hat sich das sogenannte goverance structures durchgesetzt. Die entscheidenden Merkmale dieser „interorganizational goverance structure“ sind:[7]
1) Selbständigkeit der durch bilaterale Verträge koordinierten Netzwerkfirmen Dies schließt die Möglichkeit von Überkreuz-Kapitalbeteiligungen zwischen einzelnen Firmen des Netzwerkes nicht aus.
2) Schwesterfirmen beim Abschluß von Verträgen bevorzugen
[...]
[1] Scholz: Strukturkonzept (1994), 17, Byrne: Virtual (1993), 36, Wolter, Das virtuelle Unternehmen
[2] Davidow/Malone (1992), 4
[3] Gabler Wirtschafts -Lexikon: 2163
[4] Reichwald 1998, Seite 257
[5] Muskatewitz 1997, S. 135
[6] Handy 1995, S. 40-50
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Leseprobe zum Thema "Vertrauen in virtuellen Unternehmen"?
Diese Leseprobe bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Vertrauen in virtuellen Unternehmen (VU). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einführung, Begriffserklärungen (virtuell, Unternehmen, Vertrauen), detaillierte Kapitelzusammenfassungen zum Aufbau und Erhalt von Vertrauen in VU, sowie ein Abkürzungsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis.
Was sind die Schlüsselbegriffe, die in dieser Leseprobe definiert werden?
Die Leseprobe definiert die Begriffe "virtuell", "Unternehmen" und "Vertrauen". Dabei wird "virtuell" im Kontext von VU als ein Netzwerk beschrieben, das nach außen als homogener Marktpartner auftritt, aber real nicht als ein örtlich bestimmbares Unternehmen identifiziert werden kann. "Unternehmen" wird als eine wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit definiert, die auf nachhaltig ertragbringende Leistung abzielt. "Vertrauen" wird als eine Erwartung des Vertrauensgebers in das Handeln des Vertrauensnehmers beschrieben, die enttäuscht werden kann.
Wie wird Vertrauen in virtuellen Unternehmen aufgebaut?
Der Aufbau von Vertrauen in VU wird durch persönliche Beziehungen, offene Kommunikation, das Teilen von Kernkompetenzen und das Pflegen persönlicher Kontakte gefördert. Es wird hervorgehoben, dass Firmen Netzwerken nur beitreten, wenn sie die Führungspersönlichkeiten der anderen Unternehmen persönlich kennen. Gemeinsame Werte und eine Vertrauenskultur sind ebenfalls entscheidend.
Welche Rolle spielt Vertrauen im Vergleich zu traditionellen Absicherungsmechanismen in VU?
Die Leseprobe argumentiert, dass VU aufgrund ihres dynamischen Charakters weitgehend auf vertragliche Absicherungen verzichten. Stattdessen stehen Beziehungsverträge und das damit verbundene Vertrauen im Vordergrund. Je stärker Unternehmen untereinander vernetzt sind, desto wichtiger wird Vertrauen.
Wie lässt sich aufgebautes Vertrauen in VU erhalten?
Der Erhalt von Vertrauen wird durch die Pflege des aufgebauten Vertrauens, den Verzicht auf Missbrauch gewonnener Daten und das Einhalten schriftlich dokumentierter und undokumentierter Regeln der Zusammenarbeit gewährleistet. Ein guter Ruf und die Darstellung unternehmensinterner Werte nach außen tragen ebenfalls dazu bei.
Was ist das Beispiel der Firma TCG und welche Rolle spielt es in Bezug auf Vertrauen?
Die Firma TCG, ein Netzwerk aus mittelständischen EDV-Firmen, dient als Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung von Vertrauen in virtuellen Unternehmen. Die Struktur des Netzwerks, die Bevorzugung von Schwesterfirmen bei Vertragsabschlüssen und die kooperative Zusammenarbeit tragen zur Vertrauensbildung und zum langfristigen Erfolg bei.
Welche Hindernisse gibt es, die gegen alleiniges Vertrauen in VU sprechen?
Die Leseprobe erwähnt auch Hindernisse, die gegen alleiniges Vertrauen sprechen, geht aber nicht detailliert darauf ein. Es wird impliziert, dass eine gewisse Absicherung, ergänzend zum Vertrauen, dennoch notwendig sein kann.
Welche Faktoren beeinflussen das Management von Vertrauenskapital positiv?
Das Management von Vertrauenskapital wird positiv durch kooperative Zusammenarbeit, die persönlichen Eigenschaften der Akteure und deren Motivation beeinflusst. Soziale Kompetenz und Konsensbereitschaft sind essentiell für den Aufbau von Vertrauen.
- Arbeit zitieren
- Dirk Niedfeld (Autor:in), 2001, Aufbau und Erhalt von Vertrauen in virtuellen Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103622