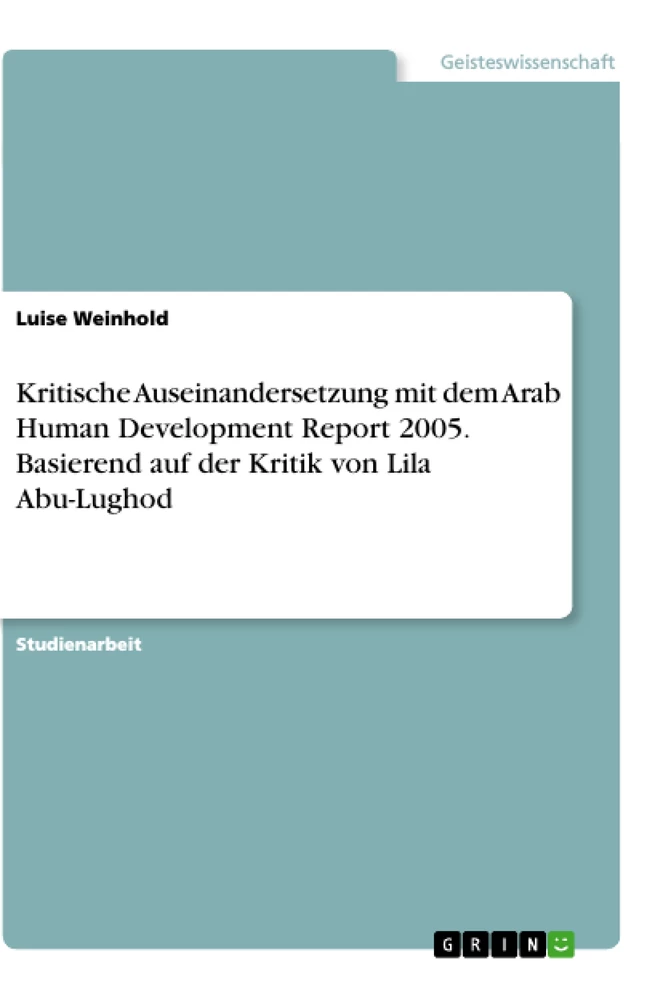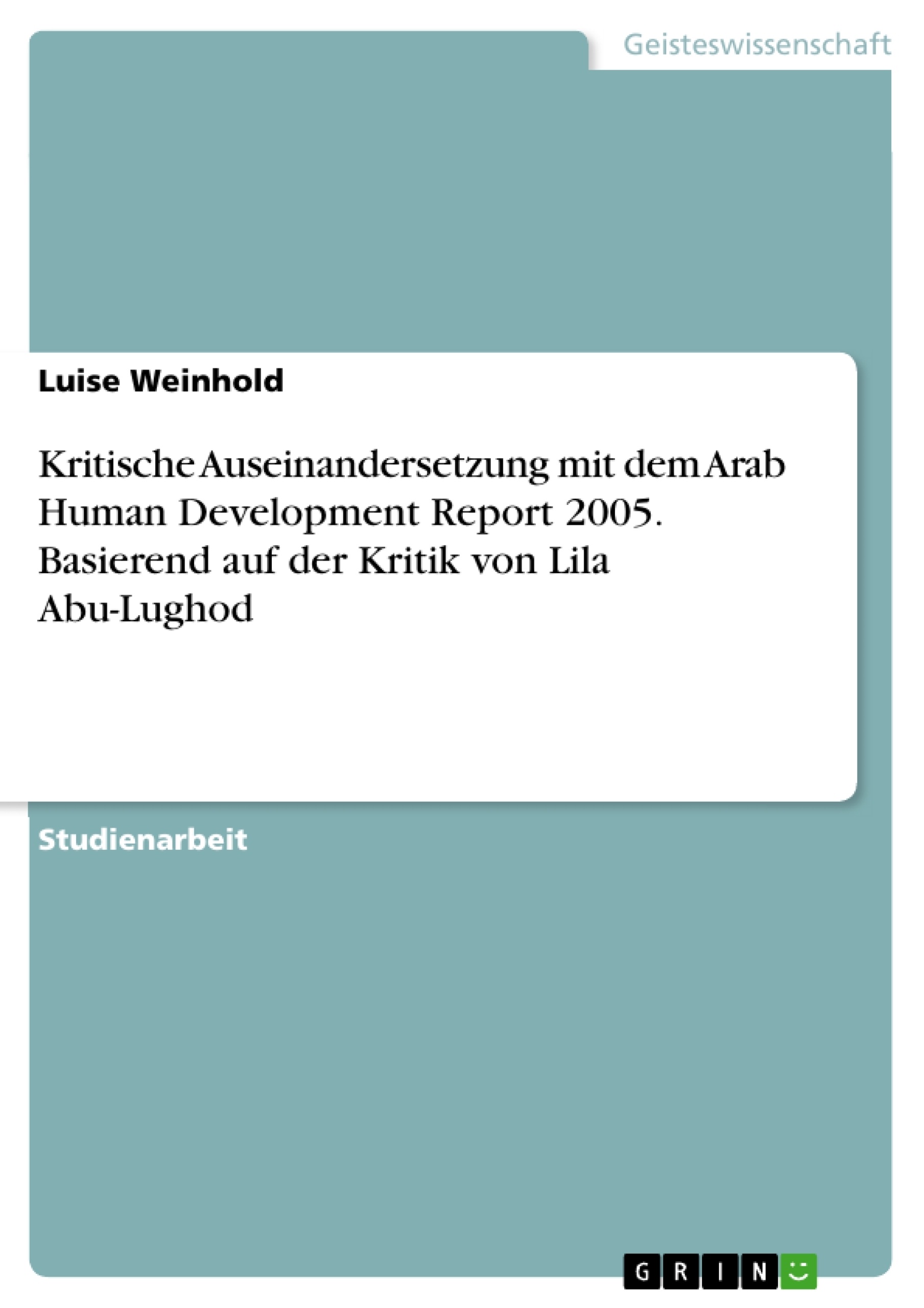Diese Arbeit basiert auf einem Referat von 2015 über "Dialects of Women's Empowerment: The International Circuitry of the Arab Human Development Report 2005" von der Anthropologin Lila Abu-Lughod. Die Autorin beschäftigte sich u. a. damit, wie internationale Diskurse zu Frauenrechten die Wahrnehmung der Situation arabischer Frauen verzerren und Stereotypen füttern. Um ihre Argumente nachvollziehbar zu machen, werde ich zuerst auf den von ihr untersuchten Arab Human Development Report eingehen und danach relevante Details über Lila Abu-Lughods Person kurz vorstellen.
Danach folgt der wesentliche Teil meiner Arbeit, in dem ich Abu-Lughods Kritikpunkte erläutere und versuche, mit anderen Quellen abzugleichen. Dazu habe ich mich weiterer Literatur über die Demokratisierung im Nahen Osten und über arabische und muslimische Frauen bedient. Ziel ist es, im Abschlussteil der Arbeit ein Fazit ziehen zu können, welche Probleme sich bei der Einschätzung der Frauenrechtslage arabischer Staaten ergeben, die in der weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema beachtet werden müssen.
In den letzten Jahrzehnten wurden Frauenrechte von viele Initiativen und politischen Bewegungen erfolgreich als Teil der universellen Menschenrechte anerkannt. Doch die Bemühungen um die Verwirklichung von Frauenrechten lassen sich kontrovers diskutieren, besonders, wenn die Durchsetzung in anderen Ländern durch westliche Interessengruppen nicht auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist und imperialistische und eurozentristische Ansichten transportiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Arab Human Development Report
3. Über Lila Abu-Lughod
4. Kritik am AHDR
4.1 Internationales Feld
4.2 Mittelschichtsperspektive
4.3 Internationale Sprache
5. Abschluss
6. Quellen
6.1 Printquellen
6.2 Internetquellen
1. Einleitung
In den letzten Jahrzehnten wurden Frauenrechte von viele Initiativen und politischen Bewegungen erfolgreich als Teil der universellen Menschenrechte anerkannt (vgl. Abu-Lughod 2009:83). Doch die Bemühungen um die Verwirklichung von Frauenrechten lassen sich kontrovers diskutieren, besonders, wenn die Durchsetzung in anderen Ländern durch westliche Interessengruppen nicht auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist und imperialistische und eurozentristische Ansichten transportiert werden. Im konkreten Fall wird es um die Einschätzung der Frauenrechtslage arabischer Staaten gehen, die zwar durch arabische Intellektuelle und AktivistInnen vorgenommen wurde, doch auch diese sind nicht frei von internationalen Diskursen, die AraberInnen marginalisieren.
Diese Arbeit basiert auf einem Referat, das ich im Wintersemester 2014/2014 im Seminar "Geschlecht und Recht in Palästina" bei Prof. Dr. Irene Schneider hielt. In dem Referat präsentierte ich den Text "Dialects of Women's Empowerment: The International Circuitry of the Arab Human Development Report 2005" von Lila Abu-Lughod. Die Autorin beschäftigte sich u.a. damit, wie internationale Diskurse zu Frauenrechten die Wahrnehmung der Situation arabischer Frauen verzerren und Stereotypen füttern. Um ihre Argumente nachvollziehbar zu machen, werde ich zuerst auf den von ihr untersuchten Arab Human Development Report eingehen und danach relevante Details über Lila Abu-Lughods Person kurz vorstellen. Danach folgt der wesentliche Teil meiner Arbeit, in dem ich Abu-Lughods Kritikpunkte erläutere und versuche, mit anderen Quellen abzugleichen. Dazu habe ich mich weiterer Literatur über die Demokratisierung im Nahen Osten und über arabische und muslimische Frauen bedient. Ziel ist es, im Abschlussteil der Arbeit ein Fazit ziehen zu können, welche Probleme sich bei der Einschätzung der Frauenrechtslage arabischer Staaten ergeben, die in der weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema beachtet werden müssen.
2. Der Arab Human Development Report
Der Arab Human Development Report, kurz AHDR, ist vom United Nations Development Programme initiiert und in Kooperation mit Regierungen und der Zivilgesellschaft der Region entstanden. Ziel der Berichte ist es, Einigkeit betreffend der Prioritäten regionaler und nationaler Entwicklung zu erzeugen, benachteiligte Gruppen zu identifizieren und Strategien zu deren Stärkung (Empowerment) vorzuschlagen. Sie sollen als Instrument zur Messung menschlichen Fortschritts dienen und die gewonnenen Daten flossen in die Global Human Development Reports ein.
Bisher erschienen ist die erste Serie, bestehend aus "Opportunities" im Jahr 2002, "Knowledge" im Jahr 2003, "Freedom" im Jahr 2004 und zuletzt "Gender" im Jahr 2005. Die Serie bildet eine Einheit: die im ersten Report "Opportunities" aufgezeigten Defizite werden in den folgenden Berichten (2003 - 2005) weiter ausgeführt, um Zukunftsvisionen zu ihrer Bewältigung zu liefern.
Eine zweite Serie wurde 2009 mit Human Security begonnen. Diese soll sich den "drängende Herausforderungen" im arabischen Raum widmen, wird aber nicht Thema dieser Arbeit sein.
Von zentralem Interesse ist der Bericht von 2005 - dessen kompletter Titel Towards the Rise of Women in the Arab World lautet -, da dieser von Lila Abu-Lughod kritisch beleuchtet wurde. Ihr Artikel liefert die Grundstruktur dieser Arbeit. Anzumerken ist, dass die kollektive Autorenschaft arabischer Eliten bzw. ExpertInnen zu multiplen und manchmal widersprüchlichen Stimmen führt (Abu-Lughod 2009: 84) und deshalb sind hier aufgeführte Argumente eventuell nicht für alle Teile des Berichts gültig.
3. Über Lila Abu-Lughod
Lila Abu-Lughod ist Professorin für Anthropology und Women's/Gender Studies an der Columbia University in New York (Department of Anthropology 2015). Ihr regionaler Schwerpunkt ist der arabische Raum (ebd.). U.a. wurde sie bekannt für ihre Feldforschung bei den Awlad 'Ali Beduinen in Ägypten (ebd.). Ein Blick in ihre Bibliographie zeigt, dass sie sich auch in anderen Arbeiten mit der Situation arabischer Frauen auseinandergesetzt hat, zum Beispiel in ihren Büchern "Do Muslim Women Need Saving?" und "Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East" (ebd.).
Sie hat sich dem AHDR gewidmet, gerade weil ihr das Thema am Herzen liegt und sie sich durch ihre Kritik an der Debatte um Frauenrechte in arabischen Staaten beteiligen möchte (vgl. Abu-Lughod 2009: 83f.).
4. Kritik am AHDR
Während Abu-Lughod die Absichten und bestimmte Teile des Berichts gutheißt (z.B. Verknüpfung der Förderung von Frauen mit dem von Männern und Gesellschaft als Ganzes, Verdammung des Missbrauchs internationaler Hausangestellter, vgl. Abu-Lughod 2009: 84), erscheinen ihr drei Aspekte problematisch:
Erstens das internationale Feld, das von Ungleichheit und Feindseligkeit geprägt sei (Abu-Lughod 2009: 84), u.a. durch internationale Diskurse, die die arabische Welt als rückständig betrachten und weil arabische Staaten in keinem partnerschaftlichen Verhältnis zu Geberländern stehen, sondern als Empfänger von internationalen Spenden die Bedingungen der SponsorInnen erfüllen sollen.
Zweitens die kosmopolitische oder urbane Mittelschichtsperspektive auf den Alltag von Frauen, ihre Erwartungen und alltäglichen Lebensbedingungen (Abu-Lughod 2009: 85). Dabei wird ein westlicher Maßstab zur Bewertung von Lebensqualität und Würde angelegt, der zum einen nicht zwangsläufig die Bedürfnisse im arabischen Raum trifft und zum anderen selbst im Westen nicht einheitlich positiv bewertet wird und zu ungültigen Verallgemeinerungen führt.
Drittens die besondere internationale Sprache der Frauenrechte mit den dominanten politischen Paradigmen der Modernisierung, menschlichen Entwicklung (human development) und des Neoliberalismus (Abu-Lughod 2009: 85). Die betreffende Geisteshaltung ist ideologisch verzerrt und deshalb umstritten. Deshalb ist auch hier eine kritische Reflexion nötig.
Diese drei Aspekte werden in den folgenden Abschnitten einzeln untersucht und mit Informationen weiterer Quellen ergänzt.
4.1 Internationales Feld
Lila Abu-Lughod ist der Ansicht, dass der Bericht beeinflusst vom internationalen Feld, welches durch Ungleichheit und Feindseligkeit geprägt sei, entstand. Sie bemerkt, dass sich im ADHR westliche Ideen zur Frauenbefreiung und orientalistische Repräsentationen widerspiegelten (Abu-Lughod 2009: 85). Weiterhin bestätige er die Vorurteile einer "krankhaften" arabischen Geschlechterkultur und angenommenen arabischen Rückständigkeit (ebd.). Durch das Fehlen einer vergleichenden Perspektive erzeuge er den Eindruck, dass in anderen Teilen der Welt die Geschlechtergleichheit bereits erreicht sei (ebd.). AraberInnen erscheinten als homogenisierte Gruppe, aber Abu-Lughod erinnert daran, dass je nach Staat deutliche Unterschiede der Frauenrechtslage gefunden werden könnten. Beispielsweise ist der Frauenanteil in den Parlamenten Tunesiens und des Irak höher als in den USA (ebd.). Birgitte Rahbek verweist in einem anderen Text auf eine Umfrage, nach der prozentual mehr AraberInnen der Demokratie vor anderen politischen Systemen Vorrang geben als dies bei der Bevölkerung in vielen europäischen Ländern, den USA, Australien und Neuseeland der Fall sei (Rahbek 2005:7f.). Manche Frauenrechtsdefizite sind in arabischen Ländern deutlich seltener als in anderen Teilen der Welt, wie AIDS oder Essstörungen (Abu-Lughod 2009: 86). Der starke Fokus auf Kultur, der Geschichte und Politik ignoriert, trage zum "Othering" von Minderheiten bei (ebd.), weil Faktoren, die die Menschen in ihre aktuelle Lage brachten, ausgeblendet würden und sie als statisch und grundsätzlich verschieden von EuropäerInnen erschienen. Die Kultur erscheine als das trennende Merkmal, dabei entspräche dies nicht zwangsläufig der Wahrheit. All diese Punkte werden von Abu-Lughod als ein unglückliches Zusammenspiel feministischer Belange und politischer und ideologischer Agenda bei AHDR zusammengefasst (ebd.). Dies trage zum Stereotyp der unterdrückten Muslimin bei, die unter einer einzigartigen patriarchalen Sozialhierarchie leide (Abu-Lughod 2009: 87). Dieses Bild gerät ins Wanken durch die zahlreichen Beispiele "rebellischer" Frauen, die Abu-Lughod durch ihre Forschung anbringen kann, u.a. von Frauen, die sich gegen eine arrangierte Ehe erfolgreich wehrten - und dies sogar mit der Sharia rechtfertigten (Abu-Lughod 2013: 210f.).
Mit der angesprochenen Feindseligkeit hat sich auch Nielsen in Form der Islamophobie in Europa befasst. Obwohl der Islam in einigen Teilen Europas bereits seit hunderten Jahren vertreten sei, habe er sich vor allem nach Ende des Kaltes Krieges als neues Feindbild herauskristallisiert (vgl. Nielsen 2005: 152f.). Die fehlgeschlagene Politik zur sozialen Inklusion von MigrantInnen und religiösen Gruppen trüge zu einer ablehnenden Haltung MuslimInnen gegenüber bei (vgl. Nielsen 2005: 154). Huntingdons Idee eines "Kampfes der Kulturen" stelle das christliche Europa dem islamischen Nahen Osten als rivalisierend und feindlich gegenüber (vgl. Nielsen 2005: 156). Hierbei werden ebenfalls Geschichte und Politik ignoriert und die Unterschiede zwischen Westen und Nahem Osten auf einzig kulturelle Basis gestellt, wie es auch Abu-Lughod kritisierte. Geschichtlich wird beispielsweise ausgeblendet, dass Menschen seit jeher migrieren, reisen und damit Austausch zwischen Menschen verschiedener Religionsangehörigkeit und Ethnizität stattfand (vgl. Nielsen 2005: 160).
Ein weiteres Beispiel ist, dass der Westen sich in der Geschichte mehrfach dafür entschied, autoritäre Herrscher im Nahen Osten zu unterstützen und demokratische Bestrebungen nicht zu unterstützen (Rabbani 2005: 101) und somit eine Mitverantwortung für die politische Lage im Nahen Osten trägt. Rabbani geht sogar so weit, in der Entwicklungshilfe eine neue Form des Kolonialismus zu erkennen (Rabbani 2005: 105). Die arabisch-westlichen Beziehungen wären beiderseitig von Missverständnissen und Stereotypen geprägt (Rabbani 2005: 104), was eine partnerschaftliche Zusammenarbeit behindere. Die Beschwörung von grausamen Details der vermeintlichen "muslimischen Kultur" wie Ehrenmorde würde dazu dienen, um Kriegsführung, Xenophobie zu entfachen und Entwicklungshilfe als lukratives Geschäft zu nutzen (Abu-Lughod 2013: 226). Dies führe beispielsweise auch dazu, dass palästinensische Organisationen sinnlose Projekte erschufen, nur um Spendengelder vom Westen zu erhalten, statt bedarfsgerechte Projekte aufzubauen, die aber nicht auf Spendenbereitschaft beim Westens träfen (Rabbani 2005: 106).
Der Journalist Graham Usher empfiehlt, zwischen zwei Auffassungen von Demokratie zu unterscheiden:
"democracy as a vehicle of imposed reform and neo-colonial containment versus democracy as an instrument for popular empowerment and national liberation" (Rahbek 2005:12)
Alle AutorInnen befürworten die zweite Auffassung und warnen vor den Auswirkungen der ersten, die mit den von Lila Abu-Lughod herausgearbeiteten Aspekten einhergehen.
4.2 Mittelschichtsperspektive
Der ADHR identifiziert drei Schlüssel zu Frauenförderung: Bildung, Lohnarbeit und individuelle Rechte (Abu-Lughod 2009: 87). Lila Abu-Lughod arbeitete die Mängel dieses Ansatzes heraus. So weist sie beim Punkt Bildung darauf hin, dass statt fehlender Bildungsmöglichkeiten die schlechte Qualität der Schulbildung und hohe Kosten das Problem sein könnten (ebd.). Sie kritisiert außerdem die Abwertung Ungebildeter, da auch ungeschulte Menschen wie Analphabetinnen kreativ sein könnten und über Fachwissen verfügten (Abu-Lughod 2009: 87f.). Dies konnte sie in ihrer eigenen Feldforschung bei den Beduinen beobachten, wo Frauen zwar Analphabetinnen sind, trotzdem aber Geschichten erzählten und Gedichte mündlich verfassten (Abu-Lughod 2009: 88).
Zum Schlüssel Berufstätigkeit wendet Lila Abu-Lughod ein, dass es nicht unbedingt ökonomisch sinnvoll ist, einer Lohnarbeit nachzugehen, da auch Hausarbeit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Familie leiste und bei Vollzeitbeschäftigung eventuell nicht genug Zeit dafür bliebe (ebd.). Unbezahlte Pflegetätigkeiten würden im Bericht nicht ausreichend gewürdigt (ebd.). Da oft Frauen diese unbezahlte Arbeit leisten, sei es wichtig, den ökonomischen Beitrag von Frauen anders als den lohnarbeitender Männer zu würdigen (ebd.). Letztlich sei auch Lohnarbeit nicht zwangsläufig befreiend, sondern kann auch ausbeuterisch sein (Abu-Lughod 2009: 89) und damit gegen die Menschenwürde verstoßen.
Interessant ist nebenbei, dass Umfragen ergaben, dass die Mehrheit der AraberInnen die Gleichstellung von Frauen und Männern im Hinblick auf Bildung, politischer Mitbestimmung und Berufstätigkeit befürworten (Arab Human Development Reports 2005: 7ff.). Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit künftige Bemühungen zur Stärkung der Frauenrechte wohlwollend aufgenommen werden und soziale Veränderungen verwirklicht werden können.
Beim letzten Schlüssel, den individuellen Rechten, vermutet Lila Abu-Lughod eine Abwertung der Familienbande (Abu-Lughod 2009: 90), welche zu einer gemeinsamen bzw. nicht unabhängigen Entscheidungsfindung führen. Frauen würden durch eine emotionale Bindung an ihre Familie (ebd.) oft auf persönliche Unabhängigkeit verzichten, was nicht nur negativ, sondern auch positiv interpretiert werden könne. In einem anderen Buch meint Abu-Lughod, dass die Leben von Menschen so komplex seien, dass freier und vollständiger Konsens als Fiktion erscheinen (Abu-Lughod 2013: 208) und Teil einer "starken Fantasy von Autonomie" des Westens sei (Abu-Lughod 2013: 217). Zum Mensch-Sein gehöre die Sozialisation innerhalb von Familien und Gemeinschaften dazu (Abu-Lughod 2013: 218). Es müsse berücksichtigt werden, dass auf viele AraberInnen die Vereinzelung des Individuums sowie der Verlust der Unterstützung durch die Familie abschreckend wirke und nicht angestrebt werde (Abu-Lughod 2009: 90). Im Bericht selbst wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise eine Trennung der Familie durch politische Konflikte das Leben aller Familienmitglieder erschwert, aber es Frauen besonders schwer träfe und sie generell besonders unter schlechten humanitären Zuständen litten, ob nun während militärischer Angriffe, auf der Flucht oder bei der Migration (Arab Human Development Reports 2005: 3f.), somit die Familie auch Schutz bedeute und das Überleben von Frauen sichere. Des Weiteren wendet Abu-Lughod ein, dass auch im individualisierten Westen Geschlechterungleichheit fortbestehe und die Umsetzung individueller Rechte somit keine Geschlechtergleichheit garantiere (Abu-Lughod 2009: 90).
4.3 Internationale Sprache
Die internationale Sprache bzw. der internationale Dialekt ist nach Lila Abu-Lughod durch die dominanten politischen Paradigmen Modernisierung, Entwicklung und Neo-Liberalismus gekennzeichnet. Und das, obwohl Neo-Liberalismus dazu tendiere - wie uns Yezid Sayigh erinnert -, demokratische Prozesse zu unterminieren (Rahbek 2005:11). Nach Sally Engle Merry weist Abu-Lughod darauf hin, dass die international language of women's rights kulturell sei und säkulare globale Modernität, basierend auf Autonomie, Individualismus, Gleichheit schätze (Abu-Lughod 2009: 84).
Diese Paradigmen lassen sich auch bei Nader Fergany, einem Mitautoren des AHDR, finden (vgl. Fergany 2005: 25).
Weiterhin kritisiert Abu-Lughod, die einseitigen, reformistischen Lösungsansätze im Bericht (Abu-Lughod 2009: 91) und dass Ursachen für Probleme auf kulturelle und soziale Faktoren reduziert würden, die Politik, Religion und Ökonomie außer Acht ließen. Beispielsweise wird die Förderung der Zivilgesellschaft empfohlen, aber keine Neuverteilung des Reichtums (ebd.). Es seien neoliberale Diskurse über strukturelle Anpassung und globale Märkte dominant, während gleichzeitig nur wenige Forderungen an den Staat gestellt würden (Abu-Lughod 2009: 92).
Außerdem beurteilt Abu-Lughod die feministische Agenda der globalisierten Elite als zu wenig bedürfnisorientiert (vgl. Abu-Lughod 2009: 94). Auch SpenderInnen aus dem Westen wären oft nicht in der Lage, die Situation vor Ort gut einzuschätzen und beispielsweise realistische Zeitrahmen aufzustellen, die sich mit den lokalen Bedürfnissen vertragen (Rabbani 2005: 107). Oft würden westliche ExpertInnen in Regionen geschickt, über die sie nicht genug Wissen haben (Rabbani 2005: 108), um konstruktive Vorschläge erstellen zu können.
Dem arabischem Raum würden die negativ konnotierten Seiten binärer Gegensätze zugeordnet, wie sie in Tradition-Moderne oder Fortschritt-Rückständigkeit vorkommen (Abu-Lughod 2009: 95). Dem könnte mit einer vergleichenden Perspektive entgegengewirkt werden, die in mehreren Teilen der Welt differenziert die Errungenschaften und Mängel hinsichtlich der menschlichen Entwicklung aufzeige.
Feminismus und Religion erscheinen ebenfalls gegensätzlich, wobei Ansätze, die diese Themenfelder verbinden, wie der islamischer Feminismus, kaum Beachtung fanden (Abu-Lughod 2009: 96f.). Lila Abu-Lughod weiß von Fällen, wo Mädchen Wissen aus ihrem Religionsunterricht nutzten, um für ihre Rechte einzutreten (Abu-Lughod 2013: 210f.).
Lila Abu-Lughod gibt weiter zu bedenken, dass Menschenwürde und Moralvorstellungen oft mit religiösen Vorstellungen eng verbunden seien (Abu-Lughod 2009: 97) und deswegen von vielen AraberInnen eine säkulare Sicht nicht angestrebt werde. Für einen der Hauptverantwortlichen des AHDR, Nader Fergany, sollten Demokratie und Islam nicht als an sich widersprüchlich betrachtet werden, sondern eine liberale Interpretation des Islam gefördert werden, die in Einklang mit demokratischen Entwicklungen und Menschenrechtskonventionen steht (vgl. Fergany 2005: 29).
5. Abschluss
Zusammenfassend lässt sich Abu-Lughods Einschätzung zustimmen:
"The report (...) is nevertheless caught up in a specific set of international institutions and networks and deploys a particular transnational language, with problematic implications and uncertain effects." (Abu-Lughod 2009: 98)
Ohne die Intentionen oder Inhalte des Berichts verwerfen zu wollen, trägt die Art der Auseinandersetzung mit Frauenrechten in arabischen Staaten zu einer Bestätigung der Rückständigkeit und Schönfärbung politischer Paradigmen bei, ohne deren Schattenseiten darzustellen. Es kommt zu einer Marginalisierung innerhalb der arabischen Welt durch einen einseitigen Fokus auf Kultur. Alle drei Aspekte klingen plausibel und werden sich hoffentlich in künftigen AHDR nicht oder nicht mehr so stark wiederfinden.
Weiterhin finde ich Hanan Rabbanis Ansatz bestechend, dass Frauenrechte im sozialen Kontext betrachtet werden müssen und sich nur innerhalb einer Gesellschaft verwirklichen lassen, die als Ganzes Menschenrechte achtet (Rabbani 2005: 109). Im Bericht steht geschrieben, dass bisher nur wenige NGOs die Stärkung von Frauenrechten als kollektives Ziel der Gesellschaft als Ganzes einstuften (Arab Human Development Reports 2005: 5). Es muss daran gearbeitet werden, dass die Konzepte von Frauen- und Menschenrechten im Nahen Osten nicht weiter als ein fremder Diskurs und erzwungen erscheinen (vgl. Rabbani 2005: 110). Dabei ist es heutzutage kaum noch möglich, lokale und fremde Ansichten eindeutig zu trennen und statt nur ein Auge auf die negativen Aspekte der arabisch-westlichen Beziehungen zu haben, sollten auch die weitgehend förderliche Zusammenarbeit Beachtung finden (vgl. Arab Human Development Reports 2005: 6). Eine partnerschaftliche Beziehung zwischen westlichen und arabischen Gruppen könnte dazu beitragen, dass die Bereitschaft an Menschenrechtsdefiziten zu arbeiten steigt und auch mit realistischen Zielsetzungen angegangen wird. Dies könnte tatsächlich zur im Bericht angestrebten human renaissance im arabischen Raum, die sich durch eine free society und good governance ausgezeichnet führen (vgl. Arab Human Development Reports 2005: 3f.).
6. Quellen
6.1 Printquellen
Abu-Lughod, Lila (2009): Dialects of Women's Empowerment: The International Circuitry of the Arab Human Development Report 2005. Cambridge University Press, Cambridge.
Abu-Lughod, Lila (2013): Do Muslim Women Need Saving? Harvard University Press, Cambridge, Massechusetts & London, England.
Fergany, Nander (2005): The UNDP's Arab Human Development Reports and their readings. In: Rahbek, Birgitte (Hrsg.): Democratisation in the Middle East. Dilemmas and Perspectives. Aarhus University Press, Gylling. S. 19 - 30.
Nielsen, Jørgen S. (2005): Islamophobia in Europe and its impact on the push for democratisation in the Arab world. In: Rahbek, Birgitte (Hrsg.): Democratisation in the Middle East. Dilemmas and Perspectives. Aarhus University Press, Gylling. S. 151 - 163.
Rabbani, Hanan (2005): A Palestinian view on the role of Western NGOs in promoting democracy and especially women's rights in the Middle East. In: Rahbek, Birgitte (Hrsg.): Democratisation in the Middle East. Dilemmas and Perspectives. Aarhus University Press, Gylling. S. 101 - 111.
Rahbek, Birgitte (2005): Introduction. Dilemmas of democratisation in the Middle East. In: Rahbek, Birgitte (Hrsg.): Democratisation in the Middle East. Dilemmas and Perspectives. Aarhus University Press, Gylling. S. 7 - 17.
6.2 Internetquellen
Arab Human Development Reports (2005): Executive Summary. Online abrufbar unter: http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=4 [Stand 25.03.2015]
Department of Anthropology (o.J.): Lila Abu-Lughod. Online abrufbar unter: http://anthropology.columbia.edu/people/profile/347 [Stand 29.03.2015]
Rahbek, Birgitte (Hrsg.): Democratisation in the Middle East. Dilemmas and Perspectives. Aarhus University Press, Gylling. Online abrufbar unter: http://www.oapen.org/search?identifier=354992 [Stand 26.03.2015]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit basiert auf einem Referat über den Text "Dialects of Women's Empowerment: The International Circuitry of the Arab Human Development Report 2005" von Lila Abu-Lughod. Sie beschäftigt sich damit, wie internationale Diskurse zu Frauenrechten die Wahrnehmung der Situation arabischer Frauen verzerren und Stereotypen füttern.
Was ist der Arab Human Development Report (AHDR)?
Der AHDR ist eine Berichtsserie des United Nations Development Programme in Kooperation mit Regierungen und Zivilgesellschaft der arabischen Region. Ziel ist es, Prioritäten für regionale und nationale Entwicklung zu definieren, benachteiligte Gruppen zu identifizieren und Strategien zu deren Stärkung vorzuschlagen.
Welche Berichte der AHDR-Serie sind relevant?
Die erste Serie, bestehend aus "Opportunities" (2002), "Knowledge" (2003), "Freedom" (2004) und "Gender" (2005) sind relevant. Besonders wichtig ist der Bericht von 2005, "Towards the Rise of Women in the Arab World", da dieser von Lila Abu-Lughod kritisch beleuchtet wird.
Wer ist Lila Abu-Lughod?
Lila Abu-Lughod ist Professorin für Anthropology und Women's/Gender Studies an der Columbia University in New York. Ihr regionaler Schwerpunkt ist der arabische Raum. Sie ist bekannt für ihre Forschung über arabische Frauen und ihre Kritik an Debatten über Frauenrechte in arabischen Staaten.
Welche Kritikpunkte äußert Abu-Lughod am AHDR?
Abu-Lughod kritisiert drei Aspekte: das internationale Feld, das von Ungleichheit und Feindseligkeit geprägt sei; die kosmopolitische Mittelschichtsperspektive auf den Alltag von Frauen; und die internationale Sprache der Frauenrechte mit den Paradigmen der Modernisierung, menschlichen Entwicklung und des Neoliberalismus.
Was meint Abu-Lughod mit dem "internationalen Feld"?
Sie argumentiert, dass der Bericht von westlichen Ideen zur Frauenbefreiung und orientalistischen Repräsentationen beeinflusst ist und Vorurteile über eine "krankhafte" arabische Geschlechterkultur bestätigt. Sie kritisiert das Fehlen einer vergleichenden Perspektive und die Homogenisierung der arabischen Welt.
Was versteht Abu-Lughod unter der Mittelschichtsperspektive?
Sie bemängelt, dass der Bericht einen westlichen Maßstab zur Bewertung von Lebensqualität und Würde anlegt und dabei die tatsächlichen Bedürfnisse und Lebensbedingungen arabischer Frauen außer Acht lässt. Sie kritisiert die Abwertung ungebildeter Frauen und die unkritische Verherrlichung von Lohnarbeit.
Was ist das Problem mit der "internationalen Sprache" der Frauenrechte?
Abu-Lughod kritisiert, dass die Paradigmen Modernisierung, Entwicklung und Neoliberalismus einseitige, reformistische Lösungsansätze fördern und kulturelle Faktoren über politische, religiöse und ökonomische Ursachen von Problemen stellen. Sie bemängelt die fehlende Bedürfnisorientierung und die gegensätzliche Darstellung von Feminismus und Religion.
Welche Schlüssel zur Frauenförderung werden im AHDR genannt und wie kritisiert Abu-Lughod diese?
Der AHDR nennt Bildung, Lohnarbeit und individuelle Rechte als Schlüssel. Abu-Lughod kritisiert, dass statt fehlender Bildungsmöglichkeiten die schlechte Qualität der Schulbildung und hohe Kosten das Problem sein könnten, dass die Abwertung Ungebildeter stattfindet, dass eine Lohnarbeit nicht unbedingt ökonomisch sinnvoll ist und dass die Familienbande abgewertet werden.
Welchen Ansatz zur Förderung von Frauenrechten befürwortet Abu-Lughod?
Abu-Lughod befürwortet einen Ansatz, der Frauenrechte im sozialen Kontext betrachtet und sie nur innerhalb einer Gesellschaft verwirklichen lässt, die als Ganzes Menschenrechte achtet. Sie plädiert für eine partnerschaftliche Beziehung zwischen westlichen und arabischen Gruppen und eine realistische Zielsetzung bei der Bekämpfung von Menschenrechtsdefiziten.
- Arbeit zitieren
- Luise Weinhold (Autor:in), 2015, Kritische Auseinandersetzung mit dem Arab Human Development Report 2005. Basierend auf der Kritik von Lila Abu-Lughod, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1036026