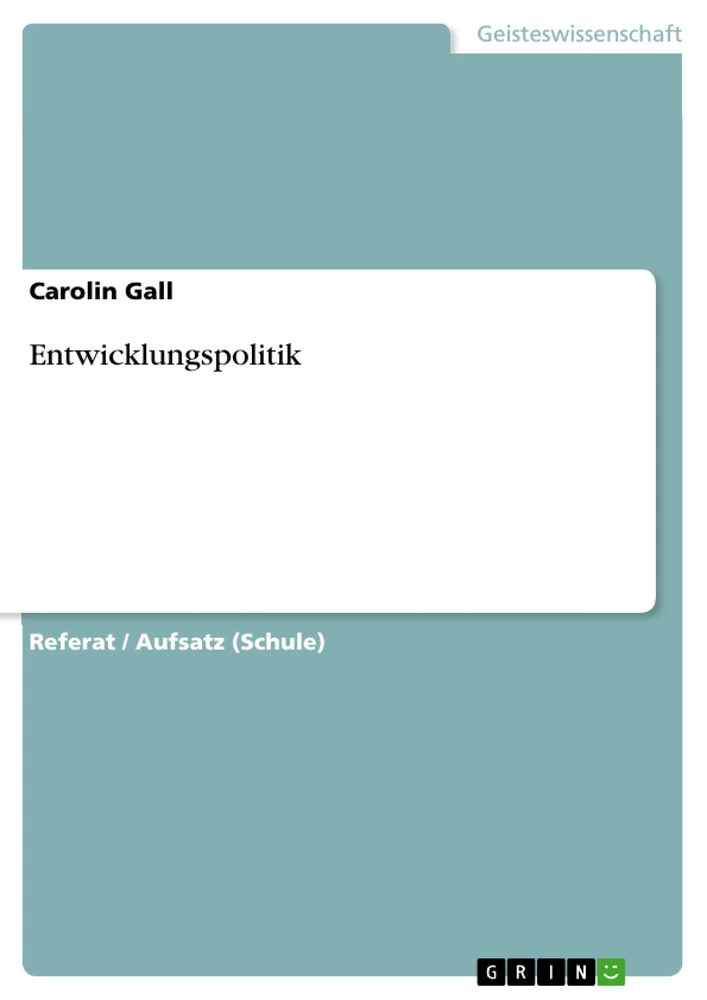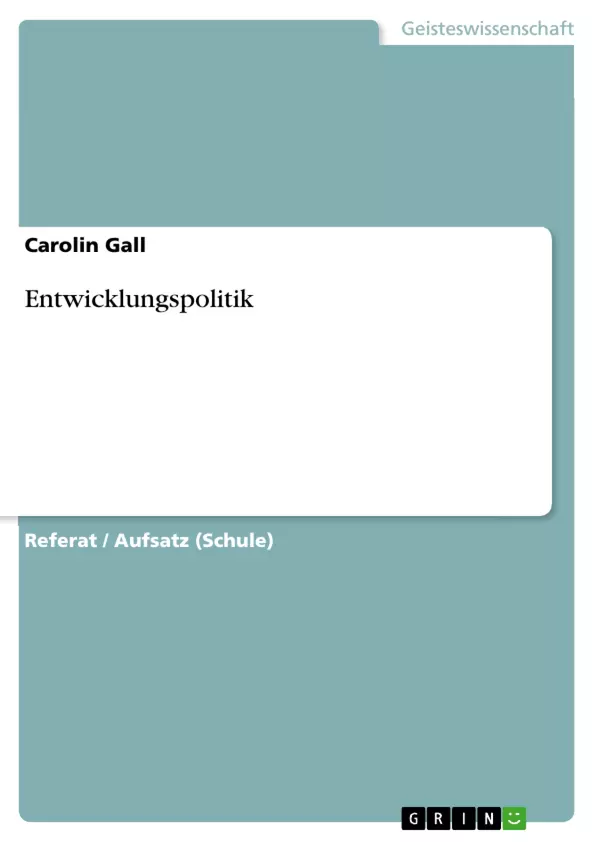Entwicklungspolitik
Brasilien: „nachholende Industrialisierung“ = Aufholstrategie
Lieferant von Rohstoffen/ Importeur von Fertigwaren
→ (mit Kapital aus dem Export) Aufbau einer Industrie für einfache Konsumgüter (vor ausländischer Konkurrenz geschützt)
→ Industrie Importe durch eigene Produkte ersetzen
→ 50er bisherige Binnenmarktorientierung aufgegeben
→ Arbeitsplätze schaffen: mit Hilfe ausländischen Kapitals langlebige Güter produzieren (Autos...)
→ 1964 Militärputsch: noch schnellere Gangart → moderner Industriestaat (exportierende Industrie gefördert = Wachstumsmotoren)
→ Vorleistung für Industrialisierung: Infrastruktur (Auslandskredite = Verschuldungspolitik) durch Export von agrarischen, mineralischen + Industriegütern sollen Schulden zurückgezahlt werden
→ erst mal Aufschwung, brasilianisches Wirtschaftswunder
→ 70er/80er: Ölpreisexplosion, Phase hoher Zinsen, fallende Rohstoffpreise, rückläufige Auslandsnachfrage → erhebliche Devisenprobleme
→ Aufnahme kurzfristiger + teuerer Auslandskredite
→ 1982 Zahlungsunfähigkeit Brasiliens
→ Ende der „nachholenden Industrialisierung“ mit hohen Auslandsverschuldungen + Rückkehr zur Demokratie
→ erst 1994: Umschuldungsabkommen mit den 750 privaten ausländischen Gläubigerbanken
→ Schulden sinken von 11 auf 7 Milliarden US-Dollar → Lockerung der Importbeschränkungen, Inflation gestoppt
Erblasten des Entwicklungsexperiments:
- extrem ungleiche Einkommensverteilung → Unterernährung
- Vernachlässigung der ländlichen Entwicklung (einseitige Förderung der exportorientierten Plantagenwirtschaft) → Leute wandern in Stadt ab, Slums
- Verzicht auf Förderung von Industrie mit einfacher Technologie (zugunsten kapitalistischer Hochtechnologien) → Arbeitsplätze rar
- Vernachlässigung des Umweltschutzes
→ Konzept der nachholenden Industrialisierung hat nicht geklappt (Armut nahm überall zu, Vorteile des Aufschwungs nur für kleinen Bevölkerungsteil) → entwicklunspolit. Neubesinnung
→ entwicklungspolitische Priorität: Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Gesundheit, Abwesenheit von Zwang und Folter, Bewahrung der kulturellen Identität, Beteiligung der Bevölkerung an gesellschaftlichen Entscheidungen) → Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum.
Tansania: „Afrikanischer Sozialismus“ = Grundbedürfnisstrategie
deutsche/britische Kolonie → 1961 unabhängig
- reiner Agrarstaat, hauptsächlich Subsistenzwirtschaft, kaum Anbau für den Export
→ schon in der Kolonialzeit leistungsfähiges Genossenschaftswesen
→ fördert zuerst einseitig die exportierenden Zweige der Landwirtschaft (wie die meisten af. Länder)
→ mit Exporterlösen soll eine importsubstituierende Industrie aufgebaut werden (mit Industrie selber versorgen, nicht mehr sooo abhängig vom Export
→ nach Reise in die Volksrepublik China: entwicklungspolitischer Kurswechsel (Staatspräsident Nyerere fürchtet der kapitalistische Entwicklungsweg führt zu einer weiteren regionalen + sozialen Differenzierung)
→ Afrikanischer Sozialismus:
- self-reliance = Vertrauen auf die eigene Kraft + ujamaa = Großfamilie, Familiensinn (wenn alle mithelfen klappts auch)
- staatlich geleitete Betriebe, staatlich unterstützte bäuerliche Gemeinschaften → nicht mehr ökonomisch oder politisch abhängig zu sein
- Vorrang der Befriedigung der Grundbedürfnisse und der ländlichen Entwicklung
- Ausbau des Erziehungs- und Gesundheitswesens + Infrastruktur, Wasserversorgung
Grundbedürfnisstrategie: Ende 70er: Strategie der Vereinten Nationen, der Weltbank + anderen Institutionen, nach den Enttäuschungen der Aufholstrategie
→ Krise: Ende der 80er: Abhängigkeit von ausländischem Geld (→ Einflussnahme ausländischer Kreditgeber)
→ Scheitern des Entwicklungsmodells
Faktoren:
Interne Faktoren:
- verstaatlichte Industrie wenig effizient
- Bauern gaben oft die Marktproduktion auf und arbeiteten nur noch für den eigenen Bedarf
- Regierung muss Nahrungsmittel importieren
- bürokratische Bevormundung (Zerschlagung des etablierten Genossenschaftswesens → staatliche Einrichtungen) → sinkende Motivation und Eigeninitiative
Externe Faktoren:
- kostspieliger Krieg gegen Ugandas Diktator Aki Amin
- viel Geld für Infrastrukturmaßnahmen (Hafen, Eisenbahn, Flughafen...)
- Zollunion mit Kenia + Uganda
- explodierende Ölpreise → hoher Devisenbedarf
- Verfall der Weltmarktpreise für die von Tansania exportierten Agrarprodukte
→ höhere Auslandsverschuldung
→ Importrestriktionen
→ steigende Inflationsrate, Schwarzmärkte, Zusammenbruch des Transportwesens (Treibstoffmangel), Teile der Ernte verrotten
Staatsbankrott vermeiden: Internationaler Währungsfond (IWF) = Art Zentralbank der Welt → Beistandsabkommen (Voraussetzung für Umschuldungsverhandlungen wenn ein Entwicklungsland in eine Verschulungskrise geraten ist) abschließen
→ strenge wirtschaftliche Auflagen → „neokolonialistische“ Auflagenpolitik: massive Abwertung der Währung, Lockerung der Importbeschränkungen, schrittweise Privatisierung der Staatsbetriebe...Staatsausgaben sollen massiv gekürzt werden
→ erhebliche Abstriche von den früheren Standards
Entwicklungshilfe - Hilfe zur Unterentwicklung oder Hilfe zur Selbsthilfe?
Rahmenbedingungen des internationalen Systems:
- von USA + GB bestimmt
- 3 Teilbereiche regelungsbedürftig:
- Währungsbereich (Internationaler Währungsfond: überprüft Wechselkurspolitik, Hilfe bei Zahlungsproblemen)
- Langfristige Kapitalhilfe (Weltbank: Wiederaufbau nach dem Krieg, Entwicklungsförderung mit Hilfe von Krediten)
- Handelsbereich (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT): Ausbau des internationalen Handels, Diskriminierungen/Einfuhrbeschränkungen beseitigen, Zölle abbauen
seit den 50ern: mehr als 1 Billion US-Dollar für öffentliche Entwicklungshilfe (D ab 1952) + erhebliche private Entwicklungshilfe
Jedoch Zweifel an der Tauglichkeit der Entwicklungshilfe:
- Entwicklungshilfe stets zu gering, Industrieländern sind UN-Empfehlungen (0,7% des Bruttosozialprodukts) bei weitem nicht nachgekommen
- eher „Hilfe zur Unterentwicklung“ + „tödliche Hilfe“ → Entwicklungshilfe reduziert eigene Anstrengungen
- nicht Entwicklungshilfe selbst, sondern Ziele, Konditionen + Vergabepraxis haben zum Misslingen beigetragen
Deutschland:
- Verpflichtung erkannt → Humanität + internationale Solidarität → gleiche Lebenschancen der Völker
- Entwicklungspolitik = „Entwicklungszusammenarbeit“, „Politik im Geist der Partnerschaft“ → „Hilfe zur Selbsthilfe“
öffentliche Entwicklungshilfe: von Staat zu Staat (einzelne Regierungen + Programme der EU, UNO, Weltbank)
Hilfsmaßnahmen: Kapitalhilfe (zinsgünstige Darlehen mit langer Laufzeit/nichtrückzahlbare Zuschüsse), technische Hilfe, personelle Zusammenarbeit (Ausbildung von Fach- und Führungskräften), Nahrungsmittel + humanitäre Hilfe
private Entwicklungshilfe: kirchliches Hilfswerk, Parteistiftungen, finanziert aus Mitgliedsbeiträgen + Spenden → freie Träger können (anders als der Staat) an den Regierungen, Bürokratie, Machthaber vorbei direkt an der Basis aktiv werden → Experten fordern: Nicht-Regierungsorganisationen mehr unterstützen
Entwicklungshilfe als politisches Instrument:
Entwicklungszusammenarbeit hängt auch besonders von wirtschafts- und deutschlandpolitischen Zielen ab:
- Entwicklungspolitik als Instrument zur Verhinderung der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR
- wachstumsorientierte Aufholstrategie: gefördert wurden nur industrielle Großprojekte → deutsches Exportinteresse
- Wende zur Grundbedürfnisstrategie: Entwicklungshilfe soll mehr nach den Zielen und Planungen der Entwicklungsländer ausgerichtet sein → Protest: Vernachlässigung legitimer deutscher Eigeninteressen, Ausrichtung an den Interessen oft korrupter Staatsoligarchien → Entwicklungshilfe wird zu Entwicklungshemmnis
→: Grundprobleme der staatlichen Entwicklungshilfe
1. Entwicklungshilfe sollte auch dazu beitragen, die Rohstoffversorgung des Geberlandes (BRD) zu sichern Entwicklungshilfe soll für die deutsche Wirtschaft „beschäftigungswirksam“ werden → Lieferbedingungen: Kapitalhilfe soll wo immer möglich für deutsche Güter und Dienstleistungen der BRD ausgegeben werden
2. Gefahr dass Entwicklungshilfe für die Interessen der in den E.ländern herrschenden Oligarchien benutzt wird → korrupte, unfähige und undemokratische Regierungen durch Entwicklungshilfe gestützt → neue Kriterien für die Vergabe von Entwicklungshilfe + Politikdialog (zw. Bundesregierung und Empfängerland)
Neue Wirtschaftsordnung, Freihandel, Süd-Süd-Kooperation - entwicklungspolitische Alternativen
1976 Welthandelskonferenz: Forderung der 3.Welt nach einer „neuen Weltwirschaftsordnung“ → „Integriertes Rohstoffprogramm“ (IRP) → Exporterlöse der Entwicklungsländer sollen stabilisiert + gesteigert werden
meiste Entwicklungsländer exportieren vor allem Rohstoffe, kaum weiterverarbeitete Produkte
→ auf den Import von Industriegütern angewiesen (deren Preise aber im Trend mehr steigen als die ihre Rohstoffe)
→ man muss für die Einführung von Industriegütern immer größere Mengen an Rohstoffen ausführen
→ ungleicher Tausch + Preisverfall (manche Stoffe durch Kunststoffe ersetzt) + starke Preisschwankungen
→ soll mit dem IRP bewältigt werden:
- Errichtung von Rohstofflagern → Ausgleich von Angebots - und Nachfrageschwankungen
- Errichtung eines „Gemeinsamen Fonds“ (Strukturverbessernde Maßnahmen finanzieren)
- Vereinbarungen von Preisober- und Preisuntergrenzen + Exportquoten für die 10 Produkte im Programm (=Rohstoffabkommen)
Rohstoffabkommen = Schwachpunkte des IRP:
→ „TransFair“ → durch faire Preise ein Überleben ermöglichen
→ kann für bestimmte Zielgruppen in den E-ländern entscheidende Hilfestellungen geben, aber nicht die großen Strukturprobleme im Handel zw. Nord + Süd lösen
Industrieländer: Forderung nach einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ nie Sympathien entgegengebracht: mit lib. Marktwirtschaft nicht vereinbar
→ Liberalisierung des Welthandels (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen =General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)
→GATT habe Grundlage für dynamische Entwicklung des Welthandels in den letzen 50 Jahren gebildet → zur Steigerung des Wohlstandes nach WW2 beigetragen
GATT: 1995 = World Trade Organization (WTO) 123 Mitgliedsländer, davon 99 Entwicklungsländer
Hauptziel: Freihandel auf der Grundlage der „Meistbegünstigung“ (Zollvergünstigungen für alle Mitgliedsländer) + der „Nichtdiskriminierung“ (erlaubte Ausnahmen vom Verbot mengenmäßiger Importbeschränkungen für alle) Ziele: Abbau von Schutzzöllen (Importzöllen), Exportsubventionen + nichttarifären Handelshemmnissen
→ Vereinbarung über Öffnung von Märkten soll bis 2002 zu einer weltweiten Einkommenssteigerung von 200-300 Mrd. US- Dollar führen
für die am wenigsten entwickelten Länder Afrikas aber Einkommensverluste:
- Industrieländer haben Marktzugangserleichterung vor allem für die Sektoren durchgesetzt in denen sie Vorteile haben
- Abbau von Agrarsubventionen um 1/3 →steigende Weltmarktspreise → Vorteile für exportierende Länder (Brasilien, Thailand), Nachteile der importierenden Länder (Afrika)
- Lomé-Abkommen: EU räumt günstigere Marktzugangsbedingungen ein (Präferenzabkommen) → jetzt: weltweiter Abbau von Importzöllen → Afrika muss mit Konkurrenz anderer Entwicklungsländer auf dem europäischen Markt rechnen
Basis für gerechten Warentausch (N-S) ist nicht gegeben (strukturelle Gegensätze von Industrie- und Entwicklungsländern)
→ Forderung nach „Dissoziation“ + „autozentrierter Entwicklung“ → zeitweise Abkoppelung der Entwicklungsländer von den internat. Wirtschaftsbeziehungen und einer nach innen gerichteten Entwicklung → nicht völlige Autokratie sondern Zusammenarbeit mir den Industrieländern in dem Umfang wie es für den Aufbau einer lebensfähigen Volkswirtschaft nötig ist
„Autozentrierte Entwicklung“ = Verringerung der Abhängigkeit von Lebensmittelimporten, Umstrukturierung der Landwirtschaft (→ eigene Nahrungsmittelproduktion), Verringerung der Abhängigkeit vom Import industrieller Güter (Aufbau einer verarbeitenden Industrie mit selbst erlernter + beherrschbarer Technologie)
→ an neue weniger auf Einzelstaaten bezogene Entwicklungspolitik gedacht: Süd-Süd-Kooperation zw. wirtschaftlich ähnlich strukturierten Staaten
→ Schritt in die richtige Richtung?
Quelle: Mensch und Politik, Friedenserhaltung - Friedensgestaltung, Schroedel Schulbuchverlag ISDN: 3-507-10426-1
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der "nachholenden Industrialisierung" in Brasilien?
Die "nachholende Industrialisierung" in Brasilien war eine Aufholstrategie, bei der das Land zunächst Rohstoffe exportierte und Fertigwaren importierte. Mit den Einnahmen aus dem Export wurde dann eine eigene Industrie für einfache Konsumgüter aufgebaut, die vor ausländischer Konkurrenz geschützt war. Später wurde versucht, durch ausländisches Kapital langlebige Güter zu produzieren und eine exportorientierte Industrie zu entwickeln. Dies führte zu einer starken Verschuldung und schließlich zum Scheitern des Modells.
Was waren die negativen Folgen der "nachholenden Industrialisierung" in Brasilien?
Die negativen Folgen waren eine extrem ungleiche Einkommensverteilung, die Vernachlässigung der ländlichen Entwicklung, die Bevorzugung kapitalintensiver Hochtechnologien gegenüber einfachen Technologien, die zu wenigen Arbeitsplätzen führte, und die Vernachlässigung des Umweltschutzes.
Was ist das Konzept des "Afrikanischen Sozialismus" in Tansania?
Der "Afrikanische Sozialismus" in Tansania, auch bekannt als Grundbedürfnisstrategie, basierte auf den Prinzipien der Selbstständigkeit (self-reliance) und der Großfamilie (ujamaa). Ziel war es, staatlich geleitete Betriebe und bäuerliche Gemeinschaften zu fördern, um wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit zu erreichen. Dabei sollte die Befriedigung der Grundbedürfnisse und die ländliche Entwicklung im Vordergrund stehen.
Warum scheiterte das Entwicklungsmodell des "Afrikanischen Sozialismus" in Tansania?
Das Modell scheiterte aufgrund interner Faktoren wie ineffiziente verstaatlichte Industrien, die Aufgabe der Marktproduktion durch Bauern, bürokratische Bevormundung und externer Faktoren wie ein kostspieliger Krieg gegen Uganda, hohe Ausgaben für Infrastruktur, steigende Ölpreise und fallende Weltmarktpreise für tansanische Agrarprodukte. Dies führte zu einer hohen Auslandsverschuldung und schließlich zum Scheitern des Modells.
Welche Rolle spielt der Internationale Währungsfonds (IWF) in Bezug auf verschuldete Entwicklungsländer?
Der IWF ist eine Art Zentralbank der Welt, die Beistandsabkommen mit verschuldeten Entwicklungsländern abschließt. Diese Abkommen sind oft Voraussetzung für Umschuldungsverhandlungen und beinhalten strenge wirtschaftliche Auflagen wie Währungsabwertung, Lockerung von Importbeschränkungen, Privatisierung von Staatsbetrieben und Kürzung der Staatsausgaben.
Was sind die Kritikpunkte an der Entwicklungshilfe?
Kritiker bemängeln, dass die Entwicklungshilfe oft zu gering ist, dass sie die eigenen Anstrengungen der Entwicklungsländer reduziert ("Hilfe zur Unterentwicklung"), und dass die Ziele, Konditionen und Vergabepraxis zum Misslingen beitragen. Sie wird auch als politisches Instrument eingesetzt, das den Interessen der Geberländer dient.
Was sind die Grundprobleme der staatlichen Entwicklungshilfe laut dem Text?
Die Entwicklungshilfe soll auch dazu beitragen, die Rohstoffversorgung des Geberlandes zu sichern und die deutsche Wirtschaft zu fördern, indem sie an Lieferbedingungen geknüpft ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Entwicklungshilfe für die Interessen der herrschenden Oligarchien in den Entwicklungsländern benutzt wird, wodurch korrupte und undemokratische Regierungen gestützt werden.
Was war das "Integrierte Rohstoffprogramm" (IRP) und welche Ziele verfolgte es?
Das "Integrierte Rohstoffprogramm" (IRP) war eine Forderung der Dritten Welt nach einer "neuen Weltwirtschaftsordnung". Ziel war es, die Exporterlöse der Entwicklungsländer zu stabilisieren und zu steigern, indem Rohstofflager errichtet, ein "Gemeinsamer Fonds" geschaffen und Rohstoffabkommen mit Preisober- und Preisuntergrenzen sowie Exportquoten vereinbart werden.
Was ist die Rolle des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) bzw. der Welthandelsorganisation (WTO) im Welthandel?
Das GATT (später die WTO) hat das Ziel, den Freihandel auf der Grundlage der "Meistbegünstigung" und der "Nichtdiskriminierung" zu fördern. Dies soll durch den Abbau von Schutzzöllen, Exportsubventionen und nichttarifären Handelshemmnissen erreicht werden. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Vorteile des Freihandels ungleich verteilt sind und die Entwicklungsländer benachteiligt werden.
Was bedeutet "autozentrierte Entwicklung" und "Dissoziation" im entwicklungspolitischen Kontext?
"Autozentrierte Entwicklung" bedeutet, die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten zu verringern, die Landwirtschaft umzustrukturieren und die Abhängigkeit vom Import industrieller Güter zu reduzieren, indem eine verarbeitende Industrie mit selbst erlernter und beherrschbarer Technologie aufgebaut wird. "Dissoziation" bedeutet eine zeitweise Abkoppelung der Entwicklungsländer von den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und eine nach innen gerichtete Entwicklung.
- Quote paper
- Carolin Gall (Author), 2001, Entwicklungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103576