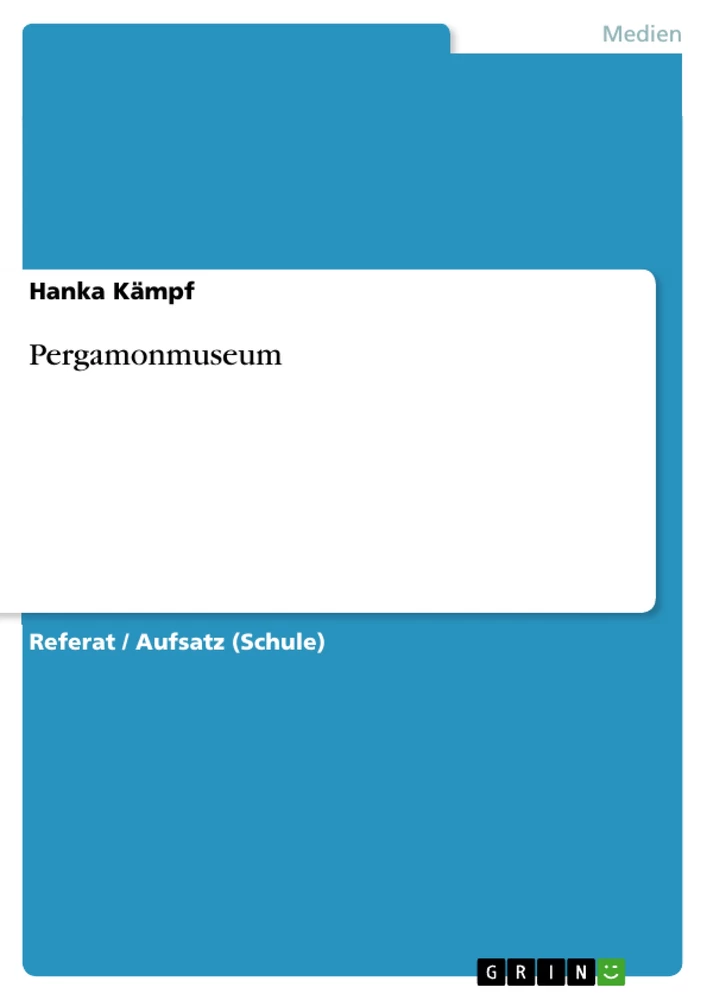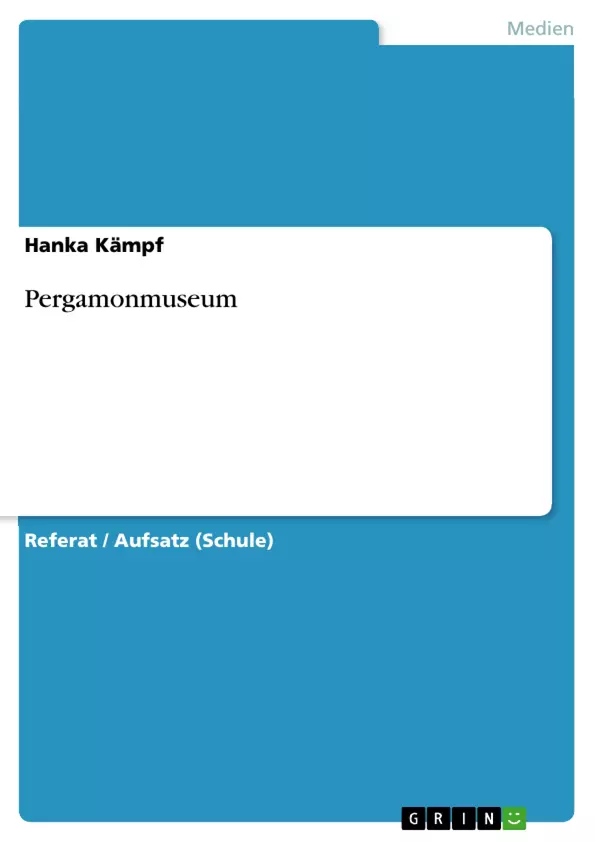Aufgaben für das Pergamonmuseum
Name: Hanka Kämpf
Klasse: 10A
Datum: 06.12.2000 Zensur: 1
1. Stelle anhand der Dokumentation an der Seite des Pergamonaltars die wesentlichen Daten der Ausgrabungen durch C. Humann fest und notiere stichpunktartig!
1431-44
Der italienische Humanist Cyriacus von Ancona besucht Pergamon und berichtet von der Reise in seinen Tagebüchern.
1625
Thomas Howard, der 2. Earl of Arundel, schickt seinen Kaplan William Petty in die Türkei, dieser besucht auch Pergamon und bringt zwei Reliefplatten des Altars nach England. Nach der Auflösung der Sammlung geraten die Friesblöcke in Vergessenheit und werden erst in den 60er und 70er Jahren unseres Jahrhunderts wiederentdeckt.
Spätes 18./ frühes 19. Jahrhundert
Zu den Pergamon-Reisenden dieser Zeit gehören der französische Diplomat und Alterumsforscher Graf Choiseul-Gouffier, der sich bereits für eine Ausgrabung in Pergamon aussprach, der englische Architekt C.R. Cockerell, die Deutschen Otto Magnus von Stackelberg und Otto Friedrich von Richter; von den drei Letztgenannten haben sich Zeichnungen vom Burgberg erhalten.
1864/65
Carl Humann, ein deutscher Ingenieur, weilt zur Durchführung geographischer Untersuchungen und zum Bau von Straßenanlagen in Pergamon, das er in den folgenden Jahren immer wieder besucht. Mit Energie versucht er sich für die Erhaltung der verstreut herumliegenden Altertümer auf dem Burgberg von Pergamon einzusetzen und Partner für eine Grabung zu gewinnen.
1871
Auf Einladung Humanns besucht der Berliner Historiker und Archäologe Ernst Curtius Pergamon. Einige Fundstücke, darunter zwei Fragmente der Altarreliefs, werden nach Berlin gesandt.
1878-1886
Unter Leitung von Carl Humann und Alexander Conze findet die erste Grabungskampagne im Auftrag der Berliner Museen statt. Es werden ausgegraben und untersucht: der große Altar, das Theater mit Terrasse und Dionysos-Tempel, das Athens-Heiligtum, die Königspaläste, der Trajan-Tempel und die Druckwasserleitung. Aufgrund eines Abkommens mit der türkischen Regierung gelangen die Reliefplatten und einige der Architekturteile des Altars sowie Skulpturen nach Berlin und damit in den Besitz der Berliner Museen.
1902-1908
Im neuerbauten Pergamonmuseum werden Altarreliefs in eine Teilrekonstruktion des Altars eingefügt. Vor allem wegen Fundamentschäden muß das Museum wieder abgerissen werden.
1930
Eröffnung des heutigen Pergamonmuseums, in dessen Mittelsaal eine Teilrekonstruktion des Altars errichtet wird.
1939
Schließung der Berliner Museen aufgrund des ausgebrochenen Zweiten Weltkrieges.
1941
Die zunächst durch Sandsäcke und Verschalungen geschützten Reliefs werden abgenommen und außerhalb der Museumsinsel gelagert.
1945
Sicherstellung der Kunstwerke durch die Sowjetischen Truppen. Abtransport nach Moskau und Leningrad.
1959
Nach der Rückführung der Reliefs aus der Sowjetunion wird im Oktober das Pergamonmuseum wiedereröffnet.
1990
Neun Reliefköpfe des Telophosfrieses, die nach dem Zweiten Weltkrieg an das Westberliner Antikenmuseum gelangten, kommen zurück auf die Museumsinsel.
2. Welche Bedeutung haben in der Antikenhalle das Markttor von Milet und das Fuß bodenmosaik?
Im Saal römischer Architektur dominiert die Rekonstruktion des Markttores von Milet, das 28,92m lang und 16,68m hoch ist. Es bildete einst den Eingang zum Südmarkt der Stadt und ist bald nach Beginn der Herrschaft des Kaisers Hadrian um 120 n.Chr. entstanden. Erst ein Erdbeben zerstörte das Marktor und andere Bauten der Stadt. Das Markttor von Milet diente als eine Werbetafel und als Prestige der Stadt. Man kann sagen, dass es die erste Werbetafel war, die gefunden wurde.
Das Fußbodenmosaik stammt aus dem Speiseraum (Triklinium) eines römischen Privathauses und entstand in der ersten Hälfte des 2 Jh. n. Chr. Auf dem Fußbodenmosaik ist Orpheus dargestellt. Er besaß die Fähigkeit wilde Tiere zu zähmen und mit ihnen zusprechen.
3. Wodurch sind die Säulen in derselben Halle gekennzeichnet, wodurch unterscheiden sie sich (nach Säulenaufbau und Kapitell)?
In der Antikenhalle befinden sich dorische, ionische, korrinthische und Komposit-Säulen.
dorische Säulen: Die dorische Säule, die seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. erstmalig verwendet wurde, besitzt keine Basis, ihr dicker, kurzer Schaft verjüngt sich zum Kapitell hin stark, wobei seine Kanneluren spitz zulaufen. Der wulstförmig gebildete Körper des Kapitells (Echinus, griechisch: Igel) wird von einem dicken, unverzierten Abakus (lateinisch: Platte) abgeschlossen. Das Gebälk wird von einem Architrav gebildet, über dem der Fries mit Triglyphen (griechisch. Dreischlitzen), Deckplatten mit drei senkrechten Rillen, und Metopen (griechisch:Stirnen), reliefverzierten viereckigen Platten, liegt. An der Unterseite des sich anschließenden Kranzgesimses (Geison) hängen Mutuli (Hängeplatten) und Stäbchen (lateinisch Guttae: Tropfen). Darüber folgt der Giebel mit ornamental oder figürlich gestaltetem Giebelfeld (Tympanon), der von einer Traufleiste (Sima) und je einem seitlich angebrachten Eckaufsatz (Akroter, griechisch: Spitze) abgeschlossen wird.
ionische Säulen: Seit dem 6.Jahrhundert v. Chr. Ist die ionische Ordnung nachweisbar, die wohl aus dem asiatischen Raum nach Griechenland gelangte. Die ionische Säule, die wesentlich schlanker ist und sich weniger stark verjüngt als die dorische, steht auf einer prächtig gestalteten kreisförmigen Basis mit wechselnder Folge von Wülsten (Torus) und Kehlen (Trochilus). Das ionische Kapitell ist durch Voluten (von lateinisch volvere: rollen) charakterisiert, spiralförmig eingerollte Ornamente, und wird von einem schmalen, verzierten Abakus abgeschlossen. Der Architrav (Querbalken) ist in drei abgetrennte Schichten (Fasciae) untergliedert.
korinthische Säulen: Die korinthische Ordnung entwickelte sich Ende des 5.Jahrhunderts v. Chr. Und lehnt sich eng an die ionische Schaft- und Basisbildung an. Sie unterscheidet sich lediglich durch die noch schlankeren Proportionen und durch die Kapitellbildung in Form eines Kelches aus aufstrebenden, sich an den Enden einrollenden Akanthusblättern.
Komposit-Säulen: Die Römer übernahmen diese drei Ordnungen, vermischten sie jedoch teilweise, um die dekorative Wirkung zu steigern. Bei der römischen Kompositordnung vermischten sich besonders hinsichtlich der Ausbildung des Kapitells ionische und korinthische Stilformen. Bei den Römern wurden Säulen auch erstmals im Mauerwerk als Bestandteil der Fassadengestaltung eingesetzt.
4. Nenne von der Basis bis zum Architrav die Unterschiede zwischen dorischer und römischer Säule!
Dorische Ordnung
Die dorische Säule, die seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. erstmalig verwendet wurde, besitzt keine Basis, ihr dicker, kurzer Schaft verjüngt sich zum Kapitell hin stark, wobei seine Kanneluren spitz zulaufen. Der wulstförmig gebildete Körper des Kapitells (Echinus, griechisch: Igel) wird von einem dicken, unverzierten Abakus (lateinisch: Platte) abgeschlossen. Das Gebälk wird von einem Architrav gebildet, über dem der Fries mit Triglyphen (griechisch. Dreischlitzen), Deckplatten mit drei senkrechten Rillen, und Metopen (griechisch:Stirnen), reliefverzierten viereckigen Platten, liegt. An der Unterseite des sich anschließenden Kranzgesimses (Geison) hängen Mutuli (Hängeplatten) und Stäbchen (lateinisch Guttae: Tropfen). Darüber folgt der Giebel mit ornamental oder figürlich gestaltetem Giebelfeld (Tympanon), der von einer Traufleiste (Sima) und je einem seitlich angebrachten Eckaufsatz (Akroter, griechisch: Spitze) abgeschlossen wird.
Römische Ordnung
Siehe Aufgabe 3
5. Beim Gang durch das Ischtar-Tor stellt man fest, dass einige Besonderheiten zu verzeichnen sind (Wandkacheln, Toraufbau, Höhe, Figuren usw.). In der Dokumentation am Ischtar-Tor ist die Bedeutung zu lesen. Halte stichpunktartig die Merkmale fest!
Ischtar- Tor
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wesentlichen Daten der Ausgrabungen des Pergamonaltars durch C. Humann?
Die wesentlichen Daten der Ausgrabungen umfassen:
- 1431-44: Cyriacus von Ancona besucht Pergamon.
- 1625: William Petty bringt Reliefplatten des Altars nach England.
- Spätes 18./frühes 19. Jahrhundert: Verschiedene Reisende besuchen Pergamon und erstellen Zeichnungen.
- 1864/65: Carl Humann setzt sich für die Erhaltung der Altertümer ein.
- 1871: Ernst Curtius besucht Pergamon auf Einladung von Humann.
- 1878-1886: Erste Grabungskampagne unter Leitung von Carl Humann und Alexander Conze.
- 1902-1908: Altarreliefs werden im Pergamonmuseum eingefügt, Museum muss aber abgerissen werden.
- 1930: Eröffnung des heutigen Pergamonmuseums.
- 1939: Schließung der Berliner Museen.
- 1941: Reliefs werden ausgelagert.
- 1945: Abtransport der Kunstwerke durch Sowjetische Truppen.
- 1959: Wiedereröffnung des Pergamonmuseums.
- 1990: Rückkehr von Reliefköpfen des Telophosfrieses.
Welche Bedeutung haben das Markttor von Milet und das Fußbodenmosaik in der Antikenhalle?
Das Markttor von Milet diente als Eingang zum Südmarkt und als Prestigeobjekt der Stadt, eine Art Werbetafel. Das Fußbodenmosaik zeigt Orpheus und stammt aus dem Speiseraum eines römischen Privathauses.
Wodurch unterscheiden sich dorische, ionische, korinthische und Komposit-Säulen?
Jeder Säulentyp hat besondere Merkmale:
- dorische Säulen: Haben keine Basis, ein einfaches Kapitell und einen Fries mit Triglyphen und Metopen.
- ionische Säulen: Sind schlanker, haben eine verzierte Basis, Voluten am Kapitell und einen in Schichten unterteilten Architrav.
- korinthische Säulen: Ähneln ionischen Säulen, haben aber ein Kapitell in Form eines Kelches aus Akanthusblättern.
- Komposit-Säulen: Vermischen ionische und korinthische Stilformen im Kapitell.
Was sind die Unterschiede zwischen dorischer und römischer Säule von der Basis bis zum Architrav?
Dorische Säulen haben keine Basis, während römische Säulen oft eine Basis haben. Das dorische Kapitell ist einfach, während römische Kapitelle verschiedene Formen annehmen können. Der dorische Architrav ist einfach, während römische Architrave verziert sein können.
Welche Besonderheiten sind beim Ischtar-Tor zu verzeichnen?
Das Ischtar-Tor zeichnet sich durch Wandkacheln, seinen imposanten Aufbau, seine Höhe und die Darstellung von Figuren aus. Es war Teil der Prozessionsstraße Babylons und mit farbigen Reliefs von Stieren, Löwen und Drachen verziert, die Symbole der Götter Marduk und Adad darstellten.
- Quote paper
- Hanka Kämpf (Author), 2000, Pergamonmuseum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103418