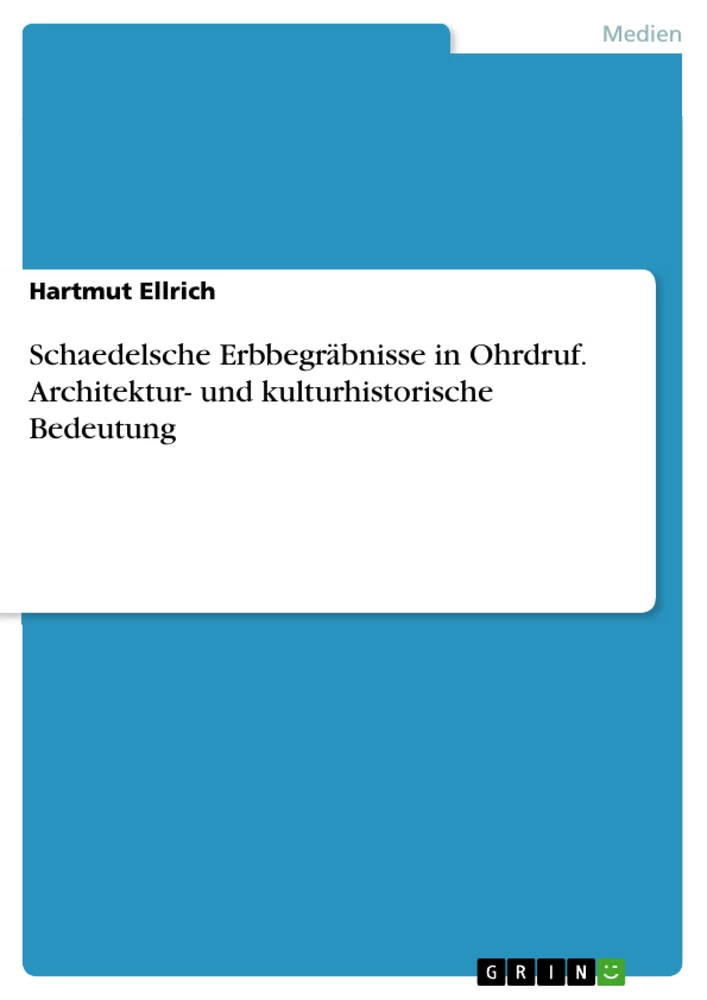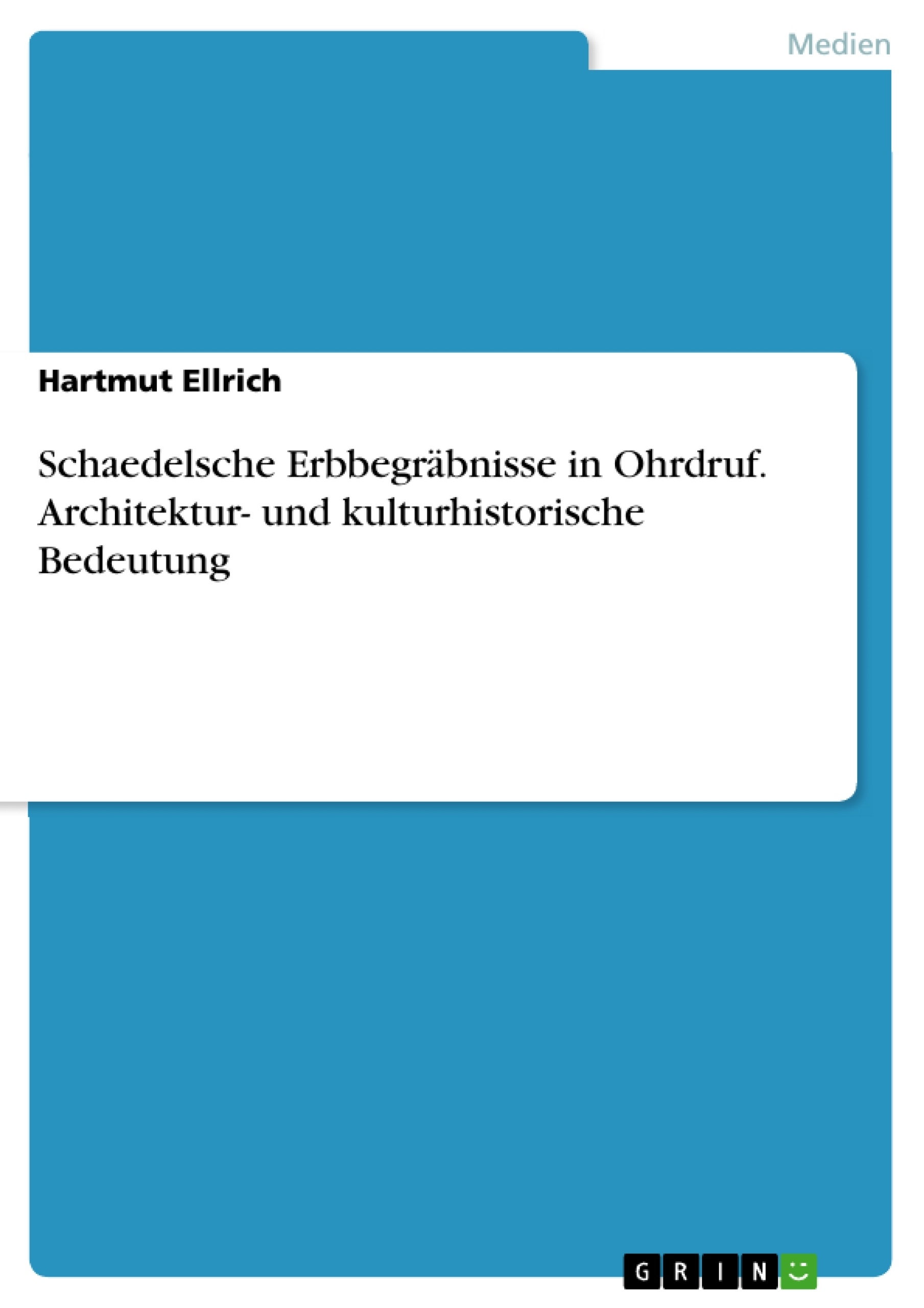Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Schaedelsche Erbbegräbnisse in Ohrdruf.
Die Besonderheit der Schaedelschen Familiengruft betont erstmals Paul Weber in seinem „Führer furch Ohrdruf“ 1916: „Die im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert sehr beliebten Familien-Grabkapellen sind nur in einem Beispiele vertreten: Dem Schädel’schen Erbbegräbnis, an der Ostmauer.“ [...]
[...] Das Baumaterial – gelber Sandstein scheint heimischer Provenienz zu sein. Das Grabgewölbe hat die Form eines klassizistischen dreiachsigen antikisierenden Tempelchens mit einer säulengetragenen Vorhalle aus korinthischen Säulen und ebensolchen Kapitellen, Architrav, Fries und Dreiecksgiebel. Die Auswahl der korinthischen Säulenordnung kommt nicht von ungefähr. Durch den Bau korinthischer Tempel konnten Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit demonstriert werden. An Stelle des Schmuckfrieses finden sich hier links und rechts außen die teilweise erhaltenen Inschriften der Gruftanlage. Drei halbrunde Zugänge führen in das Innere.
Der Innenraum ist ungeteilt und enthielt ursprünglich hinter drei geteilten wohl offenen Eisentoren die Grabsteine der Schaedels und Göhrings. Die eigentliche Gruft befindet sich unterhalb. Über ihre heutige Situation ist nichts bekannt. Vermutlich sind die Gewölbe noch erhalten. Darin dürften sich die originalen Begräbnisse befinden. [...]"
Inhaltsverzeichnis
- Architektur- und Kulturhistorische Bedeutung des ehemaligen Schaedelschen Erbbegräbnisses in Ohrdruf
- Zum Friedhof
- Die Besonderheit der Schaedelschen Familiengruft
- Die „Friedhofsakte Ohrdruf“ im Stadtarchiv Ohrdruf
- Der Grabstein von Johann Gottfried Heinrich Göhring
- Das „Sterbebuch von St. Trinitatis 1842-1862“
- Die Ohrdrufer Wöchentlichen Anzeigen
- Das Erbbegräbnis 1849 zum Tode Göhrings
- Das Schaedelsche Erbbegräbnis
- Hilfreich bei sind die Aufzeichnungen von Carl W. Jacobs (+1988)
- Das Gebäude muss demnach 1849 – noch vor dem Tode Göhrings errichtet worden sein.
- Das Baumaterial – gelber Sandstein scheint heimischer Provenienz zu sein.
- Der Innenraum ist ungeteilt und enthielt ursprünglich hinter drei geteilten wohl offenen Eisentoren die Grabsteine der Schaedels und Göhrings.
- Folgende sechs Personen aus der Schaedelschen Familie sind zweifelsfrei im Erbbegräbnis beigesetzt:
- Allerdings irrt Rudolf W. L. Jacobs hinsichtlich seiner Datierung der Gruft auf das Jahr 1852, denn das Erbbegräbnis wurde 1849 erstmals durch die Göhrings benutzt und vorab zu Lebzeiten Friedrich Wilhelm Schädels und Johann Gottfried Heinrich Göhrings errichtet.
- Von den Gruftbegräbnissen gibt es heute noch zahlreiche auf dem alten Friedhof.
- Bis in die Gegenwart befinden sich also auch nach der Auflassung des Friedhofes mindestens 14 Gruftbegräbnisse, davon sechs innerhalb des ehemaligen Schaedelschen Erbbegräbnisses.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Architektur und Kulturgeschichte des ehemaligen Schaedelschen Erbbegräbnisses in Ohrdruf. Die Arbeit zeichnet den Bau und die Geschichte des Gebäudes anhand von historischen Quellen und Archivalien nach. Sie beleuchtet die Rolle des Erbbegräbnisses als Ausdruck von Macht, Status und Familie in der Geschichte der Stadt Ohrdruf und seiner Umgebung.
- Die Bedeutung des Schaedelschen Erbbegräbnisses als architektonisches Denkmal
- Die historische Entwicklung des Funeralwesens in Ohrdruf
- Die Rolle der Familie Schaedel in der Geschichte der Stadt Ohrdruf
- Der Einfluss klassizistischer Architektur auf das Schaedelsche Erbbegräbnis
- Die Bedeutung des Erbbegräbnisses als Zeugnis für die Kulturgeschichte der Stadt Ohrdruf
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer kurzen Beschreibung des historischen Kontextes des ehemaligen Schaedelschen Erbbegräbnisses, indem er die Geschichte des Friedhofs in Ohrdruf beleuchtet.
- In einem weiteren Abschnitt werden die Besonderheiten des Schaedelschen Erbbegräbnisses anhand von historischen Quellen, darunter ein „Führer durch Ohrdruf“, beleuchtet.
- Anschließend wird eine detaillierte Beschreibung des Gebäudes anhand einer Objekt- und Zustandsbeschreibung aus der „Friedhofsakte Ohrdruf“ gegeben. Die Beschreibung konzentriert sich auf die Architektur des Gebäudes und die Inschriften, die sich auf der Fassade befinden.
- Es folgt die Rekonstruktion der Geschichte des Erbbegräbnisses anhand von historischen Quellen, darunter das „Sterbebuch von St. Trinitatis“ und eine Danksagung der Göhringschen Familie in den Ohrdrufer Wöchentlichen Anzeigen.
- Die Geschichte des Erbbegräbnisses wird weiter verfolgt, wobei die Bedeutung des Gebäudes für die Familie Schaedel und ihre Geschichte in Ohrdruf hervorgehoben wird.
- Der Text beschreibt die Architektur des Gebäudes und beleuchtet die Auswahl der korinthischen Säulenordnung als Ausdruck von Macht und Selbstbewusstsein.
- Es folgt eine Beschreibung des Inneren des Erbbegräbnisses und eine Auflistung der Personen, die darin beigesetzt sind.
- Der Text beleuchtet die Bedeutung des Schaedelschen Erbbegräbnisses als Zeugnis für die historische Entwicklung des Funeralwesens in Ohrdruf und stellt es in den Kontext der anderen Gruftbegräbnisse auf dem alten Friedhof.
Schlüsselwörter
Das Schaedelsche Erbbegräbnis, Architektur, Kulturgeschichte, Ohrdruf, Familie Schaedel, Funeralwesen, Klassizismus, Tempel, Gruft, Grabgewölbe, historische Quellen, Archivalien, Kunstgeschichte, Denkmal
- Quote paper
- Hartmut Ellrich (Author), 2012, Schaedelsche Erbbegräbnisse in Ohrdruf. Architektur- und kulturhistorische Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1031992