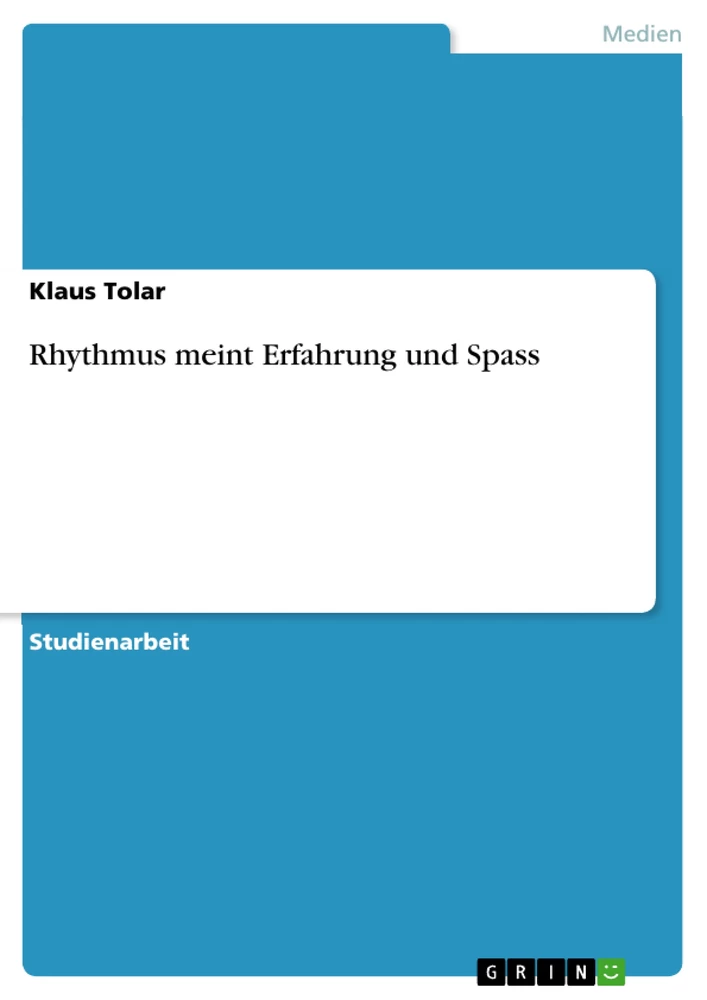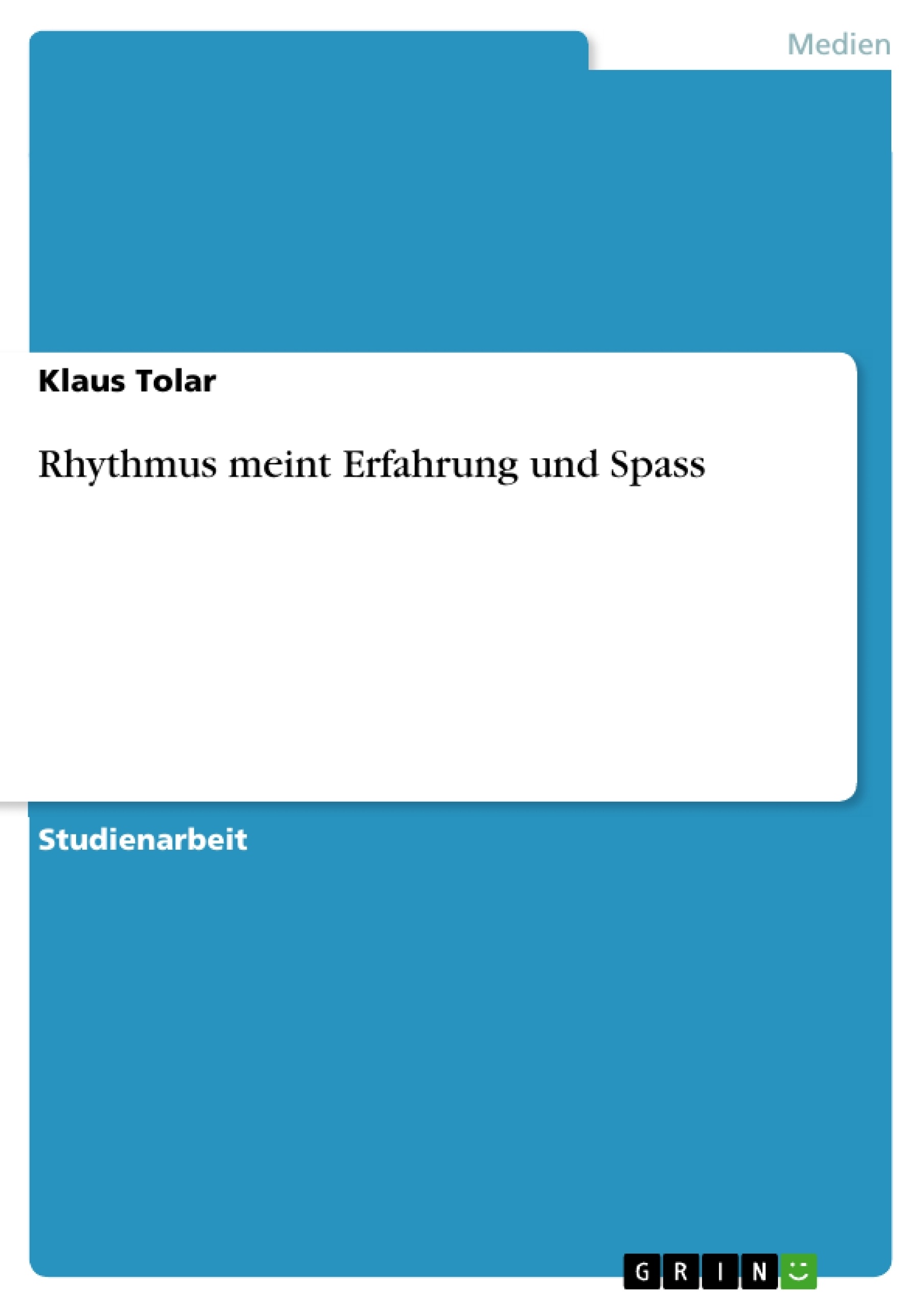Inhalt:
1 HINFÜHRUNG
2 ENTSCHULDIGUNG
3 ZUGANG ZUM ARCHAISCHEN - WARUM MUSIK UNTER DIE HAUT GEHT
3.1 Ontogenese und Phylogenese
3.2 Haeckels Mär(chen)
4 DER URSPRUNG DES RHYTHMUS UND SEINE BEDEUTUNG FÜR UNSER DASEIN
5 KONSEQUENZEN FÜR DIE ARBEIT MIT MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN
5.1 Selbst (-vertrauen) und Dialog
5.2 Wiegen und Schaukeln
6 ZUR PRAXIS
6.1 Die Klasse
6.2 Die Kinder (mit Diagnosen)
6.3 Pädagogik-Didaktik-Therapie
6.3.1 Begriffswelt und Prämissen einer vielleicht phänomenologisch gegründeten Pädagogik
6.3.1.1 Therapeutisierte Pädagogik oder pädagogisierte Therapie ?
6.3.1.2 Offener Unterricht als Konsequenz
6.3.1.3 Exkurs: Lernen als Selbstorganisation
6.3.2 "Scolatismus"
6.4 Rhythmisierung
6.5 Rhythmisierung als Stereotypie des Lehrers
7 BEISPIELE AUS DER PRAXIS
7.1 Der Morgenkreis
7.2 Die Musikstunde
7.3 Rundherum (Tagebucheintrag)
7.4 Dani (Tagebucheintrag)
7.5 Conga, Dani, Klaus
7.6 Jazztage im Schloss Zell an der Pram
7.7 Simon (Tagebucheintrag)
7.8 Daniel (Tagebucheintrag)
7.9 Sandra (Tagebucheintrag)
7.10 Dani und die Klangwiege
7.11 Klang- Rhythmus- Maschine
7.12 Das Kartonrohr
7.13 Wir wedeln
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
PSYCHOVEGETATIVE STIMULATION DES AUTOPOIETISCHEN SYSTEMS
ODER: Rhythmus ist Erfahrung und Spass Rhythmus ist Leben
Leben meint also Erfahrung und Spass
1 Hinführung
Nach langem Überlegen einerseits sowie nach breitem Literaturstudium andererseits, wollte ich ein Thema sehr stark eingrenzen und genauer betrachten.
Dass dies gerade im musikalischen Bereich ein „Ding der Unmöglichkeit“ ist, wurde mir immer klarer; denn ein Thema bedingt ein anderes, welches wiederum ein drittes voraussetzt.
So soll nun diese Arbeit einen Bogen spannen:
- Ein Streifzug durch meine Lieblingsliteratur
- Die grundlegenden „Wahrheiten“ über rhythmisches Handeln und Erfahren sowie deren Bedeutungen (nicht nur) für unsere Schüler
- Viele meiner Schüler sind infolge verschiedenster Komplikationen während oder nach ihrer Geburt in ihrer geistigen oder/und körperlichen Konstitution
schwer bzw. sehr intensiv beeinträchtigt. Da das individuelle Dasein aber bereits lange vor der Geburt beginnt, haben diese Kinder Erinnerungen und Basiserfahrungen in ihrer pränatalen Entwicklung gemacht. Wichtige Prägungen und Urerfahrungen passierten also in einem Lebensabschnitt ohne Beeinträchtigungen.
- Es gibt eine Lebenserfahrung aus „normalen“ Bereichen.
- Es gibt Regressionsmöglichkeiten in Lebensabschnitte ohne Beeinträchtigung.
- Es gibt Anknüpfungspunkte für erfahrungsbezogene Entwicklungen, die jenseits der Beeinträchtigungen liegen.
- Es gibt Erfahrungen, Erinnerungen, psychische und physische Konstitutionen, die durch eine Beeinträchtigung vielleicht verschüttet, aber eben doch vorhanden sind.
- Da gerade Rhythmus schon sehr bald in unserem Leben eine sehr grosse Rolle spielt, was später noch verdeutlicht werden soll, öffnet sich hier auch ein sehr fruchtbares Feld für den Bereich der musikalischen Interaktionsmöglichkeiten - ob pädagogisch oder therapeutisch.
- Der Versuch einer Beschreibung der Schüler, die im Praxisteil agieren.
- Ein praktischer Exkurs, der all diese Felder streifen und unseren Schülern Spass und damit Erfahrungs- bzw. Lernzuwachs bringen soll.
Ein hohes Soll, das in der verlangten Kürze dieser Arbeit sehr konzentriert werden muss.
2 Entschuldigung
Der Begriff „Musik“ verstehe ich in dieser Arbeit als sehr weitgreifend und umfassend.
Musik pendelt immer zwischen weiblichen und männlichen Polen. Die Größenverhältnisse zwischen diesen weiblichen und männlichen Prinzipen spiegelt sich ungefähr im Grössenvergleich Eizelle zu Samenzelle wider, wodurch die Bedeutung des Weiblichen eindeutig ersichtlich wird. So wird es- nicht nur der besseren Lesbarkeit halber- sicher entschuldbar, dass ich in meiner Erzählsprache eher die männlichen Formen beibehalte.
Ich weiss, dass die „Musik“ in allen Sprachen weiblich ist.
3 Zugang zum Archaischen - Warum Musik unter die Haut geht
3.1 Ontogenese und Phylogenese
Wie alles Leben beginnt auch der Mensch sein Dasein als Einzeller. In seiner ganz persönlichen weiteren ontogenetischen Entwicklung durchläuft er Stufen vom symbiotischen Embryo zum ICH-erfahrenden Fötus. Endlich zu seiner Bestimmung als „vernunftgesteuerter“ Erwachsener - im Übrigen noch immer mit hohem Wasseranteil, sodass im Grunde noch immer jede Zelle in ihrer Ursuppe schwimmt; symbiotisch geprägt und kompetent als Säugling mit einer Fülle an eigenen Erfahrungen und Verhaltensweisen. „Die noch ungeborene Leibesfrucht führt im Fruchtwasser, geschützt von den weichen Wänden des mütterlichen Uterus, in der Wiege der Tiefe geschaukelt, das Leben eines Unterwasserwesens.“ (MONTAGU 1988, S.7)
Die Entwicklung des hochkomplexen System Mensch mündet im
„Autopoietischen System“, das Varela und Maturana in ihrem „Baum der Erkenntnis“ so treffend beschreiben:
„Unser Vorschlag ist, dass Lebewesen sich dadurch charakterisieren, dass sie sich – buchstäblich – andauernd selbst erzeugen. Darauf beziehen wir uns, wenn wir die sie definierende Organisation autopoietische Organisation nennen (griech. autos = selbst; poiein = machen). (MATURANA/VARELA 1987 S.50f.)
Der Mensch als komplexer, sich selbst organisierender Metazeller! Eine Sichtweise, die noch ungeahnte Folgen für das Verständnis von Lernen oder Erziehung nach sich ziehen wird (müssen). „Die eigentümliche Charakteristik eines autopoietischen Systems ist, dass es sich sozusagen an seinen eigenen Schnürsenkeln emporzieht und sich mittels eigener Dynamik als unterschiedlich vom umliegenden Milieu konstituiert.“ (ders. S.54)
Andererseits ist dieses komplizierte System, auch im Hinblick auf den postmodernen Menschen und seine Lebenswelt, geradezu prädestiniert an Neurosen, Psychosen usw. zu leiden, (vgl. Woody Allens Stadtneurotiker). Nicht nur durch diese Komplexität, sondern auch dadurch, dass wir alle eine physiologische Frühgeburt darstellen, bedingt durch die Grösse unseres Gehirns. Die Geburt findet zum physiologisch spätestmöglichen Zeitpunkt statt. Eben dann, wenn unser großer Kopf gerade noch den Geburtskanal durchqueren kann. Nun beginnen wir, viel zu bald nach der Geburt, mit Erziehung des kleinen Fremdlings, anstatt die Schwangerschaft durch einen Fortbestand der Symbiose zwischen Mutter und Kind zu Ende zu tragen. (vgl. MONTAGU 1988, S. 36ff.)
„Phylogenetisch höhere (höher entwickelte, jüngere) Teile des Gehirns sind dabei immer auf niedere (ältere, weniger komplexe) Teile angewiesen. Esergibt sich eine funktionelle Interpendenz der Hirnstrukturen.“ (AYRES 1979, S.10)
„Nun hinterlässt natürlich jeder unserer Entwicklungsabschnitte seine Spuren in unseren stammesgeschichtlich entwickelten Hirnteilen.
Wir spüren also Affinität beim Anhören des Gesanges der Wale. Oder ist das ein Stück Erinnerung und damit Sicherheit und Wohlbefinden? Wie geht es uns mit archaischen Formen der Musik? Mit Trommelrhyhtmen, Herztönen, Pulsationen, Vibrationen, Gesängen ohne semantischer Bedeutung?
Bergen unsere „alten“ Hirnteile Erinnerungen so wie sie das mit unseren Reflexen tun? Bewahren sie Erinnerungen und Teile unseres Selbsts in eben diesen genannten Entwicklungsstadien - seit lebensgeschichtlicher Urzeit gleichgeblieben?“ (Welt der Wunder, Begleittext. SAT 1, 25.1.1998)
Ein schöner Text, der inhaltlich nicht mehr haltbar ist, auch wenn er ein noch so scheinbar logisches und einfach nachvollziehbares Vorstellungsmodell bieten würde.
Sicher hat sich der Mensch, von seiner kognitiven Potenz her gesehen, weit von seinen Anfängen entfernt. Das ist erstaunlich und gut so, aber davonlaufen kann er seinen Ursprüngen nicht - und wir zahlen unseren Preis.
In der Zeitrechnung der Evolution saßen wir vor zwei Sekunden noch auf den Bäumen.
3.2 Haeckels Mär(chen)
Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass dies keine Rechtfertigung des immer noch kursierenden Biogenetischen Grundgesetzes nach HAECKEL darstellen soll. Der Mensch durchläuft in seiner Ontogenese sicher nicht die gesamte phylogenetische Stammesgeschichte. Was sich ändert, ist das Erscheinungsbild, nicht jedoch das ganze Wesen. (vgl.: MATURANA/VARELA: Der Baum der Erkenntnis.1987, S.83ff u. S.104ff.)
KÜKELHAUS beschreibt die pränatale Entwicklung des Menschen als „Prozess des Selbstaufbaus des Embryos, der sich als leiblich-geistige Einheit und in Übereinstimmung mit den universalen Gesetzmäßigkeiten vollzieht.“
„Nachdem man seit 20 Jahren die menschliche Ontogenese mikroskopisch gut kennt, hat man das Haeckelsche Grundgesetz von der Rekapitulation der Phylogenese während der Ontogenese des Menschen nachgeprüft und zum Erstaunen feststellen müssen, dass es nicht stimmt. Es lässt sich keine Rekapitulation finden.“ (BLECHSCHMIDT 1978,S.12)
Blechschmidts Begründung besagt im Kern: Da sich der Mensch aus einem menschlichen Ei entwickelt, ist er von Anfang an Mensch. Er entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern ist von Anfang an Mensch.
„Im befruchteten Ei ist aufgrund des vollständigen Chromosomensatzes, der in seiner Ganzheit spezifisch menschlich ist, bereits das Wesen des Menschen gegeben. Das Wesen bleibt während der ganzen Entwicklung konstant – was sich ändert, ist das Erscheinungsbild. Aus diesem Grund spricht Blechschmidt
auch von Phänogenese. (...) Es ist eine geistige Leib – Seele – Einheit, die das Wesen des Menschen ausmacht.“ (DEDERICH 1996,S.133f.)
Diese Ausführungen erachte ich aus folgenden Gründen für sehr wichtig:
- Nicht nur die weitverbreitete Ansicht, sondern auch noch viele wissenschaftliche Berichte und Konzepte basieren auf Haeckels Ideen.
- Die Sonderpädagogik – neueren Datums – fand in diesen Erkenntnissen viele Einsichten und Erklärungsversuche einer neuen Anthropologie.
- Ein Mensch kann nicht mehr auf vormenschliche Entwicklungsstufen definiert werden. Menschen können nicht mehr als Ding (Tier) gedacht werden. Eine „Praktische Ethik“ Singers erscheint im neuen Licht nicht nur als verwerflich, sondern auch als unrichtig, überholt und unhaltbar.
- Kein Mitglied der menschlichen Art kann mehr aus dieser „ausdefiniert“ werden. Damit fällt die besondernde Behandlung bzw. die Rechtfertigung der Tötung von Neugeborenen oder Embryonen aufgrund einer (vermeintlichen) schwersten Beeinträchtigung.
Dies sollte zumindest so sein. Alleine die neuen Diskussionen in der EU bezüglich Organentnahmen oder anderen medizinischen Eingriffen an Menschen mit Behinderungen müssen betroffen und kampfbereit machen.
- Die sich immer mehr durchsetzenden Modelle und Erkenntnisse der Systemtheorie (MATURANA, VARELA) des systemischen Konstruktivismus (VOSS u.a.) oder auch der wiedererstandenen Phänomenologie (STINKES, FORNEFELD, LÜBKE, u.a.) gewinnen neue Bedeutung. Dies ist gerade unter dem Aspekt einer Pädagogik für Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen, die sich immer größeren Rechtfertigungen stellen muß, äußerst begrüßenswert.
4 Der Ursprung des Rhythmus und seine Bedeutung für unser Dasein
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zunächst entwickeln sich die Hautsinne. Die Haut als größtes Sinnesorgan, als Abgrenzung, als Hülle und als Kontaktorgan. Der Gleichgewichtssinn steht an zweiter Stelle in der Hierarchie der Sinnesentwicklung. Platz drei nimmt der Gehörssinn ein, was seine Bedeutung für das System Mensch unterstreicht. (vgl. SCHINDLER 1995, S. 14f., MONTAGU 1988, S. 181ff., u.a.)
Das Gehör mit seinen 30.000 Haarzellen in der Cochlea ist auch der Sinn, der am exaktesten messen kann. Der range unseres Auges ist ungefähr eine Oktave breit, aber wir hören mit einem range von 10 Oktaven. „Das Ohr mißt - das Auge schätzt“ (vgl. BERENDT 1993, S. 19f.)
„Heute wissen wir, daß der Fötus zwischen der 26. und 28. Woche in der Lage ist zu hören. Neben den Herztönen der Mutter kommen noch eine ganze Reihe von Höreindrücken hinzu, die mit unterschiedlichsten Informationen versehen über die Knochen und Flüssigkeitsleitung an das Ungeborene gelangen. Dabei handelt es sich um Geräusche, die von der Magen- und Darmregion, dem Puls sowie der Atmung der Mutter stammen. Es geht um Blutgeräusche vor allem der Hautpartien, welche die Placenta und den Uterus versorgen. Es ist aber auch die Stimme der Mutter beim Sprechen und beim Singen. Alle klanglich-rhythmischen Reize während der pränatalen Entwicklung werden dabei als permanente bzw. immer wieder auftretende Hör- und Druckimpulse vom Ungeborenen wahrgenommen. Diese Einflüsse, vor allem zwei bis fünf Monate vor der Geburt, wirken sich prägend auf das gesamte spätere Verhalten, insbesondere auf das Rhythmus- und Musikempfinden aus.“ (VOGEL 1995, S. 38)
„Eine Zwischenstellung zwischen Nahsinnen und Fernsinnen nimmt das Gehör ein. Die enge Verbindung von Rhythmus, Musik und Bewegung im Tanz entspricht durchaus seiner Stellung in der Entwicklungsreihe. Zunehmend wird nun auch strukturierte Erfahrung möglich. Es ist die Wahrnehmung spezifischer Muster anzunehmen.“ (SCHINDLER 1995, S. 15)
Muster, die verbunden werden mit Bekanntem, also mit Vertrautem und Wohlbefinden einerseits, sowie mit Fremdem, also Angstbesetztem und Stressauslösendem. Durch das Hören - gemeint ist ein breiter Hörbegriff, der sich nicht nur auf auditive Reizaufnahme beschränkt, sondern ein Hören mit den drei Sinnen: Haut, Gleichgewichtssinn und Hörsinn - durch dieses Hören entsteht eine neue Qualität in der Embryo-Mutter-Einheit: Es entwickelt sich ein symbiotisches Verhältnis mit kommunikativem Austausch. Prägungen bis hin zur Bildung von persönlichen Vorlieben finden statt. Ein erstes Lernen und Verknüpfen, das bereits ein Gefühl des „Selbst- oder Da-Seins“ bedingt.
„Die „Öffnung“ der Klangwahrnehmung vollzieht sich dann schrittweise von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, mindestens aber bis ins elfte Lebensjahr. Die Geburt bedeutet eine grundlegende Veränderung für das Gehör, da der Hörapparat, der bis dahin an das flüssige Umfeld im Uterus gewöhnt war, sich plötzlich an eine luftgefüllte Umgebung anpassen muß. Bei der Geburt erlebt man also eine regelrechte „klangliche Niederkunft“. Zwei Partien im Ohr des Säuglings nämlich das Außen- und das Mittelohr müssen sich an die Impedanz der umgebenden Luft gewöhnen, während der dritte Abschnitt, das Innenohr, sein flüssiges Milieu beibehält. Was die beiden ersten Partien betrifft, verharrt das Kind in Bezug auf seine Klangempfindung in einem Zwischenstadium. Tatsächlich verbleibt im Mittelohr, und besonders in der Eustachischen Röhre, noch zehn Tage lang genügend Fruchtwasser, um die Frequenzen beibehalten zu können, an die sie im Uterus gewöhnt waren.“ (TOMATIS 1997, S. 186)
„Der Säugling erkennt die Stimme wieder, die ihn so lange im tiefen Dunkel des Uterus unterhalten hat.“ (TOMATIS 1997, S. 169)
„An anderer Stelle betonte er (gemeint ist NEGUS 1944), dass Singvögelküken, die von einem Weibchen einer anderen Singvogelart mit anderen Tönen ausgebrütet wurden, sich leicht im Gesang irren! Daraus schloß ich, dass bereits im Ei-Stadium eine audiovokale Konditionierung möglich ist.
Konrad Lorenz sollte später den schlagenden Beweis dafür liefern. In Ermangelung einer Mutterente begann er selber regelmäßig mit einem Entengelege zu reden. Als die Küken schlüpften, waren sie so an seine Stimme gewöhnt, dass sie alles andere stehen und liegen ließen, inklusive ihrer Mutter, wenn er nach ihnen rief. Offenbar erkannten sie die Modulation wieder, die sie im pränatalen Zustand ~ also noch im Ei ~ verinnerlicht hatten, und wagten sich ohne Zögern zu deren Quelle vor, als knüpfte sich mit jedem neuen Sprachkontakt wieder ein geheimes und unauflösliches Band zwischen ihnen.“ (TOMATIS 1997, S. 166)
In seiner Neotonie – Bibel „Zum Kind reifen“ schreibt Ashley MONTAGU über den Tanz: „ dass Kinder offensichtlich mit einem natürlichen Gefühl für Rhythmus geboren werden, und man kann mit einigem Recht annehmen, dass dieser Sinn sich im mütterlichen Schoß entwickelt, vielleicht zum Teil infolge des Wiegens und Schaukelns, (...), und der Tatsache, dass sein Herzschlag dem mütterlichen Herzschlag antwortet. Das kleine Kind ist bereits
eingestimmt auf die fundamentalen Rhythmen des Daseins: der Tanz des Lebens hat schon begonnen (...). Es ist faszinierend zu sehen, wie zwei- und dreijährige Kinder ganz spontan oder beim Anblick anderer Tänzer in einen rhythmisch einwandfreien Tanz verfallen, unabhängig davon, welche Art von Musik gerade gespielt wird.“ (MONTAGU 1984, S.255)
„Das Baby weiß nur, daß der tröstliche, beruhigende Rhythmus des Herzens eine der wichtigsten Gegebenheiten seiner Welt ist. Es schläft beim Klang des Herzens ein, wacht damit auf, bewegt sich und ruht in seinem Rhythmus. Da der menschliche Geist sogar schon im Mutterleib mit Symbolen arbeitet, versieht der Fötus den Herzschlag allmählich auch mit einer symbolischen Bedeutung. Das stetige Bum-Bum versinnbildlicht schließlich für das Kind Ruhe, Sicherheit und Liebe.“ (VERNY 1995, S. 22)
„Dr. Albert Liley hat auch beobachtet, daß Versuchspersonen, die man auffordert, ein Metronom auf einen beliebigen Rhythmus einzustellen, meistens einen zwischen 50 bis 90 bpm wählen.
Der Wissenschafter Elias Carnetti vermutet, daß die Erinnerung an den mütterlichen Herzschlag auch viele unserer musikalischen Neigungen erklärt. Alle bekannten Trommelrhythmen - bemerkt er - entsprechen einem von zwei Grundmustern, entweder dem schnellen Trappeln von Tierhufen oder dem gemessenen Schlag des menschlichen Herzens. Der Trappel-Rhythmus ist leicht zu verstehen - ein Überbleibsel aus unserer fernen Vergangenheit als Jäger. Und doch überwiegt in der ganzen Welt der Herzschlag-Rhythmus, sogar bei den noch heute existierenden Jägervölkern.“ (VERNY 1995, S. 32)
Wobei zu bemerken ist, daß wir uns doch immer noch wie Jägervölker benehmen. Allein unsere Infrastruktur hat sich gewandelt, dadurch zwingend auch unser Jagdverhalten, was sich gemeinsam zum eigentlichen Stadtneurotiker weiterentwickeln mußte, denn unser strukturelles Driften (vgl. MATURANA/VARELA 1984, S.127 ff.) brachte uns noch kein großes Stück von der Stufe des Jägers und Sammlers weg. Wohin auch? Auch denke ich, ist eine Unterscheidung in Herzschlag- und Jäger-Rhythmus einfach ein wenig zu flach. Viel wesentlicher erscheint mir eine Unterscheidung in auf- und absteigende Zweierrhythmen- und deren Wirkung, wie Aufbruch und Heimkehr, Erfolg und Misserfolg sowie die von FLATISCHLER beschriebene Fähigkeit des Herzschlages beide Urmuster zu produzieren: Den 2er- und den 3er Rhythmus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text befasst sich mit der Bedeutung von Rhythmus, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Es untersucht die pränatalen Ursprünge des Rhythmusgefühls und wie musikalische Interaktion pädagogische und therapeutische Vorteile bieten kann. Der Text beleuchtet auch die Bedeutung einer phänomenologisch fundierten Pädagogik, die die individuellen Erfahrungen und das Potenzial jedes Schülers berücksichtigt, unabhängig von seinen Beeinträchtigungen.
Welche Rolle spielt der Rhythmus in der frühkindlichen Entwicklung?
Der Rhythmus spielt eine entscheidende Rolle in der frühkindlichen Entwicklung, beginnend im Mutterleib. Die Herztöne der Mutter, ihre Stimme und die rhythmischen Bewegungen des Körpers des Babys prägen die Sinneswahrnehmung des Kindes. Diese Erfahrungen schaffen eine Grundlage für das spätere Rhythmus- und Musikempfinden. Die frühe Wahrnehmung von Rhythmus wird mit Sicherheit, Trost und Liebe assoziiert.
Was ist die Bedeutung der "psychovegetativen Stimulation des autopoietischen Systems"?
Dieser Ausdruck betont die Idee, dass Rhythmus und Musik das sich selbst organisierende System des Menschen (das autopoietische System) stimulieren können. Dies deutet darauf hin, dass rhythmische Erfahrungen das Wohlbefinden und die Entwicklung fördern, indem sie das innere System des Körpers und Geistes anregen und selbstständige Prozesse initiieren, die positive Auswirkungen haben.
Wie kann man Menschen mit Beeinträchtigungen mithilfe von Rhythmus und Musik unterstützen?
Der Text schlägt vor, dass Rhythmus und Musik Möglichkeiten zur Interaktion, Kommunikation und emotionalen Ausdruck bieten können. Insbesondere für Schüler mit schweren Beeinträchtigungen, kann Musik eine Verbindung zu Lebenserfahrungen herstellen, die vor der Beeinträchtigung liegen. Dies können Erfahrungen der Sicherheit, des Wohlbefindens und der Zugehörigkeit sein, die durch rhythmische Aktivitäten wie Wiegen, Schaukeln und das Spielen von Instrumenten wiederbelebt werden können. Der Einsatz von Rhythmus kann das Selbstvertrauen und die Dialogfähigkeit fördern.
Was wird unter einer "therapeutisierten Pädagogik" oder "pädagogisierten Therapie" verstanden?
Dieser Punkt thematisiert die Überschneidung von pädagogischen und therapeutischen Ansätzen. Es stellt die Frage, ob Pädagogik therapeutische Elemente einbeziehen oder Therapie pädagogische Prinzipien nutzen sollte. Das Konzept des "offenen Unterrichts" wird als Konsequenz genannt, bei dem die individuellen Bedürfnisse und Potenziale der Lernenden im Vordergrund stehen, um eine unterstützende und entwicklungsfördernde Umgebung zu schaffen.
Welche Kritik wird an Haeckels biogenetischem Grundgesetz geübt?
Der Text kritisiert Haeckels biogenetisches Grundgesetz, wonach die Ontogenese die Phylogenese rekapituliert. Es wird argumentiert, dass der Mensch von Anfang an Mensch ist und sich nicht erst zu einem solchen entwickelt. Diese Sichtweise hat wichtige Auswirkungen auf die Sonderpädagogik und die Ethik, da sie die Vorstellung ablehnt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auf vormenschliche Entwicklungsstufen reduziert werden können.
Welche praktischen Beispiele werden im Text gegeben?
Der Text enthält Beispiele aus der Praxis, die sich auf den Morgenkreis, die Musikstunde und individuelle Erfahrungen von Schülern mit Beeinträchtigungen beziehen. Zu den praktischen Beispielen gehören der Einsatz von Instrumenten (Conga), der Klangwiege, Kartonrohren und andere rhythmische Aktivitäten, die dazu dienen sollen, Spass und Lernerfahrungen zu fördern.
Was ist die Bedeutung der Hautsinne, des Gleichgewichtssinns und des Gehörs?
Die Reihenfolge der Sinnesentwicklung - Hautsinn, Gleichgewichtssinn, Gehörssinn - unterstreicht die Bedeutung des Hörens für den Menschen. Das Gehör, mit seiner Fähigkeit zur präzisen Messung, ermöglicht die Wahrnehmung eines breiten Spektrums von Klangmustern und die Verknüpfung mit Bekanntem und Unbekanntem. Diese Sinneswahrnehmungen tragen zur Entwicklung eines symbiotischen Verhältnisses und eines Gefühls des "Selbst- oder Da-Seins" bei.
Welche Autoren und Theorien werden in diesem Text erwähnt?
Der Text bezieht sich auf verschiedene Autoren und Theorien, darunter:
- MATURANA/VARELA (Autopoietisches System, Systemtheorie, strukturelles Driften)
- MONTAGU (Neotonie, Bedeutung der pränatalen Entwicklung)
- TOMATIS (Klangwahrnehmung)
- KÜKELHAUS (pränatale Entwicklung)
- BLECHSCHMIDT (Phänogenese)
- HAECKEL (Biogenetisches Grundgesetz - kritisiert)
- AYRES (Interpendenz der Hirnstrukturen)
- BERENDT (Bedeutung des Hörens)
- VERNY (pränatale Psychologie)
Darüber hinaus werden Konzepte wie die Systemtheorie, der systemische Konstruktivismus und die Phänomenologie erwähnt.
- Quote paper
- Klaus Tolar (Author), 1999, Rhythmus meint Erfahrung und Spass, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103179