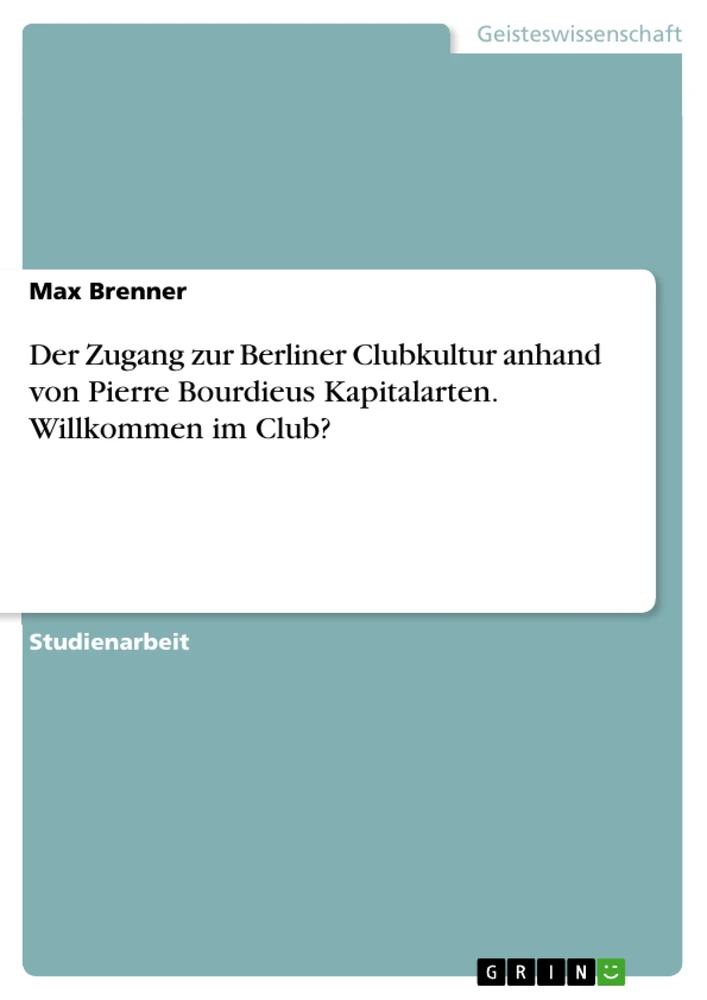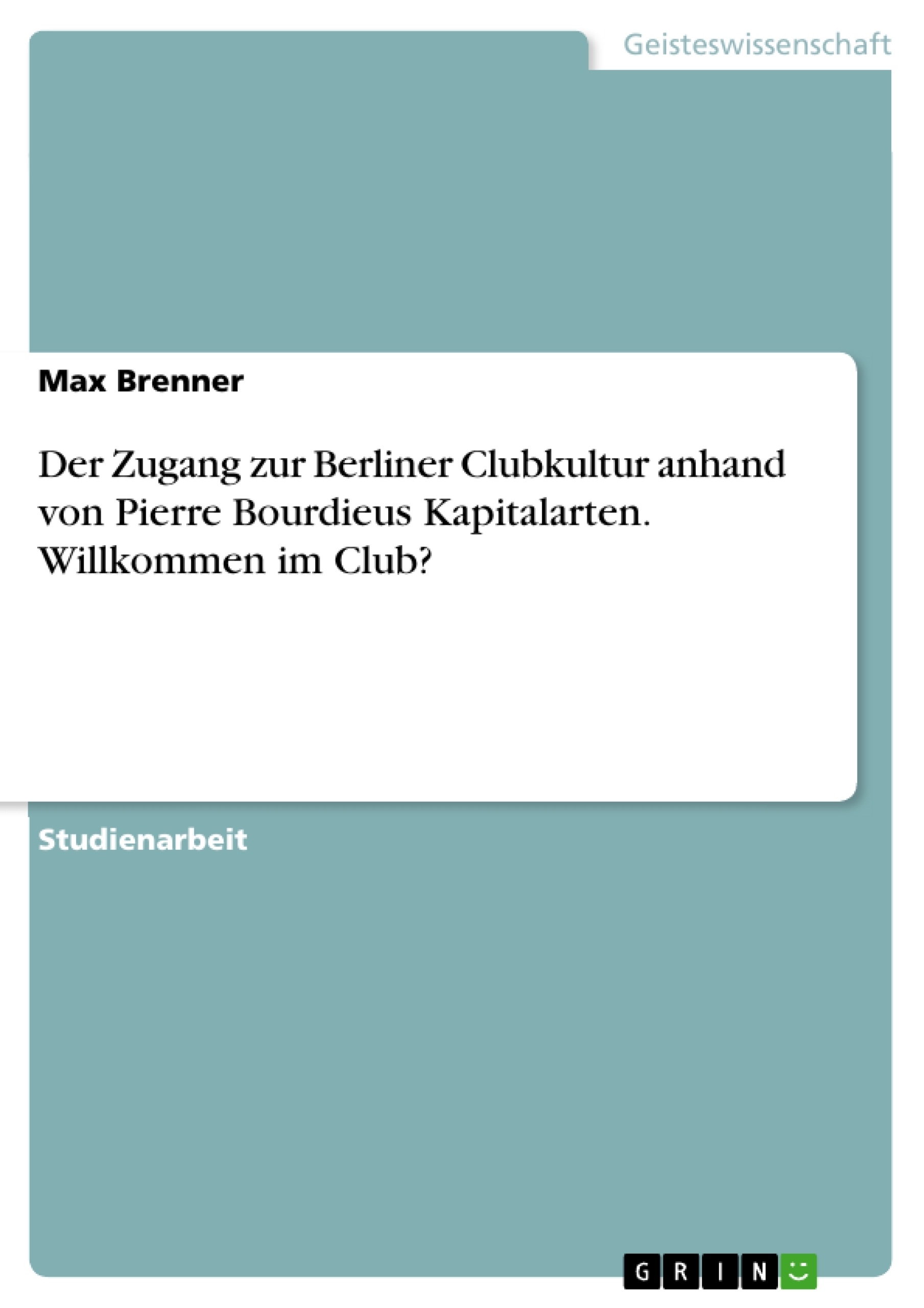Berlin ist berühmt für seine exzessive und ausschweifende Clubkultur diverser Genres der elektronischen Musik. Doch was macht sie aus? – anders gefragt: Welche Indikatoren machen sie weltweit zu einem äußerst beliebten Ziel, einerseits für Touristen, andererseits auch für Einheimische? Sind es lediglich hedonistisch anmutende Orte, bei denen es darum geht, dem Alltag zu entfliehen? Oder ist es viel mehr ein durchgeplantes und inszeniertes Gestaltungskonzept, welches den Besuchern das Gefühl gibt, hinter dem Eingang eine eigene Welt zu betreten?
Oft ist dabei die Rede von der „typisch-berlinerischen“ Atmosphäre, welche sich neben der gespielten Musik auch in der Gestaltung der Räumlichkeiten beziehungsweise in deren Inszenierung findet. Jedoch hat die große Beliebtheit zur Folge, dass nicht alle Zugang erhalten und folglich am Eingang eine Selektion stattfindet. Das Resultat ist eine Exklusivität und sind interne und clubeigene, soziale Strukturen. Die Arbeit widmet sich insbesondere der Analyse des Zugangs zur Clubkultur. Anhand Pierre Bourdieus Konzept der „Kapitalarten" wird exemplarisch untersucht, was die Teilnahme bzw. die Zugehörigkeit zur Techno-Szene in Berlin ermöglicht und welche Voraussetzungen dafür entscheidend sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Berliner Clubkultur
- Pierre Bourdieu - Die Kapitalarten
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Zwischenfazit
- Fallbeispiele
- Das Berghain
- Die Rummels Bucht
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Zugang zur Berliner Clubkultur anhand der von Pierre Bourdieu entwickelten Kapitalarten (ökonomisch, kulturell, sozial). Ziel ist es, zu verstehen, welche Kapitale den Zugang zu bekannten Institutionen bestimmen und wie diese sich in der Praxis manifestieren. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Bedeutung des subkulturellen Kapitals für die Zugehörigkeit zu einer Clubszene.
- Analyse der Kapitalarten (ökonomisch, kulturell, sozial) im Kontext der Berliner Clubkultur
- Untersuchung der Bedeutung des subkulturellen Kapitals für die Zugehörigkeit zu einer Clubszene
- Analyse von Fallbeispielen: Das Berghain und die Rummels Bucht
- Hervorhebung der Unterschiede in den Zugangsmöglichkeiten und der Bedeutung der jeweiligen Kapitalarten
- Erarbeitung des Konzepts der "typisch-berlinerischen" Clubkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Berliner Clubkultur vor und skizziert die Fragestellungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden. Kapitel 2 liefert eine Einführung in die Berliner Clubkultur und beleuchtet die Entwicklung von illegalen Veranstaltungen zu professionellen Clubinstitutionen. Kapitel 3 stellt Pierre Bourdieus Theorie der Kapitalarten (ökonomisch, kulturell, sozial) vor und zeigt ihre Relevanz für den Zugang zu verschiedenen Institutionen auf. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Analyse der Kapitalarten im Kontext der Berliner Clubkultur zusammen. Kapitel 5 untersucht zwei Fallbeispiele: das Berghain und die Rummels Bucht. Diese beiden Clubs zeichnen sich durch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten und die Bedeutung der jeweiligen Kapitalarten aus. Die Ergebnisse der Fallbeispiele werden in Kapitel 5.4 zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Berliner Clubkultur, Pierre Bourdieu, Kapitalarten, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, subkulturelles Kapital, Zugang, Exklusivität, Szene, Berghain, Rummels Bucht.
- Arbeit zitieren
- Max Brenner (Autor:in), 2020, Der Zugang zur Berliner Clubkultur anhand von Pierre Bourdieus Kapitalarten. Willkommen im Club?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1030205