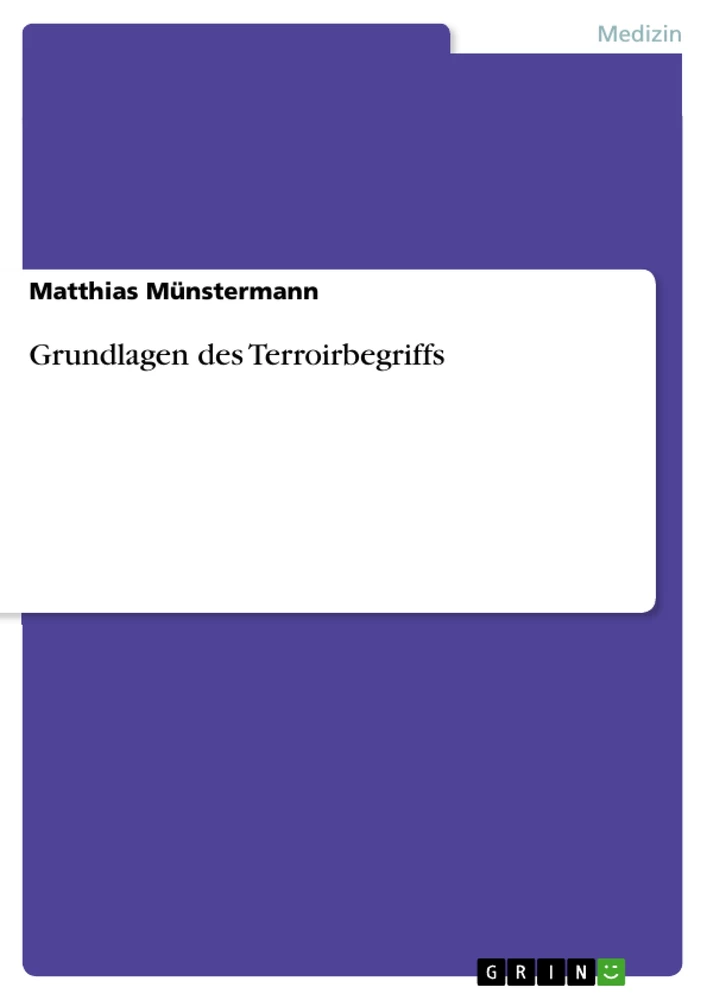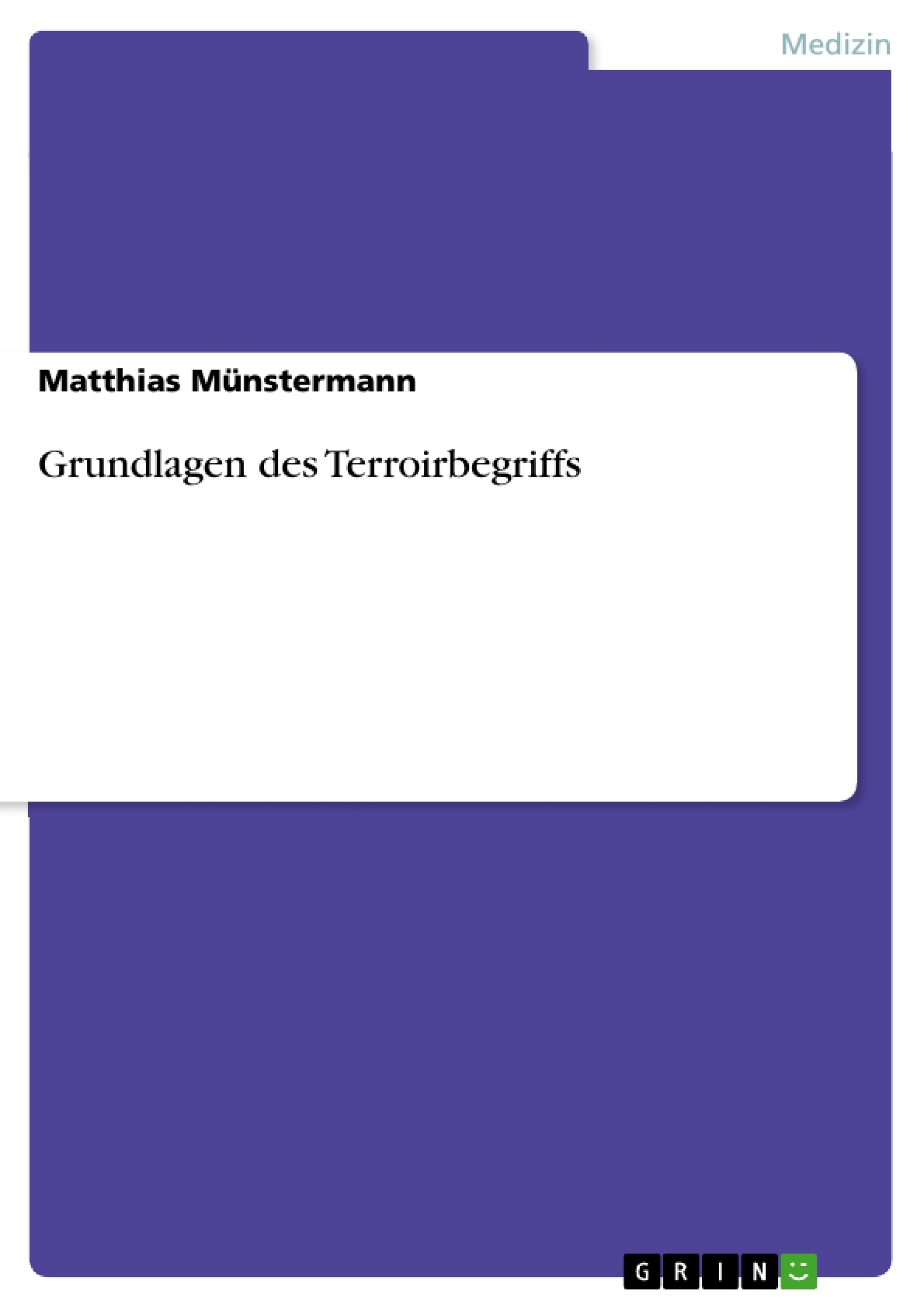Grundlagen des Terroirbegriffs
Allgemeine Einführung
Terroir ist ein typisch französischer Grundgedanke, der die gesamte natürliche Umgebung einer Weinbaulage erfasst.
Man kann es als einen begrenzten Raum definieren, in dem die physikalischen und chemischen Naturbedingungen, die geographische Situation und das Klima es erlauben spezifische und identifizierbare Produkte zu erzeugen.
Terroir wird geprägt durch die Interaktion von mehreren Faktoren wie Boden, Lagenausrichtung und Neigung, Klima, Rebsorte, und natürlich dem Anbau und Ausbau der Weine durch den Winzer. Terroir als solches ist ein vieldiskutierter Begriff.
Die ganzheitliche Kombination der genannten Faktoren verleiht jeder Lage ihren ganz bestimmten Charakter, der sich dann in ihren Weinen über die Jahre hinweg, mehr oder weniger einheitlich, ausdrückt.
Ein wesentlicher Grundgedanke des Terroirs ist, daß die ihn bestimmenden Komponenten naturgegeben und durch Pflegemaßnahmen nicht wesentlich beeinflussbar sind Die wichtigsten Komponenten des Terroirs sind:
-Die Geologie
-Der Boden
-Die lokale Topographie der Lage
-Das Klima / das Makroklima / das Mesoklima / das Mikroklima
-Die Rebsorte, ihre Auswahl, Erziehung und Pflege
-Anbau und Ausbau der Weine / Die Signatur des Winzers Natürlicher Geschmack ohne Verdrängung des Terroircharakters
Die folgenden Kapitel werden die genannten Faktoren einzeln beleuchten, um das Phänomen "Terroir" als Ganzes begreifbarer zu machen.
Die Geologie
Grundsätzlich definiert man die Gesteine als ein Gemenge von Mineralien, die sich in Entstehungszeit, chemischer Zusammensetzung, Farbe, Härte sowie in Kristallisationsform und Größe unterscheiden.
Man unterteilt sie in 3 Hauptgruppen von Gesteinen:
- Erstarrungs- oder Magmagesteine
- Sediment- oder Absatzgesteine
- Metamorphe -oder Umwandlungsgesteine
Erstarrungsgesteine bestehen im Ursprung aus einer magmatischen Grundmasse, aus der jedoch verschiedenartige Gesteine hervorgehen können. Diese unterscheiden sich dann vor allem in ihrer Struktur. Langsames Abkühlen der Magma führte bei vielen Tiefengesteinen (Plutoniten) zu einem grobkristallinen Gesteinsgefüge. (granum, lat.= das Korn - Granit)
Ergussgesteine (Vulkanite), die rasch erkalteten, haben meist eine feinkristalline, luftige Struktur. (Basalt, Tuff)
Grundsätzlich sind Magmagesteine meist ungeschichtet und werden auch als Massengesteine bezeichnet.
Die Tiefengesteine bilden den Untergrund aller anderen Gesteine und sind als eingebundener Kern in allen Gebirgen anzutreffen. Vulkanite breiten sich als Decken über anderen Gesteinen aus und bilden Bergkuppen oder einzelne Kegel. (Kaiserstuhl).
Sedimentgesteine können durch mechanische, organische oder chemische Veränderung eines Grundgesteins entstanden sein.
Aus,
- durch Sonne, Wasser, Frost und Eis verwitterten und abgesprengten Trümmergesteinen,
- den als Resten von Pflanzen und Tieren abgelagerten organischen Sedimenten
- sowie den chemischen Sedimenten, die nach Wasserverdunstung als Bodenschichten zurückblieben ( Salz, Kalk oder Dolomit )
entstehen durch Bindemittel wie Kalk-, Kiesel- oder Eisensalzlösung und hohem Druck Sedimentgesteine.
Sie weisen eine deutliche Schichtstruktur auf.
Umwandlungsgesteine können aus Sedimentgesteinen aber auch aus den Erstarrungsgesteinen infolge hohen Drucks und großer Hitze entstehen. (Marmor als eine Metamorphose aus Kalkstein)
Welchen Einfluss nun die Gesteinsunterlage und -struktur eines Weinbergs auf die Qualität des Weines hat, wird konträr diskutiert und bewertet. Fest steht jedoch, daß die aus den Grundgesteinen durch Verwitterung hervorgehenden Böden, in ihrer Art und Struktur, die Reben und ihren Wein entscheidend prägen.
Die Geologie Frankreichs
Alle der Geologie bekannten Gesteinsarten, sowie alle bedeutenden Bewegungen der Erdkruste sind in Frankreichs Gebirgs- und Landschaftsprofil nachzuweisen und wiederzuerkennen. Mag das Gestein durch Bodenbildung oder Vegetation verdeckt sein, ist es dennoch allgegenwärtig und wird spätestens durch Ausgrabungen oder an Hangabbrüchen sichtbar. Sämtliche Porträtprofile der Gesteine beziehen sich auf die Farbtafeln 1 & 2
(Entliehen "Terroir, James E. Wilson, Hallwag Verlag) Legende:
Rosa und rote Bereiche bezeichnen die Ur oder Grundgesteinsockel aus grobkristallinen Gesteinen wie Granit und Gneis.
Diese sehr alten Gesteinsarten, die aus schmelzflüssigem Zustand heraus unterirdisch kristallisiert sind ( Plutonite) und später durch Anstiegsbewegungen zur Erdoberfläche befördert wurden, sind sehr widerstandsfähig und werden durch Erosion und Verwitterung weicherer Nachbarschichten freigelegt und bilden Gebirgsmassive wie das Massiv Central im Zentrum Frankreichs.
Tiefblaue Spritzer im Inneren dieser Granitformationen sind Lavaströme (Basalt und Tuff) die im späten Tertiär und Quartär durch Spalten im Grundgestein an die Oberfläche getreten sind. ( Vulkanite)
Braune und olivgrüne Bereiche, Streifen und Flecken, innerhalb der Gebirgsmassive (Massif Armoricain, Massiv Central, Ardennes) sind paläozoische (Erdaltertum vor 550 Mio. Jahren), metamorphe Schichten, die unter starker Hitze und hohem Druck, physikalischen und chemischen Veränderungen unterlagen und in großer Tiefe entstanden sind. Durch solche Vorgänge entstehen Gesteinsformen wie Tonschiefer zu kristallinem Schiefer, Sandstein zu Quarzit, Kalkstein zu Marmor.
Die meisten Weinanbaugebiete Frankreichs liegen auf Gesteinsarten des Mesozoikums (Erdmittelalter vor 230 Mio. Jahren) oder einer jüngeren Ära.
Es beginnt mit der Trias, die charakteristisch mit einer Dreiteilung der Gesteine einhergeht. ( Buntsandstein -Muschelkalk - Keuper ) Auf der Farbtafel ist sie in lavendelblauer Farbe dargestellt. Vor 250 Mio. Jahren ähnelte der westliche Teil Frankreichs wahrscheinlich einer roten Felsenwüste, wie wir sie noch heute aus dem Südwesten Amerikas in Arizona kennen.
Die Sandsteinfamilie, als Absatz bzw. Sedimentgestein, sind auf der Farbtafel rosa dargestellt, weil sie direkt durch Verwitterung der rot markierten Granite entstanden sind.
Salzseen in dieser Wüstenlandschaften bildeten Salz und Gipsschichten, die in späterer Entwicklung zu Sollbruchstellen wurden, als es durch Horizontalspannungen bei der Bildung der östlichen Jura- und Voralpenberge zur Aufwölbung der Erdkruste kam. Durch diesen Einschnitt und das dadurch vordringende und sich vertiefende Meer, sammelten sich in der jüngeren Trias, Tonschiefer, Mergel (erdiger, kalkhaltiger Ton), und Dolomitgesteine(Sedimentgestein, das zu mehr als der Hälfte aus Kalziummagnesiumkarbonat besteht) an, die jetzt die Weinbergsböden im Elsass und Jura bilden.
Buntsandstein bedeckte weite Flächen Nordostfrankreichs.
Auch die Vogesen zählten zu diesem Gebiet, jedoch wurden bei Ihrer Entstehung große Teile der Sandgesteine durch Erosion vollständig abgetragen, sodaß heute an vielen Stellen, besonders im südlichen Teil, nur das rein kristalline Granitgestein zurückblieb. An ihren Osträndern findet man jedoch in Granithöhlen noch immer Buntsandstein als Erosionsrelikt dieser Entwicklung. Die Entstehung des Oberrheingrabens lies Gesteine mehrere hundert Meter ins Tal abrutschen und ermöglichte die Bildung von Mergel, Schiefer, Dolomit und Sandstein.
Das Juragestein, auf der Karte die blaue Umrandung des Pariser Beckens sowie der Nordrand des Aquitanischen Beckens hat seinen Namen vom Juragebirge, das sich wie ein Halbmond an der französisch-schweizerischen Grenze entlang erstreckt, an dem es erstmals erforscht und bestimmt wurde.
Es ist sozusagen das französische Nationalgestein.
Es entstand vor ca. 190 Mio. Jahren, in einer Zeit in der sich in stillen, warmen Meeren Kalkgesteine sedimentieren konnten.
Viele der "großen Weinbaugebiete", Chablis, die Côte d´Or , Sancerre, Teile des Elsass und der Champagne sowie das nördliche Cognacgebiet liegen auf Jurakalk. Die Namen zweier Bereich der Cognacregion, Grand und Petit Champagne erinnert noch heute an die geologische Verwandtschaft.
Das Pariser Becken gleicht einem grünen Auge mit gelber Pupille.
Das Grün bezeichnet Kreide, das Gelborange, das im spätenTertiär entstandene Ile-de-France Plateau, bestehend aus dicken Schichten von Oberkreide, die sich unterhalb des Ärmelkanals bis an die Felsküste Dovers erstrecken.
Die Weinbergsböden der Champagne sind ein Gemenge aus Tertiärsand und Ton, das von dem die Champagne umgebenden Plateau über die unterlagernde Kreide herabgespült wurde.
(Oberkreide). Zudem werden sie durch Sedimente von Muschelkalk und kalkhaltigen Algen der Meere in der Kreidezeit geprägt. Die Kreideschichten des aquitanischen Beckens an der südlichen Flanke des Massif Central wurde zusammen mit anderen Gesteinsschichten bei der Bildung der Pyrenäen hochgepresst. Gegen Ende des Tertiärs wurde es auf der Erde überaus kalt, die letzte große geologische Periode kündigte sich an.
Das Quartär, mit mehreren Eiszeiten.
Der erste Teil, die Pleistozän-Eiszeit, die vor etwa 2 Millionen Jahren begann, prägte mit letztem Schliff das geologische Relief des Landes.
Die Eiszeiten waren keine einzige, lange Gefrierphase, sondern es wechselten sich fünf Kältezeiten mit sechs wärmeren Zwischenzeiten ab, deren letzte wir heute als unser Klima erleben. Diese boten die Möglichkeit der Wachstumsperiode für Vegetation, Tiere und Menschen..
Dieser Wechsel von Gefrier und Auftauphasen die mit Meeresvorstößen und Rückflüssen verbunden waren, durchpflügte Landstriche und Gesteins-Formationen.
Ausprägungen dieser Zeit findet man vor allem im wohl bekanntesten französischen Weinbaugebiet, dem Bordeaux.
Die Kiesterrassenhügel an der Garonne und Gironde, die sich dort bei Überflutung abgelagert haben, finden ihren Ursprung in den bei den durch Frost abgesprengten Felsgesteinen der Pyrenäen.
Diese wurden durch das zurückweichende Wasser oder den Transport in den Moränen der Gletscher zu walnußgroßem Kies zerrieben und mit Unmengen von Schutt, Sand und Schlamm vermischt. Dieser Untergrund bringt heute die besten Weine der Welt hervor.
Im aquitanischen Becken bildete ein besonders ausgeprägter Meeresvorstoß, den nach seinem Reichtum an fossilen Seesternresten benannten calcair à astéries, den Sternenkalk.
Er bildet die Deckschicht in Bereichen von Bourg, Blaye, St. Emilion, Fronsac und Entre-deux-Mers und den Felsböden, auf dem Garonne und Gironde die Kiesterrassen von Médoc, Graves und Sauternes angehäuft haben.
Wie schon zu Beginn des Kapitels bemerkt, wächst die Rebe nicht direkt auf den Grundgesteinen, sondern wurzelt und ernährt sich aus deren direkten Verwitterungsprodukten, den Böden.
Die Böden
Als Boden versteht man die oberflächliche Erdauflage, in der Pflanzen, also auch der Weinstock, wurzeln und wachsen können.
Definiert wird er als ein, zu kleinen Fragmenten zerkleinertes, mehr oder weniger stark chemisch verändertes, mit den Resten der darauf oder darin lebenden Pflanzen und Tieren vermischtes Gestein. Das verwitterte Ausgangsgestein bildet das eigentliche Ausgangs- material des Bodens. Verwitterung ist ein mehrschichtiger Prozess von physikalisch - mechanischer Veränderung und Aufsprengung der Gesteine, bis zur chemischen Umwandlung der Bruchstücke in verrottetes Bodenmaterial.
Werkzeuge der physikalischen Verwitterung sind Wasser, Eis, Hitze, Wurzeln und Schwerkraft.
Die jahres oder tageszeitlich bedingte Temperaturwechsel, sowie Insolations-dauer und Intensität verursacht innerhalb der Gesteine Ausdehnungen und Schrumpfungen. Die dadurch resultierenden Spannungen im Inneren der Gesteinskörper bzw. im Mineral führen zu Rissen und Spalten.
Gleiche Auswirkungen finden sich bei Frost und Wurzelsprengung. Die chemische Verwitterung, ähnlich wie das Rosten von Metall, benötigt zwei wichtige Faktoren. Feuchtigkeit und Luft. Frisch entstandene Gesteinsoberflächen werden sofort von chemischen Prozessen und Reaktionen attackiert. Durch organische Säuren und Oxidation im Gestein eingelagerter Metalle kommt es zur Zersetzung der ursprünglichen Gesteinsstruktur.
Sämtliche chemische Prozesse werden durch Wärme begünstigt, sodaß man in warmen und gemäßigten Klimazonen von einer schnelleren Bodenbildung ausgehen kann.
Biologische Verwitterung, durch die im Boden lebenden Klein und Kleinstlebewesen hat zudem auch Einfluss auf die Bodenart und - struktur.
Die Zyklen der Mikroorganismen reichern zudem die Böden mit Nährstoffen an.
Bei ihrer Zersetzung hinterlassen sie Ammonium und Nitrat-Ionen die der Pflanze direkt verfügbar sind.
Bodenart und Struktur
Die Bodenart oder Bodentextur bezieht sich auf die Partikelgröße der Bodenkörnung. Sie entsteht durch die bei der Verwitterung veränderter oder völlig gelöster Gesteinen und Mineralen, die sich im Gegensatz zu den Ausgangsgesteinen durch andere Korngrößen, chemischer und kristallographischer Zusammensetzung auszeichnet.
Die Korngrößen, lassen sich in Ton, Schluff, Sand und gröbere Bodenskelette wie Steine und Kiese unterteilen.
Bodenarten bezeichnen ein in der Natur vorkommendes Gemisch verschiedener Korngrößen, wobei für die Benennung der Art die dominierende Korngröße entscheidend ist.
Diese Textur in Verbindung mit dem Tongehalt, der Menge an organischem Material und der chemischen Zusammensetzung der Flüssigkeiten im Boden hat direkten Einfluss auf die Bodenstruktur, diese wiederum auf den Fluss und die Speicherungsfähigkeit von Wasser im Erdreich und an der Oberfläche.
Ebenso sind die Durchlüftung und der Lockerungsgrad des Bodens von diesen Faktoren abhängig.
Der Anteil und die chemische Beschaffenheit des enthaltenen Tons ist ausschlaggebend für die Struktur des Bodens.
Montmorillonit-Tone, die meist aus unter kühlen und trockenen Bedingungen verwittertem Gesteinen oder Sedimenten entstanden sind, haben die Eigentümlichkeit zu quellen, wenn sie feucht sind und zu schrumpfen, wenn sie trocknen, um schließlich in kleine Fragmente zu zerbrechen und dadurch einen "selbstmulchenden" Bodencharakter hervorzubringen.
Andere Tonarten jedoch haben diese Eigenschaften nicht und bilden eine wasserundurchlässige und kaum durchdringbare Bodenschicht. Die verschiedenen Grundgesteinsarten haben typische Bodenpartikel. Alle Vorgänge, die zu Stoffneubildungen in der Verwitterungszone führen werden von verschiedenen, bodenbildenden Faktoren beeinflusst. Diese bilden und prägen das Bodenprofil und führen zur Ausprägung von Bodenhorizonten.
Zu diesen zählt man im allgemeinen Klima, Relief, Ausgangsgestein, Wasser, Flora und Fauna, menschliche Tätigkeit und die Zeit.
Klima und Boden
Das Klima ist oftmals der entscheidende und stärkste bodenbildende Faktor.
Der Einfuss des Klimas ist durch Temperatur, Niederschlag, sowie deren jahreszeitliche Verteilung gegeben. Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit beschleunigen bekanntlich die Verwitterung, weshalb im Bereich der tropischen Gürtel der höchste Grad chemischer Verwitterung zu erkennen ist.
In den gemäßigten Zonen hingegen, dominiert durch die Ausprägung der Jahreszeiten, die mit großen klimatischen Schwankungen verbunden sind, die physikalische Verwitterung z. Bsp.in Form von Frostsprengung.
Für die Bodenbildung hat die Durchfeuchtung des Bodens entscheidende Bedeutung. Damit ist der Teil des Niederschlages gemeint, der tatsächlich in den Boden eindringt und einsickert. Grundsätzlich gilt, das höhere Niederschläge stärkere und tiefere Verwitterungserscheinungen im Boden bedeuten. Diese Aussage kann allerdings nicht isoliert betrachtet werden, denn hohe Temperaturen (starke Verdunstung) oder ein steiles Landschaftsrelief (hohe Abflussgeschwindigkeit) müssen mitbetrachtet werden.
Relief:
Zunehmende Hangneigung potenziert die Wirkung von Bodenabtragungen und Erosion, sodass ausgeprägte Bodenprofile wie in Flachlagen nicht entstehen können. Auch die Exposition (Ausrichtung) der Lagen führt zu erheblichen Differenzierungen in bodennahen Klimabereichen, sodass man als Ergebnis der Betrachtung eine Reliefveränderung immer mit dem Wechsel im Wasser und Temperaturbereich des Bodens sehen muss. Erneut zeigt sich das untrennbare Zusammenspiel der einzelnen Faktoren.
Die Weinbaugebiete Frankreichs liegen überwiegend nördlich des 45. Breitengrades, und dort ist selbst im Sommer der Einfallswinkel der Sonne im Sommer relativ flach. Infolgedessen ist die Neigung und Ausrichtung der Weinberge von besonderer Wichtigkeit. Südost- bis Ostlagen gebührt hier der Vorzug., da nur hier die Sonnenstrahlen vom Morgen an einwirken und den Hang erwärmen können.
Wasser:
Das Vorhandensein von Wasser ist und bleibt für die meisten Verwitterungsvorgänge unerlässlich.
An den meisten Bodenbildungs- und Verwitterungsvorgängen sind Sickerwasser, Stauwasser, Haftwasser und Kapillarwasser beteiligt.
- Stauwasser bildet sich in schwer durchlässigen oder undurchlässigen Substraten durch Sickerwasser in der Nähe der Oberfläche.
- Sickerwasser ist das im Boden sich abwärts bewegende Wasser, soweit es nicht zum Grundwasser kommt.
- Haft- und Kapillarwasser ist entgegen der Schwerkraft gehaltenes Wasser (durch physikalisch bedingte Unterdruckverhältnisse )
Flora und Fauna
Wühlende und erdfressende Tiere führen zur Lockerung und Durchmischung der Böden, reichern sie mit organischem Material an und haben dadurch direkte Auswirkungen auf die Verwitterung und die Bodenbildung.
Die Vegetation schützt den Boden gegen Abtragung und bestimmt seinen Wasserhaushalt, durch direkten Verbrauch. Andererseits speichert das Blattwerk der Pflanzen Feuchtigkeit, was die Luftfeuchtigkeit und damit das Mikroklima in Bodennähe positiv beeinflusst
Bei bestimmten Landschaftsreliefen führt die Bodenvegetation mit ihrer Durchwurzelungstiefe zu einer Erhöhung der Versickerungsrate von ablaufendem Oberflächenwasser. Durch das Pflanzenwachstum entnommene Nährstoffe werden durch den zyklisch auftretenden Bestandsabfall an organischem Material (Laub, Nadeln, Rinde) wieder kompensiert.
Dieser Bestandsabfall ist Grundvoraussetzung für eine gesunde Humusbildung. Bei günstigen Bedingungen, wie guter Durchlüftung, Feuchtigkeit, hohem Nährstoffgehalt und reichlich vorhandenem Bestandsabfall bildet sich die terrestrische Humusschicht Mull. Sie prägt den mittleren PH-Wert des Bodens und ein enges Kohlenstoff / Stickstoffverhältnis (10 / 15).
Ein ideales Weinbergsmilieu.
Boden und Wein
Die alleinige, theoretische Betrachtung von Grundgestein und Böden zeigt jedoch noch nicht die Wirkung und Ausprägung auf den angebauten Weinstock. Die mineralische Konsistenz des Bodens ist im übertragenen Sinne die Speisekammer der Rebe. Sie ernährt sich von den ausgelösten Mineralwässern im Boden. Unterschiedliche Böden bringen unterschiedliche mineralische Nahrung für den Weinstock hervor. Nicht die übermäßige Menge sondern eine "ausgewogene Diät" an Nährstoffen bringt große Weine hervor. Üblicherweise erbringen kalkhaltige und nährstoffarme Böden besondere Weinqualitäten.
Prägt nun der Boden die Weinqualität ?
Für diese europäische Auffassung sprechen viele Gründe.
Die besten Pinot noir der Welt wachsen und gedeihen auf den Kalkböden der Côte d`Or im Burgund. Die Weine von Pouilly verdanken ihre Eigenart den mit Silex ( Feuerstein ) durchmischten Kalkböden an den Hängen der Loire. Einige Grand Crus aus dem Elsass erhalten ihr charakteristisches, mineralisches Geschmacksgerüst nur auf den Gneis-Verwitterungsböden am Fuß der Vogesen. Den Moselweine, besonders dem Riesling sagt man in einigen Bereichen ein Typisches Schiefer Bouquet nach. Nur die im Wasser gelösten Mineral-, Kohlen-, Stick- und Sauerstoffverbindungen sind für die Rebe verwertbar. Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, Kalzium, Magnesium, Kalium und Schwefel sind die wichtigsten Grundelemente für die gesunde Wachstumsentwicklung. (Makronährstoffe) Kohlenstoff und Wasserstoff werden zudem über das Blattwerk aus der Luft aufgenommen.
Mikronährstoffe sind Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Bor und Chlor; Stoffe, die häufig im Grundgestein eingelagert sind und dann ausgeschwemmt werden.
Auch die Bodenfarbe hat Auswirkungen auf die Bodentemperatur und auf die Lufttemperatur unmittelbar über dem Boden. Dunkle Böden absorbieren das darauffallende Licht und verwandeln es fast vollständig in Wärme; sie sind daher wärmer als helle Böden. Bei Nacht und an bewölkten Tagen geben sie dann auch mehr Wärme an die Reben und Trauben ab. Dies kann in kühlem, marginalem (grenzbereichsnah) Weinbauklima von wesentlicher Bedeutung sein, weil dadurch vollere Reife und bessere Qualität zustande kommt. Das Vorhandensein von Steinen im oder auf dem Weinbergsboden beeinflusst sowohl die Wasser- als auch die Temperaturverhältnisse. Hoher Steinanteil im Bodenprofil wird meist als günstig für den Wasserabfluß angesehen, senkt jedoch das Wasserspeichervermögen des Bodens. Dies fördert das Wurzelwachstum zur Sicherung der Wasserversorgung, was wiederum wünschenswert ist. Steine an der Oberfläche, bremsen das abfließende Oberflächen- wasser und schützen gegen übermäßige Verdunstung und Erosion.
Klima
- Klima ist die Gesamtheit der langfristigen Einwirkung von Temperatur, Feuchtigkeit und Wind, die für einen größeren, bestimmten geographischen Raum gelten.
- Witterung ist die abgrenzbare, für eine bestimmte Jahreszeit oft typische Abfolge atmosphärischer Zustände in einem bestimmte Gebiet.
- Das Wetter bezeichnet eine kurzfristigen, klimatischen Zustand, bezogen auf einen bestimmten, geographischen Bereich.
Makroklima
Makro- oder Regionalklima bezeichnet das Klima, das in einer ganzen Gegend oder Region im Umkreis von zehn bis hunderten von Kilometern herrscht.
Anders als die auf einen eingeschränkten Kreis abgestellten Begriffe Mikro und Mesoklima nähert sich das Makroklima eher dem, was normalerweise unter Klima verstanden wird. Es ergibt sich meist aus den klimatischen Aufzeichnungen (Wetterstationen) einer Großregion. Die geographische Breite, das Landesrelief, die allgemeine Luftzirkulation, sowie maritime oder kontinentale Einflüsse innerhalb des Gebietes prägen das Makroklima Durch Städtewachstum, Industrieansiedlung (Stadterwärmung) oder andere Veränderungen in der Kulturlandschaft kann man das Makroklima allerdings nur als Rahmenbedingung für die, für den Weinbau wichtigen klimatischen Faktoren sehen.
Mesoklima
Das Mesoklima ist die Bezeichnung für den Bereich zwischen dem sich über größere Regionen erstreckende Makroklima und dem in Kleinstbereichen vorherrschenden Mikroklima.
Der Umfang des Mesoklimas bemisst sich im Allgemeinen in Größenordnungen von zehn bis zu einigen hundert Metern. Man kann also zurecht vom Meso- oder Lagenklima einer bestehenden oder potentiellen Weinbergslage sprechen.
Die Erhebung oder die Verfügbarkeit mesoklimatischer Daten ist ungleich schwerer, da es selten für Weinbergbergslagen solch detaillierte Aufzeichnungen dieser Faktoren gibt. ( Repräsentativer Messzeitraum ca. 30 Jahre ) Abhilfe schaffen dort Abgleichungen eigener mesoklimatischer Daten mit älteren Daten benachbarter, traditioneller Messstationen zur wissenschaftlich fundierten Vorausberechnung. Um ein Mesoklima noch genauer beurteilen zu können, müssen natürlich auch Merkmale der Topographie, wie Hangneigung, Exposition und Bodenart in die Messungen mit eingerechnet werden.
Mikroklima
Das Mikroklima bezeichnet das Klima an einem genau umgrenzten, räumlich sehr stark eingeengten Stelle. Im Weinbau kann es sich um Kleinstflächen innerhalb einer Einzellage handeln. Dies können Gunstzonen zwischen Rebzeilen, Senken oder Terrassen sein. Auch klimatische Eigenheiten der bodennahen Luftschichten (bis ca. 2.50 Meter Höhe ) sind Ausdruck des Mikroklima.
Reaktionen des Winzers darauf können Rebschnitt und -erziehung sein, die wiederum durch Wuchs und Laubschatten aktiv zu mikroklimatischen Veränderungen beitragen.( herabgesetzter Luftaustausch)
Veränderungen der "Kulturlandschaft Weinberg" durch den Menschen, wie Flurbereinigungen, Terrassenbau, Wuchshilfen, aber auch Boden und Laubarbeiten schaffen unwiederbringlich veränderte Mikroklimakonditionen.
Der mildernde Einfluss von Flüssen und Seen sei an dieser Stelle noch bemerkt.
Als Wärmespeicher, Feuchtigkeitsdepot und Lichtreflexionsfläche haben sie entscheidenden Einfluss auf das Meso- und Mikroklima im Weinberg.
Für die Betrachtung des Mikroklimas innerhalb einer Einzellage sind zusammengefasst folgende Faktoren zu betrachten. die geographische Lage die gesamte Sonneneinstrahlung im Jahr die durchschnittliche Jahrestemperatur Niederschlagsmenge und Verteilung im Jahr Dauer, Richtung und Intensität des Windes (Mistral, Passat, Marin) Art und Farbe des Bodens Relief und Topographie Höhe über NN Die tägliche Insolation mit Intensität und Dauer.
Sonnenschein und Temperaturkurven
In Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen wurden die Weinbaubereiche innerhalb der EU nach Weinbauzonen festgelegt. Diese Einteilung bindet Mindestmostgewichte und die wichtigsten Maßnahmen der Weinbereitung an sich. Sie geht damit auf den schon früh erkannten Weincharakter der einzelnen klimatischen Gürtel innerhalb Europas ein.
Die Aufzeichnungen über Sonnenscheindauer und Wärme zeigen die unterschiedliche Verteilung dieser Faktoren in den europäischen Weinanbaugebieten, die den Wein scheinbar so entscheidend prägen. In der Champagne als nördlichstem Anbaugebiet Frankreichs, reicht die Sonnenintensität gerade aus, um säuerliches, nicht vollreifes Lesegut zu ernten.
(Sonnenscheindauer 1770 Stunden pro Jahr, Durchschnittstemperatur 11.8 °C)
Dies ist jedoch kein Makel, denn nur so ist es möglich raffinierte und elegante Schaumweine dieser Güte auf diesen Kreideböden zu produzieren.
Im Languedoc oder in Südspanien läßt sich kaum verhindern die Weinberge und somit die Trauben vor der hier fast zerstörerischen Kraft der Sonne zu schützen.
(Sonnscheindauer 2531 Stunden pro Jahr, Durchschnittstemperatur 15.2 °C )
Die hier erzeugten Weine sind folglich geprägt von sehr hohen Mostgewichten und Alkoholwerten, starken Gerbstoffen (da die Traube sich durch dicke Häute vor der Sonne schützen muss) und geringen Säurewerten.
Fasst man also zusammen, zeigt sich, dass je nördlicher des 45. Breitengrades ein Weinbaugebiet liegt,
- desto flacher fällt der Einfallswinkel der Sonne auf die Rebflächen ,
- desto wichtiger die Ausrichtung und Neigung der Weinbergslage.
- desto unwichtiger ist der Jahrgang für die Entwicklung und Reife der Trauben
In der Champagne beträgt der Einfallswinkel im Sommer max. 65°, im Herbst zur Erntezeit max. 49°, daher werden im Norden allgemein Hanglagen mit Südost und Südausrichtung bevorzugt, weil dort die Sonnenstrahlen in optimaler Zeit und Intensität auf die Reben treffen.
Im Gegensatz dazu findet man große Lagen im Süden Frankreichs oftmals in flacheren, geschützten Nord oder Nordostlagen, die in diesem heißen Klima einen günstigen flachen Sonneneinstrahlungswinkel aufweisen und den Trauben eine feinere Entwicklung ermöglichen.
Für die maximale Nutzung des Sonnenlichts wurden Richtung und Abstand der Zeilen, Pflanzdichte, Schnitt- und Erziehungsmethoden studiert und in die regionalen Appellationsvorschriften aufgenommen. Sonnenlicht setzt sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammen. Sichtbares Licht, spürbare, infrarote Wärmestrahlen und verschiedene andere Wellenbereiche. Chemische Reaktionen in Pflanzen werden durch eine Kombination von Sonnenstrahlen verschiedener Wellenlängen in Gang gesetzt. Durch das Chlorophyll in den Blättern der Rebe wird Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt. Es beginnt die Photosynthese und die Produktion von Zucker als Pflanzennahrung. Die Photosynthese erlangt ihre optimale Leistung bei 25° C und fällt überraschenderweise bei Temperaturen über 30 °C wieder scharf ab. Bei der Photosynthese wird aus Wasser und Kohlendioxid unter Verwendung von Sonnenenergie in der Pflanze Zucker gebildet.
Sie kann durch folgende chemische Formel dargestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kohlendioxid + Wasser +Sonnenenergie = Zucker + Sauerstoff
Zeichen zu hoher Temperaturen, die eine Instabilität der Enzyme, Gewebeaustrocknung und das Schließen der Poren auf der Blattunterseite bewirkt, ist das Welken der Blätter.
Regen
Regen ist wie in der gesamten Landwirtschaft auch im Weinbau ein lebenswichtiger, klimatischer Faktor. Doch nicht die Menge oder Intensität alleine, sondern gerade die jahreszeitliche Verteilung ist für die Entwicklung der Rebe und Traube von entscheidender Bedeutung, damit ausreichendes Wachstum gefördert und schwerwiegender Wasserstress während der Reife vermieden wird. Andererseits kann übermäßiger Niederschlag zu allzustarker Vegetation und schlechtem Laubdachmikroklima führen. Staunässe, durch zu große Regenmengen und schlechten Wasserabzug des Bodens, fördert die Wurzelfäule der Rebe. Die erforderliche Mindestniederschlagsmenge für den Qualitätsweinbau in kühlem Weinbauklima liegt bei ca. 500 mm/qm , in warmem bis heißem Klima bei ca. 600-750 mm/qm Diese Werte sind natürlich immer nur in Verbindung mit der jeweiligen Bodenstruktur und anderen mesoklimatischen Faktoren (wie See-, Meer- oder Flussnähe) zu sehen und zu bewerten .Eine Niederschlagsobermenge ist offensichtlich nicht gegeben, solange der Boden durchlässig genug ist, ausgewaschene Nährstoffe ersetzt, genügend Sonnenscheindauer anfällt und die Luftfeuchte nicht so hoch ist, dass Pilzkrankheiten außer Kontrolle geraten. Starke Regenfälle unmittelbar vor oder während der Lese sind allerdings der Weinqualität abträglich, insbesondere wenn dadurch Nässestress auftritt. In diesem Fall schwellen die Beeren so stark an, dass sie unter Umständen platzen, wodurch der Saft oxidiert oder schon am Stock ins gären gerät. Daß sich das erhöhte Einlagern von Wasser nachteilig auf die Qualität des Mostes und damit des Weines auswirkt liegt auf der Hand.
Rebsorten
" Das Land selbst wählt die Frucht, die ihr am besten steht."
Dieses Zitat von Hugh Johnson zeigt deutlich, was nicht zuletzt durch den AOC bestimmten Rebspiegel jedes Weinanbaugebietes dokumentiert wurde.
Die lange Weinbautradition in Europa und Frankreich, die bis ins frühe Mittelalter zurückgeht, hat in allen Weingebieten durch Erfahrung, Experiment und wissenschaftliche Forschung die Rebsorten herausgebildet die in Zusammenhang mit allen, das Terroir betreffenden Faktoren, die besten Weinqualitäten erreicht. Das Terroir wird nur in diesen Rebsorten überzeugend zum Ausdruck gebracht.
Alle bisher besprochenen Faktoren des Terroir, sei es Boden, Klima, oder die Topographie des Weinbergs, keiner von ihnen ist direkt sensorisch erfassbar und sagt etwas über den aus ihm hervorgehenden Wein aus.
Alle diese Elemente brauchen ein Medium in dem sie sich entfalten und das sie prägen können.
Die Traubensorten, aus denen der Wein entsteht.
Die Kenntnis der allgemeinen Eigenschaften der Rebsorten, die dem Wein zugrunde liegen, bildet einen wichtigen Schritt zu Verständnis des Weines selbst.
Zudem muss auch jede Traube nach ihrer Eignung für ein bestimmtes Terroir betrachtet werden. So besitzt jede Rebsorte bestimmte Anbaucharakteristiken nach denen man sie auswählen und bewerten muß, zum Beispiel danach,
- ob sie früh oder spät austreibt, blüht und ihre Frucht zur Reife bringt,
- ob sie besonders wuchskräftig ist, sie eine Neigung zu Übererträgen zeigt, wenn sie nicht dran gehindert wird,
- ob sie besonders anfällig für Schädlinge, Krankheiten oder die Gefahren von Wind oder Frost ist und
- ob sie schließlich auf eine bestimmte Form des Rebschnitts ansprechen.
So gesehen wird sich jeder Winzer bei der Neubestockung eines Weinberges genauestens überlegen, welche Rebsorte unter den speziellen, klimatischen Bedingungen dieser Lage optimale Ergebnisse erzielt. So hätte es beispielsweise wenig Sinn, Flachlagen in der Oberrheinebene oder Lagen, in den regelmäßig Frühfröste auftreten, mit dem anspruchsvollen und spätreifenden Riesling zu bestocken, der hier mit Reifeproblemen zu kämpfen hätte. Statt dessen greift der Winzer lieber auf anspruchslosere und frühreifende Sorten wie Müller-Thurgau zurück. Ebenso wäre es unsinnig, Weinberge in St. Émilion oder Pomerol mit Cabernet Sauvignon zu bestocken, obwohl er potentiell bessere Weine ergibt als Cabernet Franc und Merlot. Doch würde der Cabernet Sauvignon aufgrund der klimatischen Bedingungen hier durchweg nicht voll ausreifen und ist daher den genannten frühreifen Sorten überlegen. Auf der anderen Seite der Gironde jedoch, nur 50 km weiter, findet er im Médoc optimale Bedingungen vor und ist dem Cabernet Franc und dem Merlot hier überlegen.
Kennt man den Geschmack, den Grundcharakter einer Traube schon im voraus, dann ist dies eine große Hilfestellung, wenn nicht sogar Grundvoraussetzung bei der Bewertung eines bestimmten Terroirprofils im Wein.
Wie sonst sollte man die Besonderheit eines Weines würdigen können, wenn man sich nicht seines geschmacklichen Ursprungs bewusst ist ?
Manche Rebsorten sind mit ihrer Heimat schon so lange und eng verknüpft, daß beispielsweise Chablis und Chardonnay oder Cote d´Or und Pinot Noir gleichbedeutend sind.
Die Kenntnis des bestimmten Rebspiegels der Anbaugebiete ist also erster Schritt bei der Weinanalyse.
Die wichtigsten Rebsorten nach franz. Anbaugebieten geordnet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der menschliche Faktor
Wein ist ein natürliches Produkt, kein Resultat wissenschaftlicher
Arbeit. Reben und Trauben wachsen und reifen in natürlichen Zyklen, und auch der Saft der Beeren gärt ohne menschliches Zutun. Theoretisch bedarf es also nicht einmal eines Kellermeisters, geschweige denn komplizierter Kellertechnik, um Wein herzustellen. Praktisch jedoch beeinflussen den Wuchs der Rebe und den Gärvorgang jedoch eine Vielzahl von Faktoren. Diese zu verbessern, zu dirigieren und zu kontrollieren war stets das Bestreben der Winzer und Weinbereiter.
Die Auswahl des Weinbergs, der Rebsorte, der Erziehungsart und die Pflege der Rebe ist nur der erste Schritt der menschlichen Einflussnahme. Ertragsbeschränkung, Leseterminbestimmung und Kelterungsverfahren der zweite.
Wenn das Lesegut in den Keller kommt entscheidet die Erfahrung, Kreativität, und das Qualitätsbewusstsein des Winzers über die Entwicklung des entstehenden Weines.
Verschiedenste Weinbereitungsmethoden bieten dem Kellermeister von Anfang an die Möglichkeit den jungen Wein zu formen und zu prägen. Die Auswahl der Gärmethode (Most oder Maische), Verschnitt, Chaptalisation, Säuerung, Mostkonzentrationsverfahren, die Temperaturführung während der Gärung oder der biologische Säureabbau (malolaktische Gärung) sind nur einige Schlagwörter der modernen Kellertechnik.
Stabilisierung, Filtration, Schönung und Ausbau der Weine im Holzfass oder im Stahltank sind weitere Entscheidungen die zu späterem Zeitpunkt getroffen werden müssen.
"Wie er reift so schmeckt er" Das am häufigsten verwendete Gefäß zur Reifung von hochwertigen Qualitätsweinen ist und bleibt das Holzfass.
Hier kann der Wein atmen, die Sauerstoffzufuhr im Fass beschleunigt die Polymerisation. Dadurch wird der Wein weicher, harmonischer, komplexer. Doch durch die aus dem Holz gelösten Tannine, die in den Wein übergehen, wird der Wein mehr oder minder stark verändert.
Wein war schon immer dem Geschmack und Zeitgeist jeder Epoche unterworfen. Trends und Mode prägen seinen Charakter. Das diese Entwicklung nicht immer förderlich ist, beweist die immer stärker werdende globale Uniformität des Weingeschmacks, der regionale Nuancen mehr und mehr verschwinden lässt.
Ein verantwortungsvoller Winzer wird bemüht sein, durch die Symbiose von Qualität, Tradition und moderner Technik den einzigartigen Terroircharakter seiner Weine zu bewahren und zu pflegen.
Quellenverzeichnis:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Terroirbegriff im Weinbau?
Terroir ist ein französisches Konzept, das die gesamte natürliche Umgebung einer Weinbaulage umfasst. Es definiert einen begrenzten Raum, in dem physikalische, chemische, geografische und klimatische Bedingungen spezifische Produkte ermöglichen. Es wird durch die Interaktion von Boden, Lage, Klima, Rebsorte und Winzer beeinflusst.
Welche Komponenten bestimmen das Terroir?
Die wichtigsten Komponenten sind Geologie, Boden, Topographie, Klima (Makro-, Meso-, Mikroklima), Rebsorte und die Anbau- und Ausbaumethoden des Winzers. Diese Komponenten sind naturgegeben und durch Pflegemaßnahmen nicht wesentlich beeinflussbar.
Wie ist die Geologie relevant für das Terroir?
Die Geologie, insbesondere die Gesteinsarten (Erstarrungs-, Sediment-, Metamorphgesteine), beeinflusst die Bodenbildung und somit die Art und Struktur des Bodens, der wiederum die Reben prägt. Die Gesteinsarten Frankreichs sind vielfältig und prägen die Weinbauregionen unterschiedlich.
Welche Rolle spielen Böden im Terroir?
Böden sind die oberflächliche Erdauflage, in der die Reben wurzeln. Sie entstehen durch Verwitterung der Gesteine und beeinflussen die mineralische Zusammensetzung, Wasserhaushalt und Belüftung des Bodens. Die Bodenart (Ton, Schluff, Sand) und Struktur sind entscheidend für die Qualität des Weines. Klima, Relief, Ausgangsgestein, Wasser, Flora und Fauna und menschliche Tätigkeit beeinflussen die Bodenbildung.
Wie beeinflusst das Klima das Terroir?
Das Klima, insbesondere Temperatur und Niederschlag, ist ein starker bodenbildender Faktor. Es beeinflusst die Verwitterungsprozesse und die Durchfeuchtung des Bodens. Makroklima, Mesoklima und Mikroklima prägen die Weinbaulagen unterschiedlich. Flüsse und Seen haben einen mildernden Einfluss auf das Klima.
Welche Rolle spielen Rebsorten im Terroir?
Rebsorten sind das Medium, in dem sich das Terroir entfaltet und prägt. Jede Rebsorte hat bestimmte Anbaucharakteristiken und ist unterschiedlich geeignet für verschiedene Terroirs. Die Kenntnis der Rebsorteneigenschaften ist wichtig, um das Terroirprofil im Wein zu bewerten.
Welchen Einfluss hat der Mensch (Winzer) auf das Terroir?
Der Winzer beeinflusst das Terroir durch die Auswahl des Weinbergs, der Rebsorte, der Erziehungsart und die Pflege der Rebe. Auch Ertragsbeschränkung, Leseterminbestimmung und Kelterungsverfahren spielen eine Rolle. Die Weinbereitungsmethoden und der Ausbau des Weines im Holzfass oder Stahltank beeinflussen den Geschmack. Ein verantwortungsvoller Winzer wird den Terroircharakter seiner Weine bewahren.
Wie beeinflusst Regen den Weinbau?
Nicht die Menge des Regens allein, sondern die jahreszeitliche Verteilung ist entscheidend. Sie bestimmt das Wachstum der Reben und vermeidet Wasserstress, kann aber auch zu starker Vegetation führen. Die Mindestniederschlagsmenge für den Weinbau liegt bei ca. 500-750 mm/qm, abhängig vom Klima und der Bodenstruktur.
Was sind Makro-, Meso- und Mikroklima?
Makroklima bezeichnet das Klima einer ganzen Region. Mesoklima beschreibt das Klima einer Weinbergslage. Mikroklima ist das Klima an einem eng umgrenzten Ort innerhalb einer Lage, wie z.B. zwischen Rebzeilen oder in bodennahen Luftschichten.
- Arbeit zitieren
- Matthias Münstermann (Autor:in), 2001, Grundlagen des Terroirbegriffs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102856