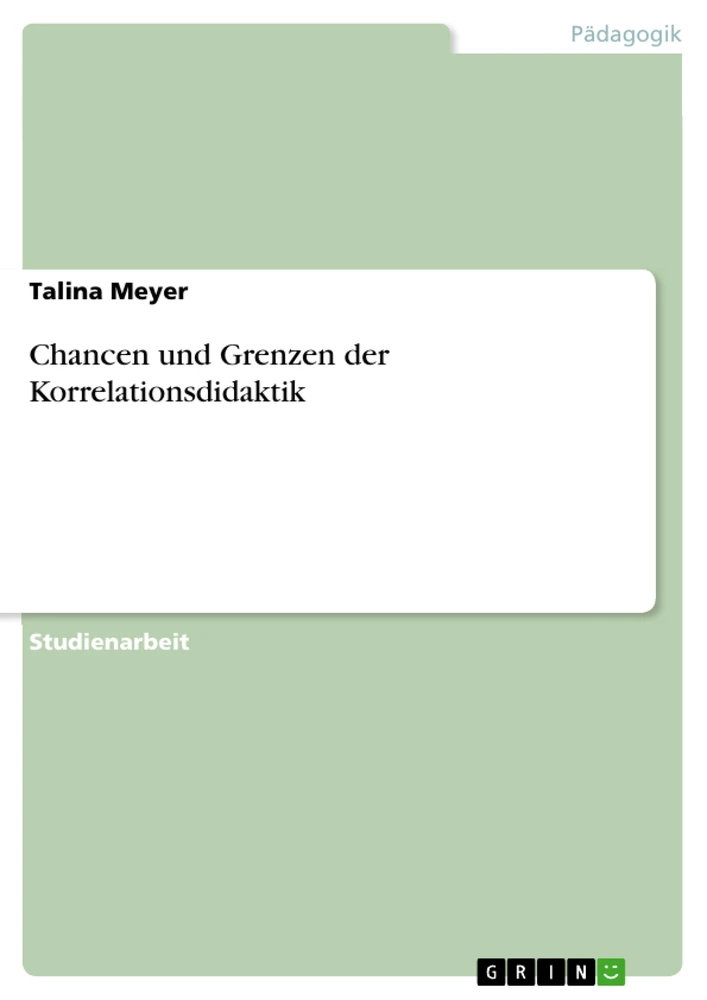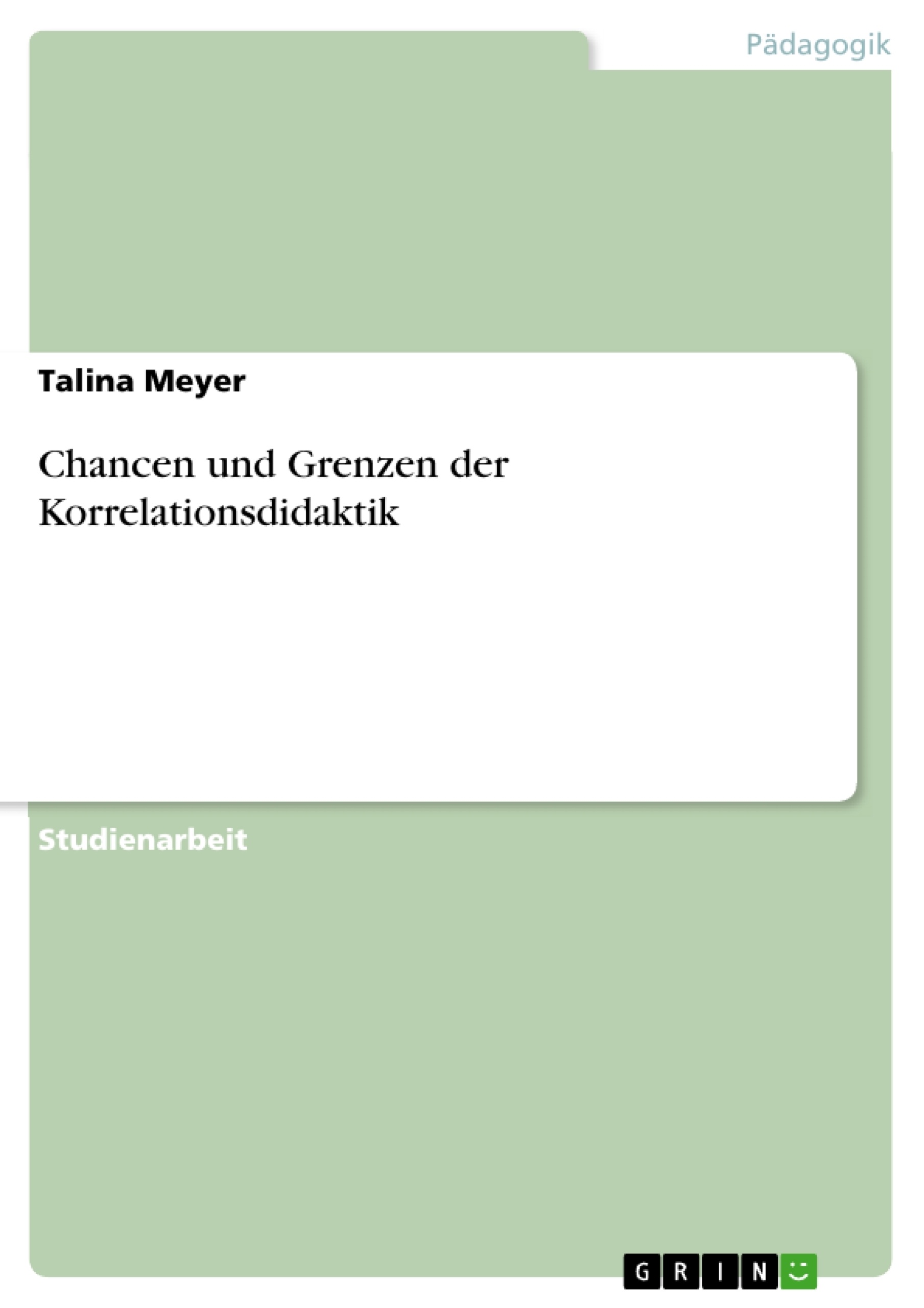Der Stand des christlichen Glaubens hat sich in den Jahrhunderten stark verändert. In unserer heutigen Gesellschaft muss sich der Glaube immer mehr beweisen. Religionsunterricht wird als unnötig erachtet, die Lehrer*innen haben immer mehr Probleme den Glauben in Kontakt mit der Lebenswelt der Schüler*innen zu setzen.
Dieses Problem existiert nicht erst seit der Jahrtausendwende. Auch schon in den 60ern brachte die erstarkende Säkularisierung Probleme für den Religionsunterricht. Wie sollte man mit Schüler*innen umgehen, die keine christliche Sozialisierung besaßen und eher agnostisch oder atheistisch in ihrer Denkweise waren?
Die Korrelationsdidaktik schien die Erlösung für den katholischen Religionsunterricht. Ihren Durchbruch erlangte sie in den 60er bis 70er Jahren und wurde ab dann zum didaktischen Leitprinzip im Religionsunterricht. Sie versuchte eine Wechselbeziehung zwischen der Schülerwelt und der christlichen Tradition herzustellen. Später wurde sie jedoch von der Elementarisierung abgelöst, nachdem einige Probleme die Praxisumsetzung der Korrelationsdidaktik erschwerten. Trotzdem hielt sich das Prinzip als eines der Leitprinzipien im Religionsunterricht. Auch noch heute nutzen viele Religionslehrer*innen die Korrelationsdidaktik.
In dieser Hausarbeit sollen die Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik aufgezeigt werden. Dafür werden zunächst das der Korrelationsdidaktik zugrundeliegende systematisch-theologische Prinzip der „Korrelation“ erläutert. Beginnend mit Paul Tillich, einem evangelischen Theologen, der Korrelation auch als „Frage-Antwort Geschehen“ deutete, weiterführend mit Edward Schillebeeckx, einem katholischen Theologen, der Korrelation eher als gegenseitiges Durchdringen definiert.
Anschließend wird das Prinzip der Korrelationsdidaktik erläutert, wobei nicht auf die Entwicklung eingegangen wird, die dieser Begriff durchlief, sondern nur eine grobe Erläuterung stattfindet. Im Hauptteil der Hausarbeit werden die Probleme erläutert, die während der Umsetzung der Korrelationsdidaktik auftauchen. Im Anschluss wird auf die abduktive Korrelation eingegangen, ein Prinzip, dass das Hauptproblem der klassischen Korrelationsdidaktik versucht zu lösen. Abschließend wird die Frage beantwortet, welche Chancen Korrelationsdidaktik schaffen kann und welche Grenzen ihr gesetzt sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Korrelation als systematisch-theologisches Prinzip
- Frage und Antwort Korrelation nach Paul Tillich
- Korrelation nach Schillebeeckx
- vom Begriff der Korrelation zum Begriff der kritischen Interrelation
- Korrelation als didaktisches Prinzip
- Korrelationsdidaktik kritisch hinterfragt
- Lösungsversuche
- abduktive Korrelation
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik im Religionsunterricht. Sie beleuchtet das systematisch-theologische Prinzip der Korrelation, beginnend bei Tillichs „Frage-Antwort-Geschehen“ und Schillebeeckxs „kritischer Interrelation“. Anschließend wird die Korrelationsdidaktik selbst kritisch betrachtet und Lösungsansätze, insbesondere die abduktive Korrelation, diskutiert.
- Das systematisch-theologische Prinzip der Korrelation bei Tillich und Schillebeeckx
- Die Anwendung der Korrelation als didaktisches Prinzip im Religionsunterricht
- Kritische Auseinandersetzung mit den Problemen der Korrelationsdidaktik
- Lösungsansätze zur Überwindung der Probleme der Korrelationsdidaktik
- Bewertung der Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen des Religionsunterrichts im Kontext der Säkularisierung und stellt die Korrelationsdidaktik als ein zentrales didaktisches Prinzip vor, das versucht, eine Brücke zwischen der Lebenswelt der Schüler*innen und der christlichen Tradition zu schlagen. Die Arbeit kündigt die Erörterung der Chancen und Grenzen dieses Prinzips an, indem sie zunächst das systematisch-theologische Konzept der Korrelation bei Tillich und Schillebeeckx beleuchtet und anschließend die didaktische Umsetzung und deren Problematiken behandelt. Schließlich wird die abduktive Korrelation als Lösungsansatz diskutiert und eine abschließende Bewertung vorgenommen.
Korrelation als systematisch-theologisches Prinzip: Dieses Kapitel erläutert das theologische Verständnis von Korrelation bei Paul Tillich und Edward Schillebeeckx. Tillich versteht Korrelation als ein „Frage-Antwort-Geschehen“ zwischen Mensch und Gott, wobei die Offenbarung Gottes als ein „subjektives“ und „objektives Geschehen“ beschrieben wird. Schillebeeckx hingegen favorisiert den Begriff der „kritischen Interrelation“, der ein wechselseitiges Durchdringen von Mensch und Gott impliziert. Die unterschiedlichen Definitionen von Korrelation führen zu unterschiedlichen Verständnissen von Gottesoffenbarung und deren Relevanz für den Glauben.
Korrelation als didaktisches Prinzip: Dieses Kapitel behandelt die Anwendung des Prinzips der Korrelation im Religionsunterricht. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der praktischen Umsetzung der Korrelationsdidaktik geführt, ohne dabei auf die historische Entwicklung des Begriffs einzugehen. Die Kapitel konzentrieren sich auf die Problemfelder, die die Praxis erschweren. Diese Problemstellungen bilden die Grundlage für die Diskussion von Lösungsansätzen im folgenden Abschnitt.
Schlüsselwörter
Korrelationsdidaktik, Religionsunterricht, Paul Tillich, Edward Schillebeeckx, Gottesoffenbarung, Frage-Antwort-Korrelation, kritische Interrelation, abduktive Korrelation, Säkularisierung, Lebenswelt der Schüler*innen, Chancen, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Korrelationsdidaktik im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik im Religionsunterricht. Sie analysiert das systematisch-theologische Prinzip der Korrelation bei Tillich und Schillebeeckx und bewertet dessen Anwendung in der didaktischen Praxis.
Welche systematisch-theologischen Prinzipien der Korrelation werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das Verständnis von Korrelation bei Paul Tillich (Frage-Antwort-Geschehen) und Edward Schillebeeckx (kritische Interrelation). Die Unterschiede in ihren Definitionen und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Verständnis von Gottesoffenbarung werden diskutiert.
Wie wird die Korrelationsdidaktik im Religionsunterricht betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert die Anwendung der Korrelation als didaktisches Prinzip im Religionsunterricht kritisch. Sie konzentriert sich auf die Herausforderungen und Probleme bei der praktischen Umsetzung und diskutiert Lösungsansätze, insbesondere die abduktive Korrelation.
Welche Lösungsansätze für die Probleme der Korrelationsdidaktik werden vorgestellt?
Als Lösungsansatz wird die abduktive Korrelation diskutiert. Die Arbeit präsentiert diesen Ansatz als eine mögliche Methode, die Herausforderungen der Korrelationsdidaktik zu bewältigen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Korrelation als systematisch-theologisches Prinzip (bei Tillich und Schillebeeckx), ein Kapitel zur Korrelation als didaktisches Prinzip (mit kritischer Auseinandersetzung und Lösungsansätzen), eine Schlussfolgerung und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Korrelationsdidaktik, Religionsunterricht, Paul Tillich, Edward Schillebeeckx, Gottesoffenbarung, Frage-Antwort-Korrelation, kritische Interrelation, abduktive Korrelation, Säkularisierung, Lebenswelt der Schüler*innen, Chancen, Grenzen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik im Religionsunterricht. Sie will ein differenziertes Bild der Anwendung des Korrelationsprinzips in der Praxis vermitteln und Lösungsansätze für bestehende Probleme aufzeigen.
Wie wird die Einleitung der Hausarbeit beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen des Religionsunterrichts im Kontext der Säkularisierung und stellt die Korrelationsdidaktik als ein zentrales didaktisches Prinzip vor, das eine Brücke zwischen der Lebenswelt der Schüler*innen und der christlichen Tradition schlagen soll. Sie kündigt die Erörterung der Chancen und Grenzen dieses Prinzips an.
- Quote paper
- Talina Meyer (Author), 2020, Chancen und Grenzen der Korrelationsdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1027465