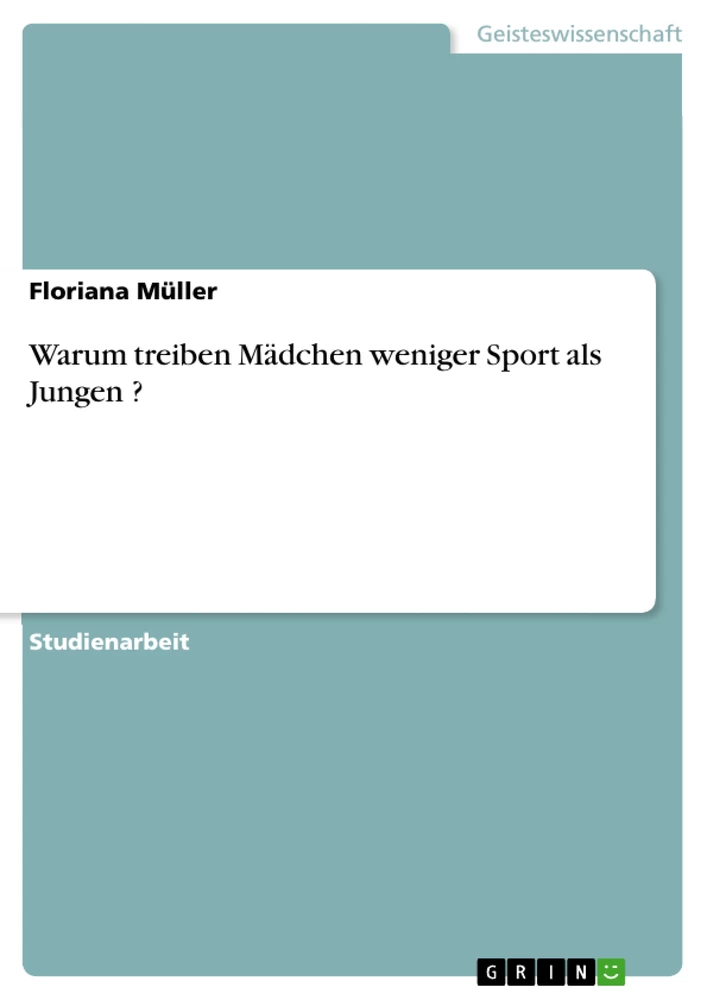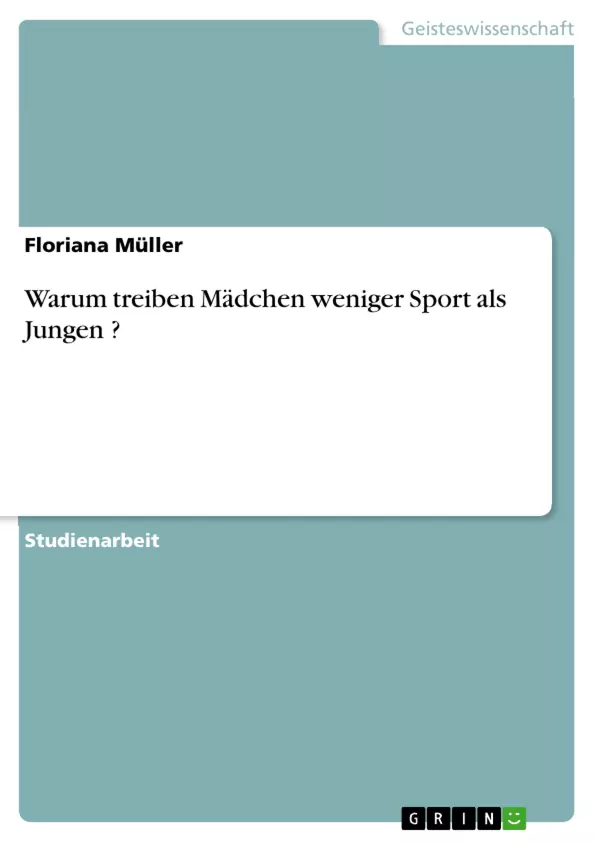Warum engagieren sich Mädchen weniger im Sport als Jungen? Diese Frage, die tief in den gesellschaftlichen Normen und individuellen Erfahrungen verwurzelt ist, steht im Zentrum einer aufschlussreichen Untersuchung. Entdecken Sie die verborgenen Ursachen für die unterschiedliche Sportbeteiligung von Mädchen, von geschlechtsspezifischer Sozialisation in der Familie bis hin zu den subtilen und oft übersehenen Auswirkungen des Schönheitsideals. Die Analyse beleuchtet, wie elterliche Vorbilder, oder deren Fehlen, die sportlichen Ambitionen junger Mädchen prägen und wie sich sexuelle Gewalt in erschreckender Weise auf das Körperbild und die Bewegungsfreude auswirken kann. Ein besonderes Augenmerk gilt dem koedukativen Sportunterricht, der, obwohl als Instrument der Gleichstellung gedacht, in der Realität oft männlich dominiert ist und bei Mädchen zu Frustration und Rückzug führen kann. Erfahren Sie, wie Kritik, sexistische Anmache und mangelnde Erfolgserlebnisse im Schulsport das Selbstvertrauen junger Sportlerinnen untergraben und eine lebenslange Abneigung gegen körperliche Aktivität fördern können. Diese tiefgreifende Analyse deckt auf, wie gesellschaftliche Erwartungen, Körperbilder und sogar traumatische Erfahrungen das Sportverhalten von Mädchen beeinflussen. Abschließend werden Wege aufgezeigt, wie ein Sportunterricht gestaltet werden kann, der Spaß, Erfolg und Entwicklung für beide Geschlechter ermöglicht. Ein notwendiger Beitrag zur Förderung von Gleichberechtigung und körperlichem Wohlbefinden, der Lehrkräfte, Eltern und alle, denen die Gesundheit und das Selbstwertgefühl junger Frauen am Herzen liegen, zum Umdenken anregt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Sport mehr als nur Bewegung bedeutet – eine Welt, in der Körperakzeptanz, Empowerment und die Überwindung geschlechtsspezifischer Barrieren im Mittelpunkt stehen, um Mädchen zu einem aktiven und selbstbestimmten Leben zu ermutigen. Diese Analyse ist ein Muss für alle, die sich für Geschlechterforschung, Sportpädagogik und die Förderung eines positiven Körperbildes interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
2) Mädchen treiben weniger Sport - empirischer Teil
3) Geschlechtsspezifische familiare Sozialisation
4) Sexueller Mißbrauch
5) Verliererinnen des Schönheitskultes
6) Koedukativer Sportunterricht
7) Zusammenfassung und Schluß
8) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Der Titel ist gleichzeitig zentrale Fragestellung dieser Hausarbeit. Schon seit längeren beschäftigen mich diese und ähnliche Fragen. Mehrere 'bewegungsarme' Frauen aus meinem Bekanntenkreis gaben den Anstoß dafür. Ihr weniges Verständnis für aktives Sporttreiben und ihre berichteten negativen Erfahrungen vor allen Dingen im Sportunterricht machten mich schon etwas stutzig, weil meine Wahrnehmung in diesen Fällen gänzlich anders waren. Nun habe ich aber den Anspruch als späterer Sportlehrer nicht nur ein paar Bälle rauszuschmeißen und "Macht mal" zu sagen. Das Ziel bei dieser Hausarbeit ist deswegen für mich Mädchen bzw. Frauen in ihrem Bewegungsverhalten besser zu verstehen, um einen Sportunterricht zu gestalten, der Spaß, Erfolg und Entwicklung für beide Geschlechter bedeuten kann.
In Kapitel zwei geht es los mit den empirischen Daten zu der These die indirekt schon im Titel enthalten ist : ' Mädchen treiben weniger Sport '. Diesen Teil habe ich bewußt kleiner gehalten, um den Begründungen mehr Raum zu lassen.
Kapitel drei bis sechs befassen sich mit der anderen, geschlechtsspezifischen Sozialisation von Mädchen, die dazu führt, daß sie weniger Sport treiben als Jungen.. Welchen Einfluß haben die Eltern auf das Sporttreiben ist das Thema dabei in Kapitel drei. Dabei werde ich den Prozeß der Sozialisation nicht dahingehend ausdiskutieren, welche der Theorie-richtungen nun recht hat, sondern mich ausschließlich an Hurrelmann(1986) anlehnen. Hier fehlt leider der Einfluß der Eltern auf das Spielverhalten und ihre unterschiedliche Einschränkung von Bewegungsräumen. Auch konnte ich keinen grundsätzlichen Erklärungsansatz für die 'Problematik' finden, so daß dieses Kapitel nicht sehr aussagekräftig ist. Kap. vier beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Mädchen zu ihrem Körper. Sexueller Mißbrauch und Sportabstinenz ist ein Thema, daß ich in diesem Zusammenhang vorher noch nicht gesehen habe ( Kap. 5).
Zum Schluß des Argumentationsteiles geht es um den koedukativen Sportunterricht und die Erfahrungen die er für Mädchen mit sich bringt ( Kap. 6 ).
Dies sind nur eine Auswahl von Gründen die das unterschiedliche Sportengagement der Geschlechter erklären. So ist z.B. noch die Sportberichterstattung in den Medien ( 95 % Männersport gegenüber 5 % Frauensport ( VOIGT 1986 ) ) und weniger frauenspezifische Angbote der Sportvereine zu nennen, doch spielen sie meiner Meinung nach eher eine untergeordnete Rolle in der Palette der Erklärungsangebote.
Hinzuzufügen ist noch, daß Teile dieser Arbeit noch sehr junge Forschungsgebiete sind und deswegen häufig empirische Unterlegungen, sowie ausreichende Quellenvermerke fehlen.
2) Mädchen treiben weniger Sport - empirischer Teil
Ich habe leider keine Statistiken gefunden, die das gesamte sportliche Engagement in einer Graphik erfassen, deswegen erfolgt die Darstellung geteilt. Einmal anhand von Mitgliedszahlen des Deutschen Sportbundes ( DSB ), zum anderen für die Sportaktivität in der Freizeit. Somit dürfte der freiwillige Bereich abgedeckt sein.
Mädchen sind in Vereinen noch immer gegenüber den Jungen unterrepräsentiert und treiben also insgesamt weniger organisierten Sport, wenn man davon ausgeht, daß Mitgliedschaft in einem Verein auch in der Regel mit sportlicher Aktivität im Jugendalter verbunden ist.
Dieser Sachverhalt ist auch im Freizeitbereich vorzufinden, wenn auch nicht in der gleichen Größenordnung ( KURZ 1996 ).
3) Geschlechtsspezifische familiare Sozialisation
In früheren Jahren nahm man häufig an, das Frauen aufgrund ihres Geschlechtes körperlich benachteiligt wären, es nicht in ihrem Wesen liegt Sport zu treiben. Spätestens seit MEAD (1959 ) sollte aber klar sein, daß unterschiedliche Verhaltensweisen der Geschlechter nicht ihre Ursachen im biologischen haben. Sie war Ethnologin und hatte festgestellt, daß Geschlechterrollen von Kultur zu Kultur varieren können, also kulturhistorisch gewachsen sind und wie z.B. bei einem Südseevolk, den unseren diamentral gegenüber stehen.
Wie geschieht nun aber dieser Sozialisationsprozeß der zu unterschiedlichen Verhaltensweisen bei den Geschlechtern führt ?
Der Prozeß der Sozialisation ist u.a. ein hineinwachsen in Gesellschaft , die Übernahme von Rollen, Werten und Normen, um Personen in einer Gesellschaft handlungsfähig zu machen (Vergesellschaftung). Darüberhinaus setzt sich das Individuum aber auch aktiv mit seiner Umwelt auseinander und übernimmt nicht jede Erwartung unkritisch (Individuation).
" Sozialisation bezeichnet den Prozeß der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. " ( GEULEN / HURRELMANN 1980, 51 )
Nun sind aber die Erwartungshaltungen bzw. der Normierungsdruck hinsichtlich der Geschlechter unterschiedlich. Beide treffen deshalb in ihrer Sozialisation auf verschiedene Anforderungen, die es zu erfüllen gilt und Sozialisationsinstanzen sind unterschiedlich prägend. " Die heranwachsenden Mädchen und Jungen werden auf dieses Selbstverständnis im Sinne zielverwirklichender Erfordernisse und wünschenswerter Verhaltensweisen während ihrer
Sozialisation verplichtet. " ( KRÖNER 1976 , 137 )
Eltern dienen dabei den Heranwachsenden als erste Identifikationsmodelle für das Erlernen der Geschlechterrolle bzw. für die Prägung der Geschlechtsidentität.
" Da Kinder hauptsächlich am gleichgeschlechtlichen elterlichen Modell die Geschlechtsidentität erwerben, lernen sie auch am jeweiligen Vorbild die sportspezifischen Einstellungen und Motive. Weil Mütter den Sport für weniger wünschenswert deklarieren, sportliche Zusammenhänge mit geringerem Interesse verfolgen und sich sportinaktiver Verhalten als Väter, vermitteln sie ihren Töchtern auch eine geringere Affinität zu diesem Handlungsbereich." ( KRÖNER 1976, 148 )
Väter dagegen bewerten das sportliche Geschehen deutlich höher, interessieren sich mehr für sportliche Ereignisse und diskutieren häufiger darüber, treiben selbst mehr Sport, so daß der Bezug für Söhne deutlicher hergestellt ist.
Während also generell der gleichgeschlechtliche Elternteil die entscheidene Bedeutung für die Sozialisation in der Familie besitzt, belegen alle Untersuchungen, daß für Kinder beiderlei Geschlechts der Vater für die Sozialisation zum Sport eine weit höhere Rolle spielt, als die Mutter. Jungen sich hierbei mit einer Bezugsperson des eigenen Geschlechtes identifizieren können, Mädchen hingegen einen Identifikationswechsel vornehmen müssen. Da es gerade in ihrer primären Sozialisationsumwelt an Orientierungsmodellen mangelt, ist aktives Sporttreiben für Mädchen in weit geringerem Maße mit der eigenen Geschlechtsidentität in Verbindung zu bringen als für Jungen.
" Wie wichtig die konkreten Vorbilder in der sozialen Nahumwelt sind, wird auch dadurch belegt, daß der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen hinsichtlich dem Sporttreiben umso geringer ist, je stärker die Sportaktivität beider Eltern ist. " ( KLEIN 1983, 65 )
4) Sexueller Mißbrauch
Nach einer Studie im Auftrag des Bundeskriminalamtes in Niedersachsen ( 1985 ) ist davon auszugehen, daß in den alten Bundesländern der BRD jährlich 300.000 Kinder sexuell mißbraucht werden. Davon trifft es heranwachsende Mädchen fast ausschließlich mit einem Prozentsatz von 80- 90. 98% der Taten gehen dabei auf das Konto von Männern. Nur in einem von ca. zwanzig Fällen ist der Täter dem Kind völlig fremd. Weitmehr als ein Drittel sind Väter bzw. Stiefväter oder Partner der Mutter, bei einem weiteren Dritel handelt es sich um Männer aus dem näheren Umfeld, wie Erzieher, ' Geistliche ', Nachbarn etc. Es ist also nicht der viel beschworene "böse Unbekannte", der den Kinder auf dem Spielplatz Süßigkeiten anbietet, sondern der "ganz normale" Mann aus der vertrauten Umgebung des Kindes. Welche Auswirkungen können diese Auswirkungen auf das spätere Sporttreiben haben ?
Sexueller Mißbrauch ist gekennzeichnet durch eine massive Verletzung der Persönlichkeit der Heranwachsenden, die gegen ihren Willen passiert. Nun ist der Täter aber in der Regel ein Bekannter, oftmals aus dem nahen Umfeld. Ein Erwachsener der aus Kinderperspektive gesehen, weis was richtig ist bzw. über den Identifikationsprozesse verlaufen ( Väter ). Kinder können dann, wie auch in bestimmten Erziehungssituationen, den Weg einschlagen, sich schuldig für das passierte zu fühlen. Dieser Schluß liegt umso näher, je jünger das Mädchen und je enger die Beziehung zum Täter ist.
Das Mädchen kann sich die Tat des sexuellen Mißbrauchs nicht anders erklären, als daß etwas mit ihrem eigenen Körper nicht stimmt. Diese ' Etwas stimmt mit meinem Körper nicht' - Ein-stellung, löst auch vielfach eine Angst aus, andere Menschen könnten diese vermeindliche Schlechtigkeit entdecken.
" Aus dieser Angst, daß jeder es an ihrem Körper ablesen kann, meiden viele Betroffene Situationen, in denen sie sich ausziehen oder umziehen müßten. Obwohl sie gerne an Gruppen teilnehmen würden, die schwimmen, turnen, Jazzballet oder Aerobic machen, können sie es aus diesen gründen nicht. " ( BESEMS/ VAN VUGT 1990 )
Es wird versucht den eigenen Körper möglichst zu verdecken und ihn nicht zu spüren, womit eine Einschränkung des Bewegungsverhaltens verbunden ist
" So entwickelt sich eine Spirale der Körperablehnung und Bewegungseinschränkung, die in ein immer negativeres Körperbild führt und sich zu einem regelrechten Körperhaß steigern kann" ( PALZKILL 1991)
5) Verliererinnen des Schönheitskultes
In diesem Kapitel soll es um den sogenannten Schönheitskult bei Frauen und Mädchen gehen und seine negativen Auswirkuingen auf das Sportengagement.
Sehr oft kann man versteckt den folgenden Satz hören : Ich bin zu dick, mich mag keiner - Es wird scheinbar ein kausaler Zusammenhang zwischen der Körperfigur und der eigenen sozialen Stellung hergestellt. Wie kommt das ?
Es gibt für Mädchen einen mehr oder weniger starken Druck ab der Pubertät das äußere Körperbild entsprechend der herrschenden Weiblichkeitsnorm zu präsentieren. Dieser Druck ist geprägt durch die unterschwellige Botschaft : erst wenn du einer gewissen Norm entsprichst, bist du liebenswürdig. Der Körper wird also von vielen weiblichen Mitgliedern dieser Gesellschaft als Mittel zur sozialen Anerkennung gewertet oder anders formuliert : Durch den richtigen Körper bin ich. (vgl PALZKILL 1991)
Eine Problematik die weitreichende Folgen haben kann. Der Wunsch nach Anerkennung, Bestätigung, (Gruppen-)Integration ist ein zentrales menschliches Bedürfnis, welches sehr starken Einfluß auf das psychische Wohlbefinden hat. Deswegen kommt es auch häufig zu größeren Konflikten, weil die meisten Heranwachsenden nicht den z.B. in der Werbung fast ausschließlich dargestellten Idealkörper 'besitzen'. Besonders solche Mädchen sind betroffen, die keine anderen identitätsstiftenden Erlebnisse haben. Erfahrungen mit der eigenen Selbstwirksamkeit wurden nicht gemacht und somit kann auch schlecht ein 'gesundes' Selbst- wertgefühl aufgebaut werden. Deswegen wird " Das Aussehen ... zum zentralen Faktor für das eigene Selbstwertgefühl, welches sich wiederum auf die körperliche Selbstsicherheit im Umgang mit anderen auswirkt. " (SOBIECH..1991)
Was hat dieser Vorgang nun mit Sportabstinenz zu tun?
Mädchen reagieren unterschiedlich auf diesen 'Weiblichkeitszwang'. Einige fangen an ihren Körper der Norm entsprechend zu modellieren. Hierin ist auch einer Gründe zu suchen warum Mädchen und Frauen vielfach andere Sportarten treiben als das andere Geschlecht. Dies aber nur am Rande. Andere treten den Rückzug aus dem aktiven Sport an, um mit ihrem Körper in Bewegung nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen, daß andere ihren Speck 'wabbeln' sehen etc.. Die aktive Präsentation des eigenen Körpers wird als Belastung empfunden, Sporttreiben ist dann verbunden mit psychischen Unwohlsein. Dieses Gefühl wird noch verstärkt durch Musterungsprozesse die untereinander z.B. im Sportunterricht ablaufen . Jungenblicke auf Busen, Po, Beine oder aber auch der sogenannte Konkurrenzblick unter Mädchen fallen darunter. Jetzt kann es sehr schnell, wenn auch noch andere Erfolgserlebnisse fehlen zum Abbruch der Sportkarriere kommen.
6)Koedukativer Sportunterricht
Wurde der koedukative Sportunterricht bei seiner Einführung noch begrüßt und als Mittel gewertet, die Gleichberechtigung im System Sport und allgemein voranzutreiben, haben sich die Ansichten im Laufe der Jahre geändert. Heute scheint er vielmehr zu einem Auslaufmodell in der näheren Zukunft zu werden. Dies hat mehrere Gründe:
Von einer Gleichberechtigung, also einer gleichen Behandlung von Mädchen und Jungen kann im Sportunterricht keine Rede sein. Lehrer und auch LehrerInnen widmen ihre Aufmerksamkeit bzw. Förderung maßgeblich auf Jungen auf ( SCHEFFEL 1991).
Auch dominieren Sportarten, die eher von Jungen vorgezogen werden aufgrund ihrer geschlechtzsspezifischen Sozialisation. Und genau an diesem Punkt hängt vieles. Durch die Vorerfahrung der Jungen, besonders in den Ballsportarten, kommt es sehr häufig zu einer männlichen Dominanz im Spielgeschehen. Mädchen werden an den Rand gedrängt und dort stehen gelassen.
" Wir müssen immer mit den ganzen Jungen zusammen, und dann finden wir das ganz blöd, und dann setzen wir uns an den Rand, und dann gucken wir nur zu... Die Jungens, die wollen natürlich immer den Jungen den Ball zuwerfen, und uns werfen sie nie, und dann sagen sie immer : 'Ja wieso stehst du da in der Ecke rum', aber wenn wir dastehen, ich habe mich immer davorne hingestellt. Was kam, war einmal habe ich den Ball ab gekriegt."
(SCHEFFEL 1991 )
Solche Spielsituationen, die nach meiner eigenen Erfahrung nicht untypisch sind, können bei den entsprechenden Mädchen sehr schnell eine Resignation in puncto allgemeines Sporttreiben auslösen,weil einfach auch Erfolgserlebnisse fehlen. Sie werden aber gebraucht, um stabile Bindungen entstehen zu lassen Andere, positive Erfahrungen im Zusammenhang mit Sport sind für viele Mädchen eher selten. Zum einen aufgrund der schon erwähnten Dominanz 'männlicher' Sportarten, aber auch weil der schulische Sportunterricht eine der wenigen Vermittlungsinstanzen ist, um an den Sport heranzuführen. Eine der wenigen deswegen, weil Anregungen zum Sporttreiben in der Erziehung als nicht so wichtig erachtet werden und weil sie einfach in ihrer Freizeit bzw. Verein weniger Sport treiben.
Verschärft werden kann dieser Rückzug noch von Kritik und sexistische Anmache seitens der Jungen in einer Klasse :
" Ich spiele ganz gerne Fußball. Ich habe nichts dagegen. Nur wenn ich dann in einer Manschaft bin, wo die Jungen mich jedesmal schief angucken, wenn der Ball nicht da landet, wo ich ihn hinhaben wollte, und mich dann immer gleich anmachen, wenn's nicht so klappt, wie es sein sollte, dann habe ich da auf soetwas keinen Bock, und dann sage ich auch von vorneherein : Ja, dann vergesse ich halt immer mein Sportzeug, weil ich weiß,das ist für mich sowieso nur Stress, das ist kein Sport, das ist Stress bzw. keine Atmosphere." (SCHEFFEL 1991 )
" Beweg doch deinen fetten Arsch durch die Gegend " oder " Ich dachte, Fotzen könnten kein Fußball spielen " ( SCHEFFEL 1991 )
Das Selbstvertrauen, daß man im Sport braucht um selber agieren zu können wird angeknackst oder gänzlich zerstört. Kritik bezogen auf den Körper der Mädchen wirkt in solchen Fällen besonders schwer.
Im Sportunterricht werden Mädchen oft mit ihren Schwächen konfrontiert, die von den Jungen noch verstärkt werden, was zu einer Abwendung von sportlicher Betätigung führen kann..
7) Zusammenfassung und Schluß
Zusammengefaßt kann man die zentrale Fragestellung dieser Hausarbeit - Warum treiben Mädchen weniger Sport - im wesentlichen folgendermaßen beantworten :
Mädchen werden in anderer Form sozialisiert, viele haben keinen direkten Bezug zum Sporttreiben und halten ihn auch nicht für so interessant wie Jungen. Ein Element dieser geschlechtsspezifischen Sozialisation ist bei vielen Mädchen auch die Bedeutung des eigenen Körpers, der ihnen suggeriert wird. Der entsprechende Körper wird in Verbindung mit der 'Liebenswürdigkeit' der gesamten Person gebracht, was bei 'Anomalien' zu Streß beim Sporttreiben in der Öffentlichkeit werden kann.
Auch hat das Verhalten von Jungen und Männern starken Einfluß auf die Bewegungsentwicklung von Mädchen. Beim sexuellen Mißbrauch wird oft dem eigenen Körper die Schuld gegeben, etwas stimmt nicht mit ihm, was andere auch erkennen könnten. Dies kann zu Verdeckungsbestrebungen und Bewegungseinschränkungen des Körpers führen, gerade wenn der Täter aus der unmittelbaren sozialen Umwelt kommt, was meistens der Fall ist.
Hinzu kommt die Rolle der Jungen im Sportunterricht. Dominanz, voralledingen bei den Ball- sportarten, Kritik und sexistische Anmache führen zu vielen negativen Erfahrungen. Der Spaß am Sport und das körperliche Bewegungsvertrauen leiden sehr stark darunter. Gerade dieser letzte Aspekt wirft einmal mehr die Frage auf, ob es nicht sinnvoller ist, teilweise die Geschlechter im Sportunterricht zu trennen. Erfahrungen während meines Praktikums an der Laborschule unterstützen dieses. Ich habe nie zuvor Mädchen in den dementsprechenden Stunden so aktiv und mit soviel Leidenschaft Volleyball spielen sehen. Selbst ansonsten bewegungsarme Mädchen, die dem Spielgeschehen meistens eher zuschauen, waren mit vollem Einsatz bei der Sache.
Ein Ziel des Sportunterrichtes in den Schulen, ist die 'Animation' zum lebenslangen Sporttreiben. Das dieses keine leichte Aufgabe ist, ist mir einmal mehr durch diese Hausarbeit klargeworden. Konkret heißt das für die Zukunft, daß ich versuchen werde, mein Wissen in die Praxis umzusetzen. Wie kann ich Mädchen besser fördern, ihren Interessen mehr entgegen kommen oder wie das Verhalten ihrer männlichen Artgenossen entschärfen.
8) Literaturverzeichnis
BESENS , T. / VAN VUGT , G : Wo Worte nicht reichen. Therapie mit Inzestbetroffenen
München 1990
HURRELMANN : Einführung in die Sozialisationstheorie Weinheim 1986
KLEIN , M. : Frauen im Sport - gleichberechtigt ?
Stuttgard 1987
KURZ , D u.a : Kindheit, Jugend und Sport in NRW. Der Sportverein und seine Leistungen
Düsseldorf 1996
MEAD , M. : Mann und Weib. Das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt Hamburg 1958
PALZKILL , B. : Was hat sexuelle Gewalt mit Sport ( Abstinenz ) zu tun ? In : PALZKILL u.a. (HG) : Bewegungs(t)räume
München 1991
SCHEFFEL , H. : MädchenJungenSpiele
In :PALZKILL u.a.(HG) : Bewegungs(t)räume
München 1991
SOBIECH , G. : Ich hatte das Gefühl irgendetwas ist jetzt vorbei ! In : PALZKILL u.a. (HG) : Bewegungs(t)räume
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum Mädchen weniger Sport treiben als Jungen. Sie untersucht empirische Daten, geschlechtsspezifische Sozialisation, sexuellen Missbrauch, Schönheitsideale und den koedukativen Sportunterricht als mögliche Gründe.
Welche empirischen Daten werden angeführt?
Es werden Mitgliedszahlen des Deutschen Sportbundes (DSB) und Daten zur Sportaktivität in der Freizeit herangezogen, um zu zeigen, dass Mädchen in Vereinen unterrepräsentiert sind und insgesamt weniger organisierten Sport betreiben.
Welchen Einfluss hat die geschlechtsspezifische Sozialisation?
Die Arbeit argumentiert, dass Mädchen und Jungen unterschiedlich sozialisiert werden. Eltern, insbesondere der Vater, spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von sportspezifischen Einstellungen. Mütter werden als weniger sportinteressiert wahrgenommen, was sich auf die Affinität der Töchter zum Sport auswirken kann.
Wie spielt sexueller Missbrauch eine Rolle?
Sexueller Missbrauch kann zu einer massiven Verletzung der Persönlichkeit führen. Betroffene Mädchen können ein negatives Körperbild entwickeln und Situationen vermeiden, in denen sie sich ausziehen oder umziehen müssen, was die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten erschwert.
Welchen Einfluss hat der Schönheitskult?
Der Schönheitskult und der damit verbundene Druck, einem bestimmten Körperideal zu entsprechen, können dazu führen, dass Mädchen ihren Körper ablehnen und den Rückzug aus dem aktiven Sport antreten, um nicht im Mittelpunkt zu stehen.
Welche Probleme gibt es im koedukativen Sportunterricht?
Der koedukative Sportunterricht wird kritisiert, weil Jungen oft bevorzugt werden und Sportarten dominieren, die eher ihren Interessen entsprechen. Mädchen werden an den Rand gedrängt und erfahren weniger Erfolgserlebnisse. Zudem können Kritik und sexistische Anmache seitens der Jungen das Selbstvertrauen der Mädchen beeinträchtigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die geschlechtsspezifische Sozialisation, die Bedeutung des eigenen Körpers, sexueller Missbrauch und das Verhalten von Jungen im Sportunterricht dazu beitragen, dass Mädchen weniger Sport treiben. Die Trennung der Geschlechter im Sportunterricht könnte in bestimmten Fällen sinnvoller sein, um Mädchen besser zu fördern.
Welche Literatur wird zitiert?
Die Hausarbeit zitiert Werke von BESENS , T. / VAN VUGT , G, HURRELMANN, KLEIN , M., KURZ , D u.a., MEAD , M., PALZKILL , B., SCHEFFEL , H. und SOBIECH , G.
- Quote paper
- Floriana Müller (Author), 1995, Warum treiben Mädchen weniger Sport als Jungen ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102602