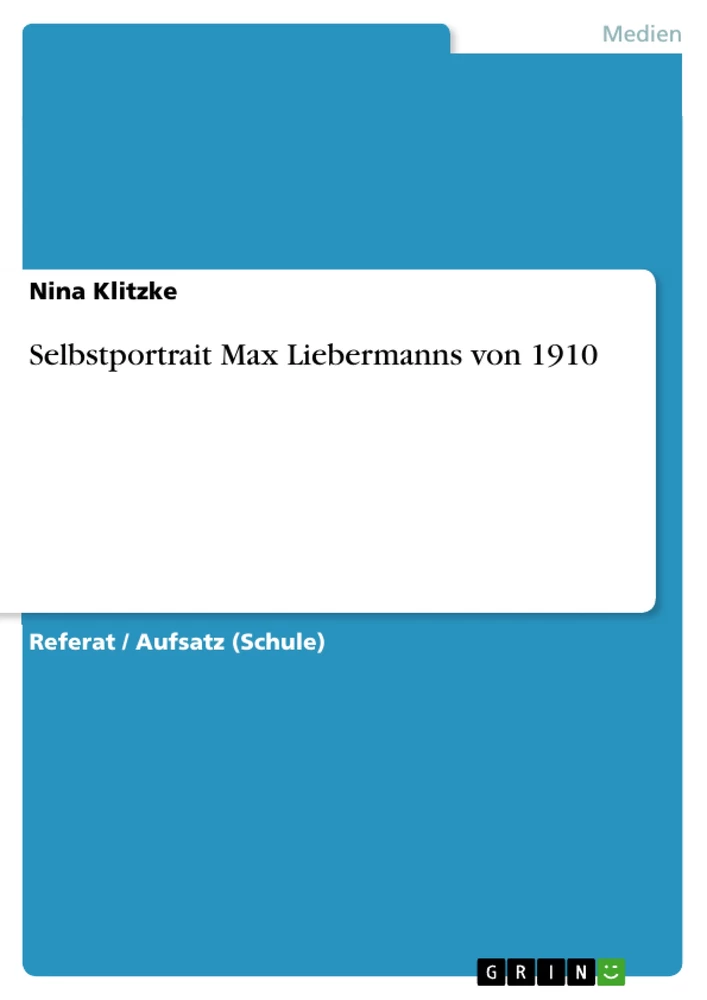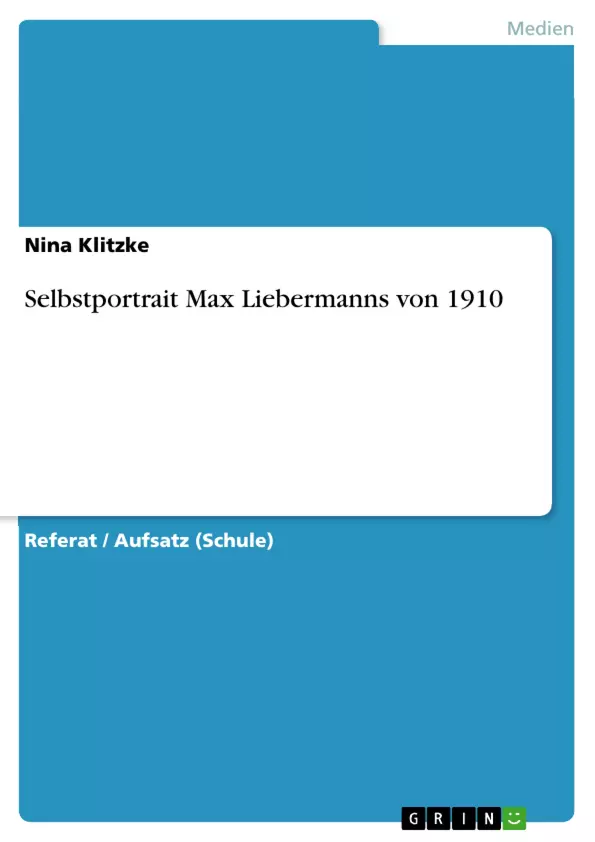Max Liebermann (1847 - 1935)
Der Maler und Graphiker Max Liebermann ist mit Lovis Corinth und Max Slevogt einer der wichtigsten Repräsentanten des deutschen Impressionismus.
Lebenslauf Liebermanns:
1847: Max Liebermann wird am 20. Juli in Berlin als Sohn des jüdischen Fabrikanten Louis Liebermann geboren.
1866-1868: Parallel zum Studium an der Philosophischen Fakultät der Berliner Universität nimmt Liebermann Malunterricht.
1869-1872: Studium an der Kunstakademie in Weimar Er malte naturalistische Gemälde sozialer Thematik, meist in düsterem Kolorit.
1873: Er zieht nach Paris, wo er Anregungen in den Werken der französischen Naturalisten Gustave Courbet und Jean Francois Millet findet.
1876: Er reist zum ersten Mal nach Holland, dessen Landschaft und Menschen ihm zahlreiche Motive für seine zunehmend heiteren Werke bieten. Es entstehen erste Bilder in der Technik der Freiluftmalerei. Von da an verbrachte er die Sommermonate häufig in den Niederlanden.
1878: Liebermann zieht nach München.
1884: Er kehrt nach Berlin zurück, wo er kurz darauf Martha Marckwald heiratet. Der Ehe entstammt eine Tochter.
Die Auseinandersetzung mit anderen Impressionisten führte in den achtziger Jahren zu einer weiteren Aufhellung seiner Palette, wodurch sich allmählich der für die späte Schaffensphase typische pastose, schwungvolle Farbauftrag entwickelt.
1889: Liebermann ist Mitorganisator einer inoffiziellen Beteiligung deutscher Künstler an der Pariser Weltausstellung. Das Deutsche Reich beteiligt sich wegen „antimonarchistischer“ Tendenzen in Frankreich nicht.
1894: Er nimmt an einer Ausstellung des Pariser „Salons“ teil und wendet sich von den Arbeitsbildern nach holländischen Vorbild ab und öffnet sich zunehmend dem Einfluß der modernen französischen Kunst.
1896: Mit einer Studie über den französischen Maler Edgar Degas veröffentlicht er in der Zeitschrift „PAN“ seine erste schriftstellerische Arbeit.
1897: Anläßlich seines fünfzigsten Geburtstags wird sein Werk in der Akademieausstellung gewürdigt und zum Professor der königlichen Akademie der Künste in Berlin ernannt.
1898: Als Mitglied der Jury der „Großen Berliner Kunstausstellung“ empfiehlt er zur Prämierung Werke von Käthe Kollwitz und Walter Leistikow, mit dem er am zweiten Mai die „Berliner Secession“ gründet, nachdem die Bilder von Wilhelm II und anderen Mitgliedern der Jury abgelehnt worden waren.
1899: Liebermann wird zum Vorsitzenden der Berliner Secession gewählt. Er zählte nun zu den prominentesten deutschen Malern seiner Zeit.
1904: Die Berliner Secession nimmt an der Weltausstellung in St. Louis nicht teil, da ihr eine freie Auswahl der Bilder verwehrt wird.
Die Portraitmalerei gewinnt große Bedeutung in Liebermanns Werk.
Er veröffentlicht den zum Verständnis seiner Kunst bedeutenden Aufsatz: „Die Phantasie der Malerei“.
1908: Die Reihe der Selbstportraits setzt ein. Er hat sich mit seinen über sechzig Jahren erst sehr spät als bildwürdig empfunden.
1910: Die Jury der Berliner Secession weist die Bilder der Expressionisten zurück, woraufhin einige junge Künstler die Vereinigung verlassen und die „Neue Secession“ gründen.
1911: Liebermann tritt als Vorsitzender zurück und Lovis Corinth übernimmt den Vorsitz der Berliner Secession.
1914: Liebermann schließt sich der abgespaltenen freien Secession an und beginnt sich aus Berlin in sein Haus am Wannsee zurückzuziehen.
1917: Anläßlich seines siebzigsten Geburtstags wird eine Gesamtschau seines Werks in der königlichen Akademie der Künste veranstaltet.
Er portraitiert Großadmiral von Tirpitz.
1920: Er wurde zum Präsidenten der „Preußischen Akademie der schönen Künste berufen , für die er ein neues liberales Programm entwirft, das er jedoch nicht durchsetzen kann.
Seine Kunstrichtung, der Impressionismus, galt in der Weimarer Republik als verurteilt. Seitdem malte er nur noch berühmte Persönlichkeiten und seine Umgebung: sein Haus, den Garten am Wannsee, seine Familie und sich selbst.
1927: Er portraitiert den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg.
1932: Er wird zum Ehrenpräsidenten der Preußischen Akademie der schönen Künste ernannt.
1933: Als Jude wird Liebermann von den Nazis Arbeitsverbot erteilt. Da die Sektion für Bildende Kunst der Preußischen Akademie der schönen Künste beschließt keine Werke jüdischer Künstler mehr auszustellen, erklärt er öffentlich seinen Austritt aus der Akademie.
1935: Nachdem er seine letzten beiden Lebensjahre zurückgezogen und verbittert in seiner Villa am Wannsee in Berlin verbracht hatte, starb er dort am 8. Februar.
Selbstbildnis von 1910
Liebermann hat viele Aufträge bekommen Portraits anderer Menschen zu malen. Diese Aufgabe, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, regte Liebermann auch zur Befragung seines Ichs an. Seit 1902, als die Direktion der Uffizien in Florenz mit dem Auftrag eines Selbstportraits den Anstoß gegeben hatte, malte sich der alternde Künstler bald häufiger, ohne alle Eitelkeit, sondern mit der ihm eigenen Nüchternheit.
Das Selbstbildnis, das 1910 entstand, ist eines der schönsten, freiesten Selbstbildnisse. Liebermann hat es im Auftrag des befreundeten Alfred Lichtwark in Hamburg angefertigt.
Er meint, daß die Portraitkunst einen Kopf innerlich auffassen muß, da man sonst die Natur kopiere. Er wollte die Menschen nicht so schön wie möglich malen, sondern ihr Inneres darstellen: ihren Character und ihre Eigenschaften.
Er wollte sich nicht als „Malerfürst darstellen, sondern als innerlich starken Menschen. Denn in seinem von sechs Jahrzehnten gezeichnetem Gesicht spürt man die Selbstdisziplin, die Energie und zugleich seine Impulsivität, die sein Wesen auszeichneten. Er wollte vermitteln, daß ihm nichts Menschliches fremd war, sarkastisch und ungeduldig, aber auch liebenswert und überaus witzig im Berliner Dialekt.
Beschreibung der Selbstdarstellung von 1910
Liebermann hat es mit Öl auf eine 112 x 92,5 cm große Leinwand gemalt. Es ist nicht signiert und steht heute in der Hamburger Kunsthalle.
Auf dem Bild steht Liebermann vor einem Spiegel schräg nach rechts gedreht zum Betrachter und schaut ihn direkt an. Der Kopf ist aber nicht frontal zu sehen, sondern etwas nach rechts gedreht. Seine Haltung ist aufrecht und gerade, aber trotzdem sehr zwanglos. Sein Kopf ist minimal gehoben. Er wirkt stolz, selbstbewußt und diszipliniert.
Seine linke Hand steckt lässig in der Tasche der schwarzen Hose. In der Rechten hält er eine brennende Zigarette zwischen dem Zeige- und dem Mittelfinger. Mit dem Daumen berührt er das Ende der Zigarettenspitze. Die Finger sind angewinkelt; der Arm ebenfalls. Bis zum Ellbogen hält er ihn am Körper und der Unterarm ist bis etwas über die Horizontale angehoben. Die Hand ist nochmals gehoben, so daß die Handfläche zu sehen ist.
Der kantige Kopf Liebermanns kommt plastisch zur Geltung. Er hat einen buschigen Oberlippenbart über dem geringfügig geöffneten Mund mit den leicht hängenden Mundwinkeln. Seine Nase ist breit und markant und er hat Tränensäcke.
Über den dunklen Augen, die den Betrachter ernst ansehen, befinden sich ebenfalls dunkle, aber unnatürlich geformte Augenbrauen. Sie sind nicht so wie das Lid geformt, sondern machen nach außen hin einen Bogen nach oben. Desweiteren hat er Stirnfalten und eine Halbglatze. Die übriggebliebenen Haare sind dunkel und noch nicht grau.
Er trägt einen hellen beigefarbenen offenen Malerkittel und darunter ein weißes Hemd mit dunkler Krawatte, die unter dem schwarzen Pullover, den er über dem Hemd trägt, kaum zusehen ist. Die linke Hälfte des Kittels liegt hinter der linken Hand. Die Hemdärmel schauen etwas unter den Ärmeln des Kittels hervor. Seine schwarze Hose und sein schwarzer Pullover sind kaum differenzierbar.
Der Spiegel im Hintergrund gibt einen Teil seiner Rückenseite wieder, die man aber nicht so deutlich wie Liebermann selbst erkennen kann, weil er selbst ja den Mittelpunkt darstellt. Zieht man die Senkrechte nach ⅔ des Bildes von der linken Bildseite aus, befindet sich der dunkle Spiegel auf der linken Bildhälfte. Dieser ist durch einen breiten mittel- bis dunkelbraunen Holzrahmen von der schmucklosen grauen Atelierwand getrennt. Zieht man die Horizontale nach ⅔ des Bildes von unten aus, befinden sich im unteren rechten Teil einige Bilder Liebermanns, die an der Atelierwand lehnen. Eines davon zeigt ein Pferd mit Reiter von der Seite. Solche Bilder hat er öfter gemalt.
Die Horizontale trennt auch den Kopf vom Körper, der sich mit Ausnahme der rechten Hand im linken unteren Teil befindet.
Liebermann hat keine hervorstechenden Farben benutzt, weil sie nicht nötig waren um ihn darzustellen. So entsteht keine Unruhe, denn das Bild wirkt einheitlich und harmonisch. Er hat keine Grundfarben verwendet, sondern mit Schwarz, Weiß und Brauntönen gearbeitet, also weder mit besonders warmen noch mit besonders kalten Farben.
Die einzigen Kontraste stellen der weiße hervorstechende Hemdkragen und der Malerkittel mit dem schwarzen Pullover.
Er hat sich sehr natürlich und ohne Eitelkeit dargestellt, weil es ihm nicht auf das Aussehen ankommt, sondern auf das, was seine Körperhaltung und sein Gesichtsausdruck aussagen. Und das kann er nur, indem er sich real und nicht verzerrt oder ideal darstellt.
Quellen: http://www.im-netz.de/kunstkreis -berlin/bilder.html
http://www.dhm.de/lemo/biografien/LiebermannMax/indes.html
„Liebermann, Max“, Microsoft ® Encarta ® 98 Enzyklopädie
Häufig gestellte Fragen zu Max Liebermann (1847 - 1935)
Wer war Max Liebermann?
Max Liebermann (1847-1935) war ein bedeutender deutscher Maler und Graphiker, und zusammen mit Lovis Corinth und Max Slevogt einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Impressionismus.
Wann und wo wurde Max Liebermann geboren?
Max Liebermann wurde am 20. Juli 1847 in Berlin geboren.
Was waren Liebermanns frühe Studien?
Er studierte parallel an der Philosophischen Fakultät der Berliner Universität und nahm Malunterricht. Später studierte er an der Kunstakademie in Weimar.
Welchen künstlerischen Einflüssen war Liebermann ausgesetzt?
In Paris fand er Anregungen in den Werken der französischen Naturalisten Gustave Courbet und Jean Francois Millet. Die Landschaft und Menschen Hollands boten ihm ebenfalls zahlreiche Motive. Später öffnete er sich dem Einfluss der modernen französischen Kunst.
Wann entdeckte Liebermann Holland als Motivquelle?
Er reiste 1876 zum ersten Mal nach Holland, wo er viele Motive für seine Werke fand und die Technik der Freiluftmalerei entwickelte.
Wann kehrte Liebermann nach Berlin zurück?
Er kehrte 1884 nach Berlin zurück.
Welche Rolle spielte Liebermann in der Berliner Secession?
Er war Mitorganisator der inoffiziellen Beteiligung deutscher Künstler an der Pariser Weltausstellung 1889. Er gründete die Berliner Secession im Jahr 1898 und wurde 1899 zu deren Vorsitzenden gewählt.
Welche Bedeutung hatte die Portraitmalerei in Liebermanns Werk?
Die Portraitmalerei gewann im Laufe der Zeit große Bedeutung in Liebermanns Werk.
Wann begann Liebermann mit Selbstportraits?
Die Reihe der Selbstportraits setzte um 1908 ein.
Welche Positionen bekleidete Liebermann in der Kunstwelt?
Er wurde zum Professor der königlichen Akademie der Künste in Berlin ernannt und später zum Präsidenten der Preußischen Akademie der schönen Künste berufen.
Wie reagierte Liebermann auf die Verfolgung durch die Nationalsozialisten?
Als Jude wurde Liebermann von den Nazis mit Arbeitsverbot belegt und er erklärte öffentlich seinen Austritt aus der Preußischen Akademie der schönen Künste.
Wann und wo starb Max Liebermann?
Max Liebermann starb am 8. Februar 1935 in seiner Villa am Wannsee in Berlin.
Was ist besonders an Liebermanns Selbstbildnis von 1910?
Das Selbstbildnis von 1910 wird als eines der schönsten und freiesten Selbstbildnisse Liebermanns angesehen. Er wollte sich nicht als „Malerfürst“ darstellen, sondern als innerlich starken Menschen zeigen.
Wo befindet sich Liebermanns Selbstbildnis von 1910 heute?
Das Selbstbildnis befindet sich heute in der Hamburger Kunsthalle.
Welche Farben dominieren Liebermanns Selbstbildnis von 1910?
Er hat keine hervorstechenden Farben benutzt, sondern mit Schwarz, Weiß und Brauntönen gearbeitet.
- Quote paper
- Nina Klitzke (Author), 2001, Selbstportrait Max Liebermanns von 1910, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102445