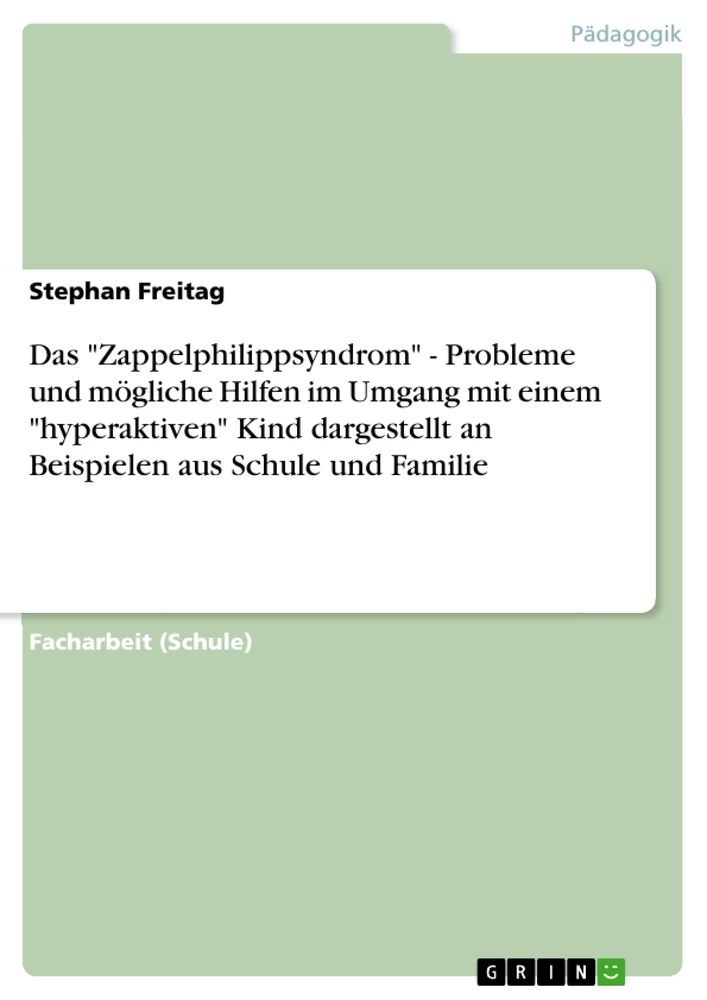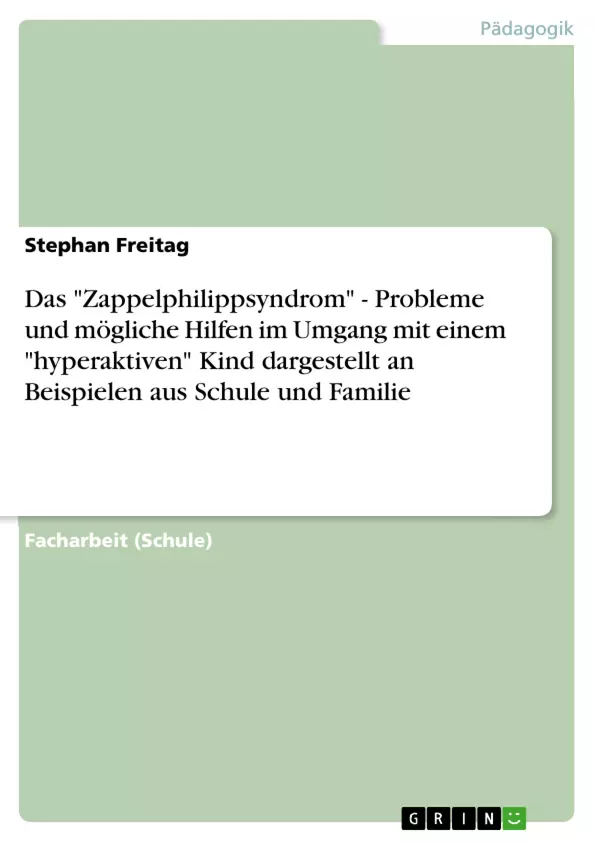Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung . . .
2. Das Krankheitsbild und die verschieden Verhaltensmuster des sogenannten ,,hyperaktiven“ Kindes in der Schule . . .
3. Die Rolle der Familie des „hyperaktiven“ Kindes . . .
4. Wie fühlt sich ein „hyperaktives“ Kind und was geht in ihm vor? . . .
5. Mögliche nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten und verschiedene Handlungsempfehlungen . . .
6. Medikamentöses Eingreifen durch Psychopharmaka - Beispiel „Ritalin“ . .
7. Literaturverzeichnis . . .
8. Erklärung . . .
Literaturverzeichnis
Autor unbekannt: Das hyperaktive Kind in unserer Familie, www.omkara.de/hyperaktiv
Autor unbekannt: Was geht in einem solchen Kind vor?, www.omkara.de/teufelskreis
Voß, Reinhard: Anpassung auf Rezept, Klett Cotta 1987
Voß, Reinhard: Pillen für den Störenfried?, Hoheneck 1983
Winkler, Martin: Umgang mit und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, www.psychologie-online.ch
Winkler, Martin & Rosse, Pierre: ADHS in der Schule, www.psychologie-online.ch
Vorwort
In der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen fallen oft genug extrem „aus der Reihe tanzende“ Persönlichkeiten auf, die nicht selten ein kaum mehr tragbares Verhalten für ihre Umgebung, Lehrer, Mitschüler, Freunde und Familie, zeigen. Sie zeigen keinerlei Respekt gegenüber Autoritätspersonen, pöbeln ohne weiteres fremde Leute an, und beweisen immer wieder eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Jeden Tag werden
wir, in der Schule mit derartigen Problemen konfrontiert. Lehrer beschweren sich über „Störenfriede“ im Unterricht, Schüler beschweren sich ständig über nervige Mitschüler usw.!
Ich habe dieses Thema gewählt und mich damit auseinandergesetzt, um eine mögliche Begründung für derartiges Verhalten zu finden. Meist wird auf ein gestörtes Umfeld der Kinder geschlossen. Oder es wird behauptet, dass diese Kinder doch einfach nur „hyperaktiv“ seien.
Mit dieser Arbeit möchte ich versuchen, Vorurteile im Bezug auf diese Kinder aus dem Weg zu räumen, und einen möglichen „geregelteren“ Umgang zwischen diesen Kindern und deren Umfeld, aufzuzeigen.
Ich möchte anmerken, dass es mir nicht leichtgefallen ist, mich mit diesem Thema zu befassen, da „Hyperaktivität“, in der Fachsprache ADHS genannt, eine, medizinisch sehr komplexe Krankheit ist. Ich habe versucht, aus einer großen Zahl an Quellen, das wichtigste herauszufiltern, und somit eine klare, differenzierte Schilderung der Krankheit zu schaffen.
Einleitung
„Unruhige Kinder, die ihre Eltern, Altersgefährten, Lehrer und ihre Umgebung besonders strapazieren, sind ein altbekanntes Phänomen. Im 19. Jahrhundert sprachen Kinderärzte vom moralisch kranken Kind, Sklave seiner Leidenschaften, Schrecken der Schule, Qual der Familie, Plage der Umgebung und definierten das impulsive Irresein als kindliche Seelenstörung. Berühmte Persönlichkeiten wie Mozart, Edison und Einstein wären nach heutigen Maßstäben verhaltensauffällig- damit auch therapiebedürftig?“1
Kinder, die nicht einer genormten Vorstellung von einem sozial angepassten Kind entsprechen, und eine Belastung für Ihre Umgebung darstellen, werden heutzutage schnell als hyperaktiv abgestempelt. Nach einer Studie des NRW- Gesundheitsministeriums, bemerken 40 Prozent aller Mütter Verhaltensauffälligkeiten bei ihrem Kind. Jeweils 13 Prozent wurden von Lehrern, Eltern und Kinderärzten als hyperaktiv eingestuft. Allerdings stimmten nur 1,3 Prozent von den Beurteilungen der vorgestellten Kinder überein. Das Umfeld eines solchen Kindes reagiert oft mit Abstoßung und Isolierung des Kindes. Wird das Kind allerdings für seine Umgebung „untragbar“, so werden die Kinder letztendlich mir der Vergabe eines beruhigend wirkenden Psychostimulansmittels namens Ritalin „erträglich“ gemacht. Im Folgendem wird zum einen beschrieben, wie sich diese „Hyperaktivität“ bei einem Kind äußert und mit welchen Problemen es und seine Familie belastet wird, beziehungsweise was dies für Auswirkungen zeigt. Es soll gezeigt werden, dass diese Kinder ein erstzunehmendes Krankheitsbild aufzeigen und Hilfe bedürftig sind. Der Trend zeigt dass in den USA inzwischen einem Grossteil der Schüler durch die Einnahme von Psychopharmaka angeblich „geholfen“ wird. Kritiker bezeichnen die Vergabe von Psychopharmaka als eine Medikamentisierung von sozialen Phänomenen. Im Verlauf dieser Arbeit sollen außerdem mögliche Ansätze der Behandlungen und Hilfen aufgezeigt, und die medikamentöse Behandlung in Frage gestellt werden.
Das Krankheitsbild und die verschieden Verhaltensmuster des sogenannten ,,hyperaktiven“ Kindes in der Schule Kinder, die sich in der Schule durch meist negativ auffälliges Verhalten bemerkbar machen, werden oftmals im alltäglichen Umgang als „hyperaktiv“ abgestempelt. Doch hinter diesem Verhalten verbirgt sich ein sehr komplexes und ernstzunehmendes Krankheitsbild. Die Fachsprache bezeichnet dieses Krankheitsbild im deutschsprachigen Raum mit dem Terminus ADHS. Dieser Terminus hat seinen Ursprung aus dem Englischen. Dort spricht man von einem „Attention-Deficit-Disorder“, kurz ADD. Hierbei handelt es sich um eine erhebliche Beeinträchtigung von Konzentration und Aufmerksamkeit. Liegen allerdings neben diesen Symptomen Störungen der Impulskontrolle und innere Unruhen vor, Eltern und Lehrer bezeichnen dies meist als eine Art Zappeligkeit, spricht man von ADHD, nämlich ADD mit Hyperaktivität. Wie bereits erwähnt, wird allerdings in der deutschen Fachsprache die Bezeichnung ADHS verwendet, und daher das Syndrom der Hyperaktivität im weiteren Verlauf dieses Textes mit dem Terminus ADHS beschrieben.
ADHS äußert sich bereits in der Säuglingszeit, oder aber auch später im Vorschulalter. Entdeckt wird diese Krankheit hauptsächlich von den Eltern, die im frühen Alter der Kinder, auffällige Spielverhalten oder motorische Koordinationsstörungen bemerken. Entdecken die Eltern von ADHS geschädigten Kindern keinerlei Symptome, geschieht dies meist später in der Schulzeit durch die Lehrer, die bei den Kindern ausgeprägte Lern- und Beziehungsprobleme bemerken. Lernprobleme äußern sich zum Beispiel durch stark schwankende oder gar ungenügende Leistungen. Zunächst fehlt den Kindern die Konzentration im Unterricht und sie werden schnell zu Träumereien verleitet und „kucken ständig zum Fenster hinaus“. Mitschüler werden durch diese entstehende Langeweile gestört und die Kinder lassen eine für den Lehrer nicht erträgliche Unruhe entstehen. Sie vergessen Unterrichtsmaterialien mitzubringen und ihre Hausaufgaben zu machen, da sie aufgrund mangelndem Wissen nicht in der Lage sind, sie anzufertigen. Auffällige Schüler geraten so oft in, für sie schwierige, Prüfungssituationen bei Klassenarbeiten oder im Unterricht. Dabei scheitern die Schüler immer wieder und werden zum Beispiel durch „auslachen“ von den Mitschülern und Lehrern, stark gedemütigt. Dies wirkt auf die Schüler sehr demotivierend und entmutigend, wodurch eine chronische Unlust auf Schule entsteht, und was zu vermehrtem Schuleschwänzen führt.
Für diese Probleme wird allerdings meist mangelnde Motivation oder aber Faulheit als Ursache angenommen. Nun ist es wichtig für die Lehrer zu erkennen, dass ADHS erkrankte Kinder den Unterricht nicht absichtlich stören, sondern aufgrund dieser neurobiologischen Störung nicht anders können. Damit ist gemeint, das ADHS erkrankte Kinder sich durchaus angemessen Verhalten können, allerdings benötigen sie einen weitaus höheren Aufwand an Selbstkontrolle.
„Schüler/-innen mit ADHS müssen sich also oftmals ungleich mehr anstrengenals die Mitschüler/-innen, um„nicht aufzufallen“und um den Erwartungen Dritter gerecht zu werden.“2
Die Rolle der Familie des „hyperaktiven“ Kindes
In den meisten Fällen wird den Eltern die Schuld für Ihre auffälligen und störenden Kinder gegeben. Nachbarn, Freunde, sogar minder versierte Therapeuten und nicht zuletzt die Lehrer, stellen das Problem mit den Kindern so dar, als wenn nur die Eltern, beziehungsweise ihre Erziehung, Schuld an dem Fehlverhalten ihrer Kinder seien.
Den Eltern stellt sich immer wieder die Frage, wie sie solch ein Kind ertragen sollen, wenn die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ununterbrochen auf einem bestimmten Level gehalten werden muss, da sonst das Kind wieder anfängt unruhig zu werden, in Wut auszubrechen oder mal wieder etwas kaputt zumachen. Sie werden im fortgeschrittenem Alter damit konfrontiert, ihrem Kind beizubringen sich in der Schule zu konzentrieren und ein angemessenes Verhalten zu zeigen, obwohl es aufgrund der Krankheit gar nicht in der Lage ist, dass so ohne weiteres zu tun.
Deutlich ist, das ein ADHS erkranktes Kind das Familienleben stark belastet. Die Eltern gehen oft bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, und finden dennoch meist kein Verständnis und keine Hilfe dafür. Das alltägliche Leben stellt für die Eltern solcher Kinder eine große Belastung dar.
„Für betroffene Eltern ist es schrecklich mit ansehen zu müssen, wie ihr Kind überall aneckt, abgelehnt wird, ausgeschlossen wird, keine Sache zu Ende bringen kann, sich gegen jede Autorität auflehnt, mit sich selbst in Hader gerät, sich selbst nicht als normal empfindet, und sie selbst als Eltern meist nichts ändern können.“3
Durch all diese Probleme steht das Kind unter Druck, da es seine Schulzeit und Freizeit alleine bewältigen muss. Es findet keinen Kontakt zu anderen Kindern, da sie es ablehnen. Es stört ihre Spiele, und ist für alle nur noch der „nervige Spielverderber“. Durch diese Ablehnung wird das Kind feindselig und aggressiv, zeigt eine hohe Gewaltbereitschaft und wird somit von allen und jedem nur noch gemieden.
In der Familie schlüpft das Kind in die Rolle des „Problemkindes“. Sogar für die partnerschaftliche Beziehung, beziehungsweise für das Eheleben der Eltern, ergibt sich eine enorme, meist unbewusste Belastung.
„Mutter und Vater geben den Druck, den das Umfeld auf sie ausübt oft an den Partner weiter. Ehen zerbrechen nach qualvollen Jahren der gegenseitigen Schuldzuweisungen, Streitereien, weil einer den anderen für unfähig erklärt ein
Kind zu erziehen. Zurück bleiben eine unglückliche Familie und ein Kind, dass sich wieder einmal schuldig fühlt.“4
Wie fühlt sich ein „hyperaktives“ Kind und was geht in ihm vor?
Offensichtlich ist, dass das Kind mehr Zuneigung benötigt als, zum Beispiel die anderen Kinder in einer Familie. Das Kind spürt natürlich, dass es seine Mutter mehr in Anspruch nimmt als alles andere.„Gleichzeitig wird es abgelehnt von allen, die ihm und vor allem für seine gesunde Entwicklung wichtig sind.“5 Das Kind fühlt sich natürlich in seiner Rolle als Außenseiter und Abgelehnter nicht wohl. Von allen Seiten wird ihm gezeigt, dass es unerwünscht ist und dass es keiner mag. Das Kind hat noch nicht einmal die Möglichkeit mit sich mit jemandem über die Probleme auseinander zusetzten, da es niemanden hat, der ihm zur Seite steht.„Ein schreckliches Gefühl von Verlorensein, Verlassensein, Alleinsein, Einsamkeit und Ausgegrenztsein für ein Kind.“6 Das Kind kann diese Gefühle für sich nur unterdrücken, indem es versucht sich trotz allem Aufmerksamkeit zu verschaffen. Leider endet dies wieder nur in negativem Auffallen. Findet das Kind allerdings doch mal Phasen der Ruhe, so setzt jeder in seinem Umfeld die Erwartung an einen neuen Ausbruch, da niemand es anders gewohnt ist. Das Kind merkt dass es auch in diesem Fall nicht positiv wahrgenommen wird. Daraus resultierend ist das Kind also weitgehend auf sich allein gestellt und ist somit, mit eventuell für seine eigene Zukunft wichtigen Entscheidungen, alleingelassen.
Mögliche nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten und verschieden Handlungsempfehlungen Der erste Schritt im Umgang und einer Behandlung eines ADHS erkrankten Kindes ist eine, durch einen Experten durchgeführte, Diagnose eine daraus abgeleitete Therapieempfehlung ist die Grundlage für eine für eine Erfolgreiche Behandlung des Kindes.
Wichtig ist, dass die Behandlung multimodal erfolgt. Das heisst, es sollte ein kollegiales Zusammenspiel zwischen Ärzten und Therapeuten aus verschieden Bereichen wie zum Beispiel Medizin, Pädagogik, Psychologie, Ergotherapeuten, Logopäden, Krankengymnasten und so weiter, stattfinden. Im Idealfall sollte dabei ein kompetenter Hausarzt oder ein Psychiater beziehungsweise ein Psychologe, die verschiedenen Interventionen und Behandlungsresultate koordinieren und den Austausch von Informationen der verschiedenen Berufsgruppen ermöglichen.
Im dritten Schritt einer Behandlung ist es von großer Bedeutung, wichtige Personen im Umfeld des Kindes, über die Besonderheiten des Kindes zu informieren und möglich anfallende Fragen von vornherein zu klären. Besonders die Eltern sollten sich bewusst mit dem Syndrom und den folgen auseinandersetzen, und insbesondere versuchen, auf schulische Belange Rücksicht zu nehmen, und bei Bedarf auch Lehrer frühestmöglich zu informieren.„Auch das betroffene Kind sollte entsprechend seines Entwicklungstandes angemessen informiert werden, wofür kindgerechte Metaphern und Beispiele eingesetzt werden. Hierbei sollte man vermeiden, ADHS als unheilbare Störung oder psychische Krankheit darzustellen.“7
Zum nächsten Schritt gehört eine gezielte Erziehungsberatung und ein spezielles Elterntraining. Damit das verhalten des Kinds positiv und konstruktiv verändert werden kann, sollten die Bezugspersonen in jedem der verschiedenen Lebensbereiche ein für das Kind voraussehbares und verständliches Vorgehen zeigen. Dabei sind klar Ziel- und Grenzsetzungen nicht nur hilfreich sonder notwendig.„Wichtig ist es, dass beide Elternteile lernen, entsprechende Erziehungsfertigkeiten - miteinander abgesprochen und koordiniert - anzuwenden und sich auch in Krisenzeiten daran halten können.“8 Letztlich ist das Ziel eines Elterntrainings, die Eltern-Kind-Interaktion zum positiven zu verändern.
Für die betroffenen Kinder gibt es verschieden Therapieprogramme. Ein in Deutschland weit verbreitetes und anerkanntes Programm namens THOP wurde von Döpfner und Mitarbeitern entwickelt. Hierbei wird das Ziel, die positive Veränderung der Eltern-Kind-Interaktion, durch eine Kombination von kinderzentrierten, aber auch familienzentrierten Ansätzen, erreicht. Abgesehen von diesem sehr umfangreichen Therapieprogramm, werden nun einige grundsätzliche Verhaltenstipps für Eltern angeführt:
- Protokollieren sie Häufigkeit und Schweregrad des problematischen Verhalten, um Problembereiche zu objektivieren und Veränderungen sichtbar zu machen
- Positive Interaktionen zwischen Eltern und Kindern sollten gefördert werden; Anstrengungen des Kindes sich an Ziele und Aufgaben zu halten sollten sogar honoriert werden.
- Widmen sie dem Kind einen festen Zeitrahmen in dem sie ihm ihre volle
Aufmerksamkeit schenken und vermitteln sie ihm so oft wie möglich das Gefühl geliebt und wichtig genommen zu werden.
- Geben sie ihrem Kind klare und eindeutige Anweisungen, die das Kind am besten wiederholt um sicherzugehen dass es sie verstanden hat. Geben sie nie mehr als zwei Anweisungen gleichzeitig damit es nicht überfordert wird.
- Beteiligen sie ihr Kind an Entscheidungen und Grenzsetzungen so weit es geht, damit es sich einbezogen fühlt, und ein Gefühl von Kontrolle vermittelt bekommt.
„Das Kind (und seinen Eltern) sollte klar sein, dass bestimmteVerhaltensweisen des Kindes das Zentrum der Probleme darstellt, nicht dasKind als ganze Person.“9
Medikamentöses Eingreifen durch Psychopharmaka - Beispiel „Ritalin“ Hilflosen Eltern stellt sich wo möglich oft die Frage, ob die Probleme des Kindes nicht ganz einfach durch die, in den USA schon weit verbreitete, Einnahme von verschiedenen Psychopharmaka, zu lösen wären. Reinhard Voß, steht dieser Frage sehr kritisch gegenüber. In einem von mehreren seiner veröffentlichten Bücher schreibt er:„Kinder und Jugendliche werden zu Hundertausenden mit Psychopharmaka behandelt mit dem Ziel der Normierung. Der Zwang, Störungen aufzuspüren und zu beseitigen, beruht auf einem technokratischen Menschenbild, dem als gestört alle Verhaltensweisen gelten, die nicht gewinnbringend anzuwenden sind. Ein disziplinärer Ansatz, der das Kind als Person einbezieht und nicht als Störer isoliert, kann einen Perspektivenwechsel herbeiführen.“10
Die Einnahme von Medikamenten sei schon allein aus dem Grund nicht richtig, da sich kaum ein Zusammenhang zwischen der Störung des Kindes und der Entscheidung für ein bestimmtes Psychopharmakon herstellen lässt. Reinhard Voß sieht die Ursachen für ein verhaltensgestörtes Kind in einem gestörtem oder nicht funktionierendem sozialen Umfeld. Vertreter dieser Ansicht bezeichnen, zum Beispiel das Medikament Ritalin als eine Psychodroge, die aggressives und unkontrolliertes verhalten auslöst. Ritalin sei für die Eltern der einzige Weg ihre missratene Erziehung zu kaschieren. Ritalin sei der vorprogrammierte Einstieg in eine Drogenkarriere, oder führt zu einem lebenslangen Medikamentenmissbrauch.
Die Wissenschaft widerlegt diese Vorurteile jedoch durch umfangreiche Studien.„Wissenschaftlich gesehen gilt heute die Behandlung der ADHS bzw. hyperkinetisches Syndrom mit Stimulanzien als die sicherste und erfolgsversprechende Therapieoption, die im Sinne eines multimodalen Therapieansatzes die Grundlage für die erfolgreiche Anwendung z.B. verhaltenstherapeutisch orientierter Therapieprogramme bietet.“11 Ritalin wirkt also nicht als Aufputschmittel, sondern die durch das Ritalin hervorgerufene, bessere Aufmerksamkeit, ist lediglich auf eine verbesserte Filterfunktion unnötiger Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen zurückzuführen.
Erklärung
Ich erkläre, dass ich diese Facharbeit ohne Fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.
Ort, Datum, Unterschrift: ___ Stephan Freitag
[...]
1 Claudia Mützelfeldt und Judith Grümmer, „Hampelmann und Zappelliese“, Service Zeit Familie, Sendung vom 17. Januar 2001
2 Martin Winkler & Piero Rossi: ADHS in der Schule, www.psychologie-online.ch
3 Autor unbekannt: Das hyperaktive Kind in unserer Familie, www.omkara.de/hyperaktiv
4Das hyperaktive Kind in unserer Familie, a.a.O.
5Autor unbekannt: Was geht in einem solchen Kind vor?, www.omkara.de/teufelskreis
6 Was geht in einem solchen Kind vor?, a.a.O.
7Martin Winkler: Umgang mit und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, www.psychologie-online.ch
8 Umgang mit und Behandlung von Kinder und Jugendlichen mit ADHS, a.a.O.
9 Umgang mit und Behandlung von Kinder und Jugendlichen mit ADHS, a.a.O.
10Reinhard Voss: Anpassung auf Rezept, Klett Cotta 1987
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere in Bezug auf ihr Verhalten in der Schule, die Rolle der Familie, ihre Gefühle und mögliche Behandlungsansätze.
Was sind einige der Inhaltsverzeichnispunkte dieser Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Punkte: Einleitung, Beschreibung des Krankheitsbildes ADHS und Verhaltensmuster, die Rolle der Familie, die Gefühlswelt des betroffenen Kindes, nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, medikamentöse Behandlung (Beispiel Ritalin) und ein Literaturverzeichnis.
Wie äußert sich ADHS in der Schule?
ADHS kann sich in der Schule durch Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe, Störung des Unterrichts, Vergesslichkeit, Lernprobleme und Schwierigkeiten im Umgang mit Mitschülern äußern. Betroffene Kinder zeigen oft schwankende Leistungen und geraten in Prüfungssituationen in Schwierigkeiten.
Welche Rolle spielt die Familie bei Kindern mit ADHS?
Die Familie spielt eine zentrale Rolle. Eltern von ADHS-Kindern sind oft stark belastet und stoßen auf Unverständnis. Die Erziehung kann sehr anstrengend sein, und es kommt nicht selten zu Problemen in der Partnerschaft der Eltern oder sogar zur Trennung.
Wie fühlt sich ein Kind mit ADHS?
Kinder mit ADHS fühlen sich oft als Außenseiter, abgelehnt und unverstanden. Sie haben Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen und werden oft gemieden. Es kann zu Gefühlen von Verlorenheit, Einsamkeit und Ausgegrenztsein kommen.
Welche nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Nicht-medikamentöse Behandlungen umfassen eine multimodale Therapie, die ein Zusammenspiel verschiedener Fachbereiche (Ärzte, Therapeuten, Pädagogen usw.) beinhaltet. Dazu gehören Erziehungsberatung, Elterntrainings und spezielle Therapieprogramme für Kinder.
Was beinhaltet ein Elterntraining?
Ein Elterntraining zielt darauf ab, die Eltern-Kind-Interaktion positiv zu verändern. Eltern lernen, ein vorhersehbares und verständliches Vorgehen zu zeigen, klare Ziele und Grenzen zu setzen und konstruktiv mit dem Verhalten des Kindes umzugehen.
Wie wirkt Ritalin bei ADHS?
Ritalin ist ein Psychopharmakon, das bei ADHS eingesetzt wird. Es wird jedoch kontrovers diskutiert. Einige sehen es als Möglichkeit, das Verhalten des Kindes zu normalisieren, während andere es als Medikamentalisierung sozialer Probleme und möglichen Einstieg in Drogenmissbrauch kritisieren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die durch Ritalin hervorgerufene, bessere Aufmerksamkeit, lediglich auf eine verbesserte Filterfunktion unnötiger Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen zurückzuführen ist.
Was sind einige Verhaltenstipps für Eltern eines ADHS-Kindes?
Einige Verhaltenstipps umfassen: Protokollierung des problematischen Verhaltens, Förderung positiver Interaktionen, dem Kind Aufmerksamkeit schenken, klare Anweisungen geben und das Kind in Entscheidungen einbeziehen.
Welche Bedeutung hat eine frühe Diagnose und Therapieempfehlung?
Eine frühe, von einem Experten durchgeführte Diagnose und die daraus abgeleitete Therapieempfehlung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung des Kindes.
Welche Quellen wurden für diese Arbeit verwendet?
Für diese Arbeit wurden verschiedene Quellen verwendet, darunter Webseiten und Bücher von Experten wie Reinhard Voß, Martin Winkler, und andere.
- Quote paper
- Stephan Freitag (Author), 2001, Das "Zappelphilippsyndrom" - Probleme und mögliche Hilfen im Umgang mit einem "hyperaktiven" Kind dargestellt an Beispielen aus Schule und Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102322