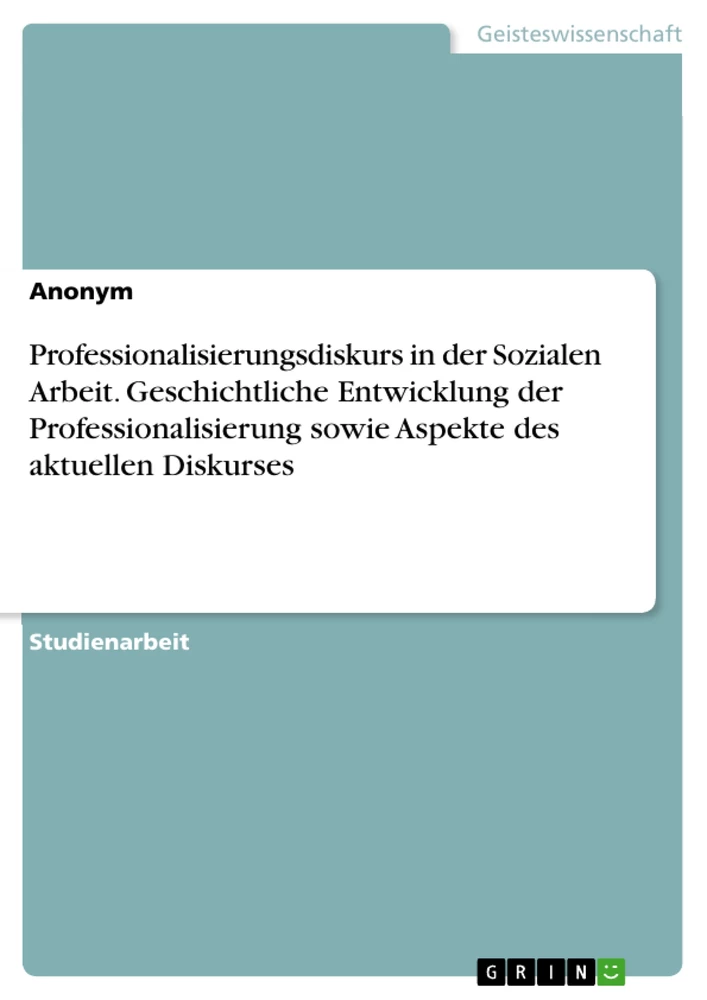Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Professionalisierungsdebatte nutzen können, um mit einem gestärkten Selbstverständnis für ihren Beruf und klaren Signalen an andere Professionen und die Gesellschaft hervorzutreten.
Die Aktualität und das Interesse an dem Thema Professionalisierung in der Sozialen Arbeit kann schon an der Fülle an Ergebnissen einschlägiger Begriffe in Internet-Suchmaschinen erahnt werden. Bei den oben genannten Schlagworten sind es um die 897 000 Treffer, grenzt man auf Professionsdebatte Soziale Arbeit ein, sind es immer noch rund 1750 Resultate.
Es ist ein Thema, das kontrovers, oftmals emotional und hitzig diskutiert wurde und wird.
Weder manche Experten noch viele Laien sind sich einig darüber, welchen Platz die Soziale Arbeit im Kanon der Professionen einnimmt bzw. ob sie überhaupt eine ist. Dies liegt vor allem an einem typischen Merkmal der Sozialen Arbeit, der mitunter diffusen Allzuständigkeit. Annähernd jeder Bereich im Leben der Klienten kann theoretisch zum Arbeitsfeld des Sozialarbeiters werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Themenstellung
- Ziel der Arbeit und Abgrenzung des Themas
- Aufbau der Ausarbeitung
- Professionalisierungsdiskurs in der Sozialen Arbeit
- Begriffsbestimmungen
- Beruf
- Klassische Definition von Profession
- Professionalisierung
- Semi-Profession
- Professionalisierungsbedürftigkeit
- Geschichtliche Entwicklung der Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Aspekte des aktuellen Professionalisierungsdiskurs
- Alltagsorientierte Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Soziale Arbeit als stellvertretende Deutung
- Soziale Arbeit als bescheidene Profession
- Reflexive Professionalität der Sozialen Arbeit
- Konsequenzen der Professionalisierung
- Professionelle Identität der Sozialen Arbeit
- Positionierung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem aktuellen Professionalisierungsdiskurs in der Sozialen Arbeit in Deutschland und seinen Auswirkungen auf die Profession und die damit verbundene professionelle Identität der Fachkräfte. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Diskurses, analysiert verschiedene Professionstheorien und untersucht die Konsequenzen der Professionalisierung für die Soziale Arbeit.
- Die historische Entwicklung des Professionalisierungsdiskurses in der Sozialen Arbeit
- Die verschiedenen Theorien und Perspektiven auf die Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Die Auswirkungen des Professionalisierungsdiskurses auf die professionelle Identität der Fachkräfte
- Die Relevanz von reflexiver Professionalität in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Selbstverständnis und Positionierung der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Relevanz des Professionalisierungsdiskurses für die Soziale Arbeit. Sie definiert die Ziele der Ausarbeitung und grenzt das Thema ab. Im ersten Kapitel werden zentrale Begriffe wie Beruf, Profession, Professionalisierung und Semi-Profession definiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Das zweite Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Professionalisierung der Sozialen Arbeit und stellt verschiedene Aspekte des aktuellen Professionalisierungsdiskurses vor.
Schlüsselwörter
Der Professionalisierungsdiskurs der Sozialen Arbeit, Professionstheorien, reflexive Professionalität, professionelle Identität, Selbstverständnis, gesellschaftliche Positionierung, Alltagsorientierung, stellvertretende Deutung, bescheidene Profession, akademisierung, Verwissenschaftlichung, Semi-Profession.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Professionalisierungsdiskurs in der Sozialen Arbeit. Geschichtliche Entwicklung der Professionalisierung sowie Aspekte des aktuellen Diskurses, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1022328