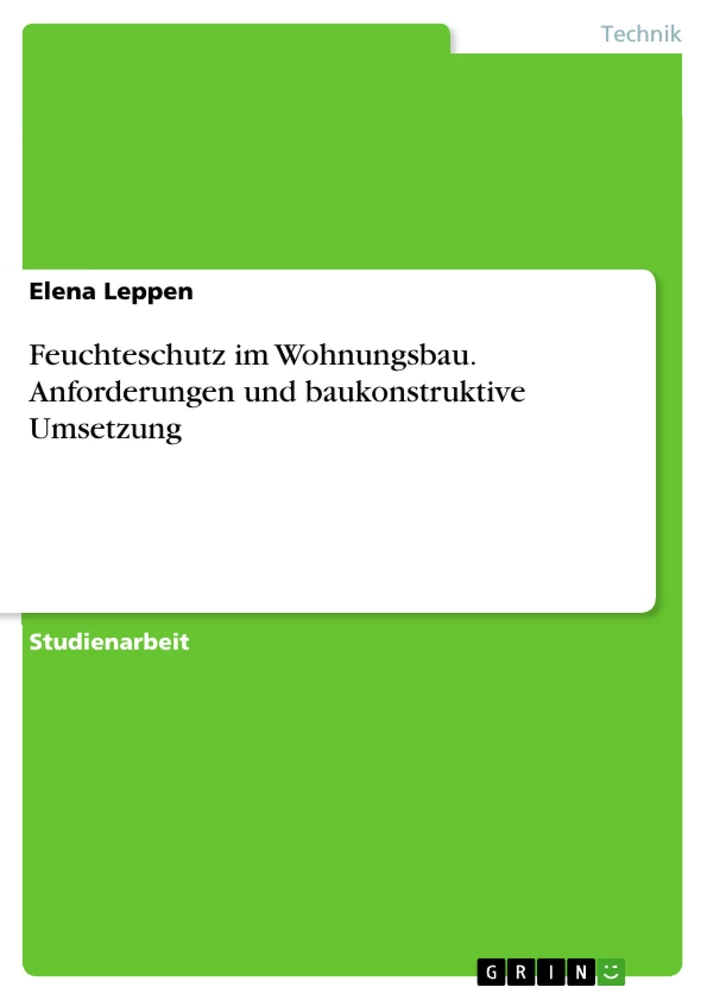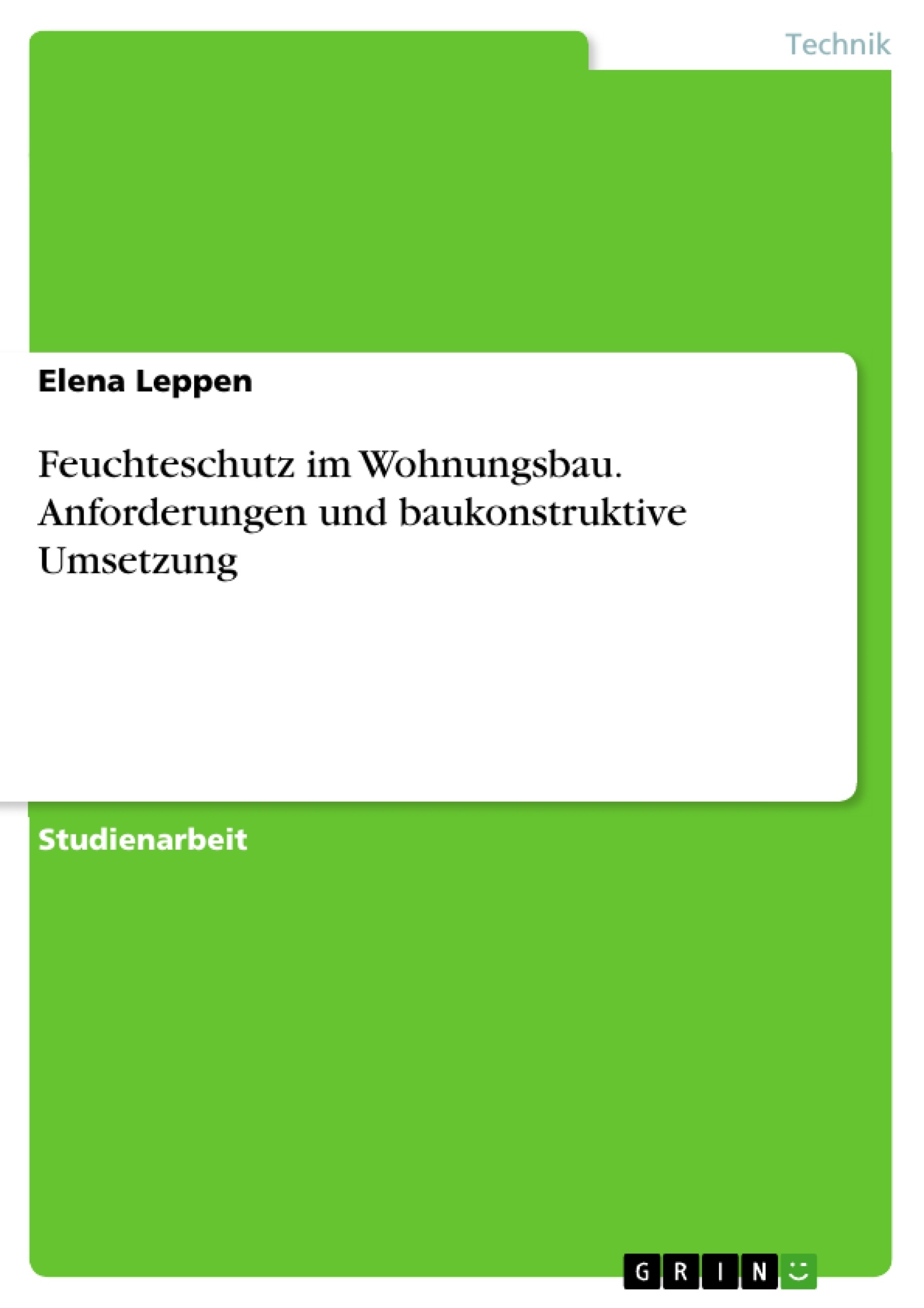Diese Arbeit behandelt das Thema Feuchteschutz im Wohnungsbau. Die häufigsten Schäden an Gebäuden werden durch Feuchtigkeitseinwirkung hervorgerufen. Feuchtigkeit kann auf unterschiedliche Weise entstehen und in die Konstruktion eindringen. So sind die über der Erdoberfläche liegenden Bauteile permanent der Witterung ausgesetzt. Ob Sonne und Wärme, Schnee und Kälte, Regen oder Wind, die äußeren Bauteile müssen eine hohe Beständigkeit gegen die unterschiedlichsten Wettereinflüsse aufweisen.
Unterirdische Bauteile hingegen müssen sich dem Eindringen der Bodenfeuchte widersetzen können. Doch auch im Inneren des Gebäudes entsteht Feuchtigkeit, insbesondere durch die Nutzung der Bewohner. Feuchtigkeit kann nicht nur geringe optische Mängel wie beispielsweise Verfärbungen verursachen, sondern auch zu erheblichen Bauschäden führen. Dabei kann sogar die Stabilität des gesamten Bauwerks gefährdet werden.
Um etwaige Schäden an Wohngebäuden zu verhindern, benötigen Bauwerke einen bewährten Feuchteschutz. Die Anforderungen und Hinweise für die Planung und Ausführung geeigneter Maßnahmen sind in verschiedenen Normen und Richtlinien aufgeführt. Da Immobilien eine gewisse Heterogenität aufweisen, ist es nicht möglich pauschale Empfehlungen für feuchteschutztechnische Maßnahmen zu treffen. Die individuellen Gegebenheiten müssen bei der Auswahl der klimatischen beziehungsweise konstruktiven Maßnahmen entsprechend berücksichtigt werden, um einen hinreichenden Schutz vor Feuchtigkeit sicherzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der physikalischen und feuchteschutztechnischen Grundbegriffe
- 2.1 Luft und Wasserdampf
- 2.1.1 Wasserdampfdiffusion
- 2.1.2 Wasserdampfdiffusionswiderstand
- 2.2 Relative Luftfeuchte
- 2.3 Taupunkt
- 2.4 Konstruktiver Feuchteschutz
- 2.5 Klimatischer Feuchteschutz
- 3. Gründe für die Notwendigkeit von Feuchteschutz
- 4. Normen und Standards
- 5. Baukonstruktive Maßnahmen an unterschiedlichen Gebäudeteilen
- 5.1 Schutz von Dächern und Fassaden
- 5.2 Schutz von erdberührten Bauteilen
- 5.3 Schutz von Bauteiloberflächen und dem Bauteilinnern
- 6. Praxisbeispiel: Abdichtung erdberührter Bauteile eines Wohngebäudes
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Anforderungen an den Feuchteschutz im Wohnungsbau und zeigt baukonstruktive Umsetzungsmaßnahmen auf. Ziel ist es, die Notwendigkeit von Feuchteschutzmaßnahmen hervorzuheben und dem Leser einen Einblick in die relevanten Normen und die praktische Anwendung zu geben.
- Definition physikalischer und feuchteschutztechnischer Grundbegriffe
- Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
- Relevante Normen und Standards im Feuchteschutz
- Baukonstruktive Maßnahmen zum Schutz verschiedener Gebäudeteile
- Praxisbeispiel für die Abdichtung erdberührter Bauteile
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Feuchteschutz im Wohnungsbau ein und beschreibt die Bedeutung der Thematik aufgrund der hohen Schadenshäufigkeit durch Feuchtigkeitseinwirkung. Sie hebt die Notwendigkeit individueller Lösungen aufgrund der Heterogenität von Immobilien hervor und benennt das Ziel der Arbeit: einen Einblick in die Anforderungen und baukonstruktiven Maßnahmen zu geben.
2. Definition der physikalischen und feuchteschutztechnischen Grundbegriffe: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie Luft, Wasserdampf, Wasserdampfdiffusion, Wasserdampfdiffusionswiderstand und relative Luftfeuchte. Es dient dem Verständnis der physikalischen Prozesse, die zur Entstehung von Feuchtigkeitsschäden beitragen und bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel. Die Definitionen werden durch Verweise auf relevante Literatur untermauert.
3. Gründe für die Notwendigkeit von Feuchteschutz: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. Es differenziert zwischen Umwelteinflüssen (Witterungseinflüsse auf oberirdische Bauteile), Nutzerverhalten (Feuchtigkeit durch Nutzung im Gebäudeinneren) und den daraus resultierenden Gebäudeschäden, die von optischen Mängeln bis hin zur Gefährdung der Gebäudestabilität reichen können. Die Darstellung unterstreicht die Notwendigkeit eines effektiven Feuchteschutzes.
4. Normen und Standards: Dieses Kapitel beschreibt wichtige Normen und Standards (DIN 4108-3, DIN 18195, Normengruppe DIN 18531-18535, DIN 4095) die im Feuchteschutz relevant sind. Es erläutert die Anforderungen an den klimatischen Feuchteschutz zur Vermeidung von Tauwasserbildung und detailliert die Normenreihe zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit. Die Kapitelstruktur verdeutlicht die verschiedenen Aspekte der Normen und deren Anwendung.
5. Baukonstruktive Maßnahmen an unterschiedlichen Gebäudeteilen: Dieses Kapitel präsentiert exemplarische bautechnische Maßnahmen zum Feuchteschutz an verschiedenen Gebäudeteilen wie Dächern, Fassaden und erdberührten Bauteilen. Es beschreibt konkrete Vorgehensweisen zur Vermeidung von Feuchtigkeitseinwirkung und -schäden. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung des Feuchteschutzes.
6. Praxisbeispiel: Abdichtung erdberührter Bauteile eines Wohngebäudes: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel, welches die Abdichtung erdberührter Bauteile eines Wohngebäudes beschreibt und bildlich dokumentiert. Es veranschaulicht die im vorherigen Kapitel beschriebenen baukonstruktiven Maßnahmen in einer realen Anwendung. Die visuelle Dokumentation erleichtert das Verständnis.
Schlüsselwörter
Feuchteschutz, Wohnungsbau, Baukonstruktion, Wasserdampfdiffusion, relative Luftfeuchte, Taupunkt, Normen (DIN 4108-3, DIN 18195, DIN 18531-18535, DIN 4095), Gebäudeschäden, Abdichtung, Klimaschutz.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Feuchteschutz im Wohnungsbau"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Feuchteschutz im Wohnungsbau"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Feuchteschutz im Wohnungsbau. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die Anforderungen an den Feuchteschutz und zeigt baukonstruktive Umsetzungsmaßnahmen auf.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition physikalischer und feuchteschutztechnischer Grundbegriffe (Luft, Wasserdampf, Diffusion, Taupunkt etc.), Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden, relevante Normen und Standards (DIN 4108-3, DIN 18195, DIN 18531-18535, DIN 4095), baukonstruktive Maßnahmen zum Schutz verschiedener Gebäudeteile (Dächer, Fassaden, erdberührte Bauteile) und ein Praxisbeispiel zur Abdichtung erdberührter Bauteile.
Welche Normen und Standards werden im Dokument erwähnt?
Das Dokument bezieht sich auf die Normen DIN 4108-3, DIN 18195, die Normengruppe DIN 18531-18535 und DIN 4095. Diese Normen sind relevant für den Feuchteschutz im Bauwesen und werden im Dokument erläutert.
Welche physikalischen und feuchteschutztechnischen Grundbegriffe werden definiert?
Definierte Begriffe umfassen Luft, Wasserdampf, Wasserdampfdiffusion, Wasserdampfdiffusionswiderstand und relative Luftfeuchte. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der physikalischen Prozesse, die zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Welche Ursachen für Feuchtigkeitsschäden werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet zwischen Umwelteinflüssen (z.B. Witterung), Nutzerverhalten (z.B. Feuchtigkeit im Gebäudeinneren) und den daraus resultierenden Schäden, die von optischen Mängeln bis zur Gefährdung der Gebäudestabilität reichen können.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der Definition grundlegender Begriffe, den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden, relevanten Normen, baukonstruktiven Maßnahmen und einem Praxisbeispiel. Es endet mit einer Zusammenfassung und Schlüsselwörtern.
Gibt es ein Praxisbeispiel im Dokument?
Ja, das Dokument enthält ein Praxisbeispiel zur Abdichtung erdberührter Bauteile eines Wohngebäudes, das die beschriebenen baukonstruktiven Maßnahmen veranschaulicht.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Das Dokument ist relevant für alle, die sich mit Feuchteschutz im Wohnungsbau befassen, darunter Architekten, Bauingenieure, Bauhandwerker und Studenten im Bereich Bauwesen. Es dient als informativer Überblick und kann zur Weiterbildung und im Studium verwendet werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Feuchteschutz, Wohnungsbau, Baukonstruktion, Wasserdampfdiffusion, relative Luftfeuchte, Taupunkt, DIN 4108-3, DIN 18195, DIN 18531-18535, DIN 4095, Gebäudeschäden, Abdichtung, Klimaschutz.
- Arbeit zitieren
- Elena Leppen (Autor:in), 2020, Feuchteschutz im Wohnungsbau. Anforderungen und baukonstruktive Umsetzung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1021103