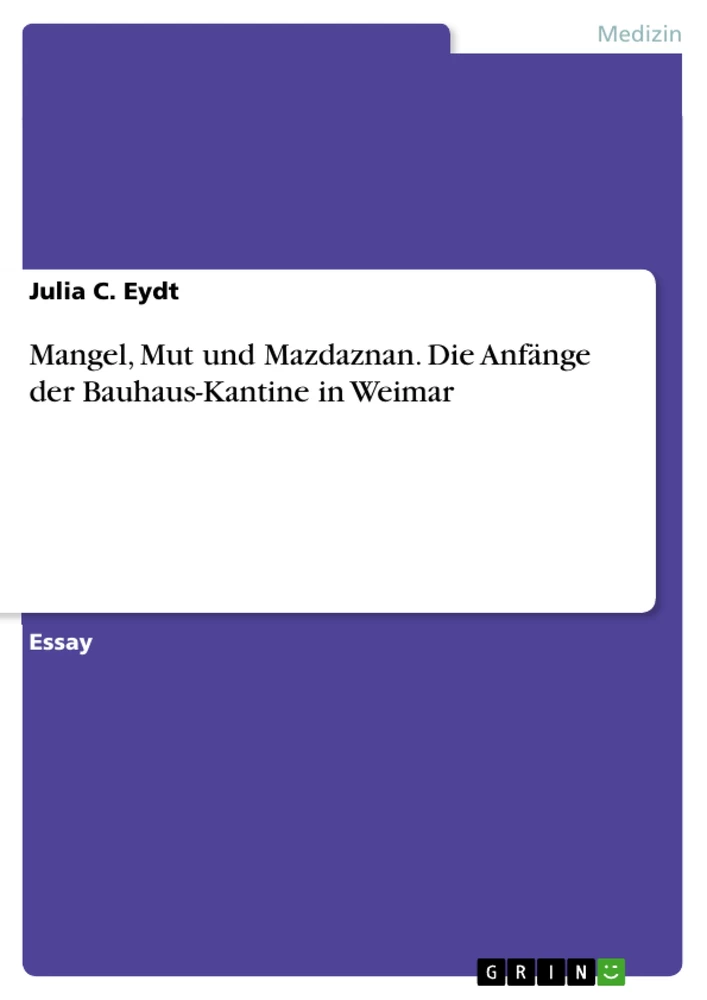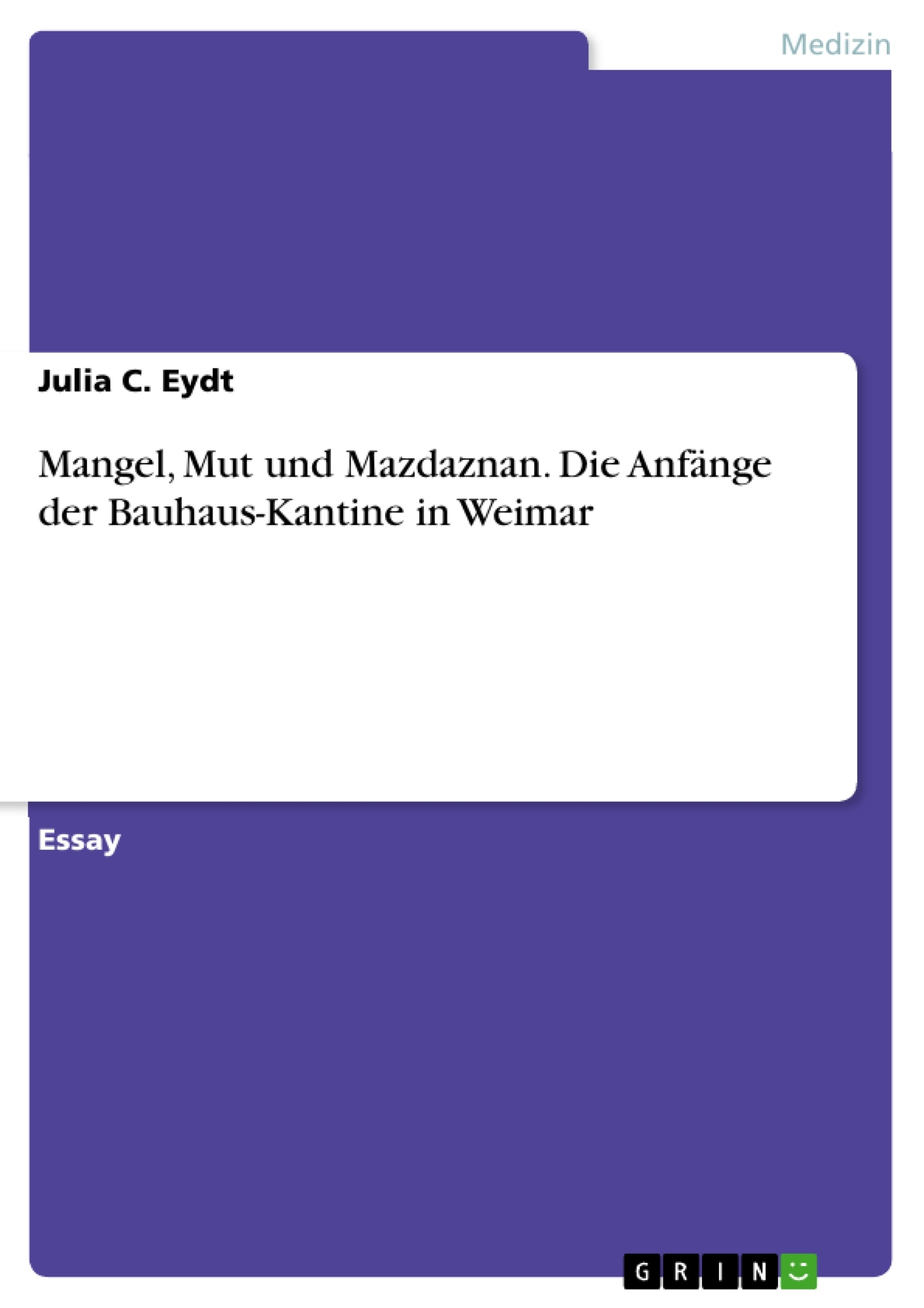Diese Arbeit befasst sich mit der Bauhaus-Mensa und Kantine in Weimar und ihrer Einbettung in den Kontext des Staatlichen Bauhaus in Weimar.
Als Walter Gropius (1883-1969) 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar ins Leben rief, steckte in diesem neuen künstlerischen Aufbruch mehr als nur die Idee einer neuen Kunst oder eines neuen Stils. Das Bauhaus akkumulierte die Vielzahl weltanschaulicher Strömungen der Zeit und sollte mit den Mitteln der Kunst nicht allein neue Kunstwerke erschaffen, sondern den „Neuen Menschen“ der deutschen Nachkriegszeit bauen. Als Spiegelbild einer Zeit der Ungewissheit und des Aufbruchs, war das Bauhaus bzw. waren die Bauhäusler geprägt von lebensreformerischen Ideen und Utopien, wie die einer nahenden, sozialistischen Gesellschaft, die gleichsam den Topos des „Neuen Menschen“ bedienten oder von den Idealen des Vegetarismus, der Reformpädagogik, der Siedlungsbewegung oder sich neu formierender religiöser Strömungen, wie bspw. des Mazdaznankultes.
Der "neue Mensch" der am Bauhaus kultiviert wurde, sollte innerlich wie äußerlich zur Blüte kommen. Von der Harmonisierung des Menschen hing auch die künstlerische, schöpferische Leistung ab, weshalb es eine wesentliche Aufgabe sein sollte, ihn in der Art zu bilden, dass er sowohl im innersten Wesen ausbalanciert als auch in seinem körperlichen Zustand im Gleichgewicht mit sich und der Umwelt war.
Für die innere Bildung –auch im Rahmen neuer pädagogischer Ansätze und Akzente– waren u.a. die Musikpädagogin Gertrud Grunow (1870-1944) oder der Maler und Bauhausmeister Johannes Itten (1888-1967) zuständig, der von vielen Schülern und Lehrern als eine Art spiritueller Führer des Mazdaznan verehrt wurde. Auf seinen Einfluss ist auch die Umstellung des Speiseplans an der Weimarer Bauhausmensa auf streng vegetarische Kost nach den Regeln der Mazdaznan-Ernährungslehre zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Mangel, Mut und Mazdaznan– Die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar
- Das „Wohnzimmer“ der Bauhäusler
- Himbeeren und Rhabarber auf dem Grundstück „Am Horn“
- Napoleonisches Tafelsilber für einen Zentner Kartoffeln
- Die Kantine als soziales Herzstück des Bauhauses
- Die Küchenkommission
- Meister Muche als Herr über Töpfe und Pfannen
- Ausblick in die Dessauer Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar, fokussiert auf die Herausforderungen und Lösungen bei ihrer Gründung in einer Zeit von Knappheit und gesellschaftlichem Umbruch. Sie beleuchtet die Rolle der Kantine als soziales und wirtschaftliches Zentrum des Bauhauses und ihren Zusammenhang mit den lebensreformerischen und utopischen Idealen der Bauhausbewegung.
- Die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Bauhaus-Gründung in Weimar
- Die Rolle der Kantine als soziales Herzstück des Bauhauses
- Der Einfluss des Mazdaznan-Kults auf die Ernährung der Bauhäusler
- Die Finanzierung der Kantine und die Bemühungen um wirtschaftliche Autonomie des Bauhauses
- Die Bedeutung der Kantine für das künstlerische Schaffen der Studierenden
Zusammenfassung der Kapitel
Mangel, Mut und Mazdaznan– Die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar: Der Text beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Bauhaus-Kantine in Weimar vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Not und der Utopien der Nachkriegszeit. Er schildert die Herausforderungen, die mit der Gründung einer Kantine für die finanziell benachteiligten Studenten verbunden waren und wie diese durch Improvisation und den Einfluss des Mazdaznan-Kults auf die Ernährung gemeistert wurden. Die Kantine wird hier als integraler Bestandteil der Bauhaus-Idee verstanden, die nicht nur den künstlerischen Aspekt, sondern auch die körperliche und geistige Gesundheit der Studierenden im Auge hatte. Die Suche nach dem "Neuen Menschen" stand im Fokus, und die Kantine sollte einen Beitrag zu diesem Ideal leisten.
Das „Wohnzimmer“ der Bauhäusler: Dieses Kapitel beschreibt die sozialen und räumlichen Bedingungen der Bauhäusler in Weimar und verdeutlicht die Notwendigkeit einer Kantine als Ort des Zusammenkommens und der sozialen Interaktion. Es wird auf die Wohnverhältnisse der Studenten eingegangen, die oft prekär und armselig waren, und wie die Kantine diese Situation zumindest partiell verbesserte, indem sie einen Ort der Gemeinschaft und Wärme bot. Die Bedeutung der Kantine als integrativer Bestandteil des Bauhaus-Lebens wird hier besonders hervorgehoben.
Himbeeren und Rhabarber auf dem Grundstück „Am Horn“: Dieser Abschnitt beleuchtet die Eigenversorgung der Kantine mit Nahrungsmitteln, die einen wichtigen Aspekt ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit darstellte. Der Bezug zu den ökologischen und lebensreformerischen Ideen des Bauhauses wird erörtert. Die Darstellung des Anbaus von Obst und Gemüse auf dem Gelände illustriert die Bemühungen um eine nachhaltige und gesunde Ernährung der Studenten. Die Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Selbstversorgung, Ideologie und dem Streben nach Autonomie.
Napoleonisches Tafelsilber für einen Zentner Kartoffeln: Dieses Kapitel beschreibt die kreative Problemlösung im Umgang mit Ressourcenknappheit. Die Verwendung von improvisierten Mitteln und Gegenständen im Kontext der Kantine symbolisiert den pragmatischen Umgang mit den finanziellen Einschränkungen. Der Titel ist ein Beispiel dafür, wie der Mangel durch Einfallsreichtum und die Verknüpfung scheinbar unvereinbarer Elemente gemeistert wurde. Es wird der kreative Umgang mit den Ressourcen analysiert und der Bezug zur Gesamtkonzeption des Bauhauses hergestellt.
Die Kantine als soziales Herzstück des Bauhauses: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung der Kantine als Begegnungsstätte und ihr Beitrag zur Gemeinschaft im Bauhaus. Die Rolle der Küchenkommission und Meister Muches werden beleuchtet. Es wird gezeigt, wie die Kantine über ihre reine Versorgungsfunktion hinaus eine zentrale Rolle im sozialen und kulturellen Leben der Bauhaus-Gemeinschaft spielte. Die Analyse fokussiert sich auf die soziale Dynamik innerhalb der Kantine und ihre Bedeutung für den Gesamtzusammenhang des Bauhauses.
Ausblick in die Dessauer Zeit: (Anmerkung: Da der Text keine konkreten Informationen über die Dessauer Zeit enthält, kann diese Zusammenfassung nur spekulativ sein und muss ausgelassen werden).
Schlüsselwörter
Bauhaus, Weimar, Kantine, Mangel, Ernährung, Mazdaznan, Walter Gropius, soziale Bedingungen, wirtschaftliche Autonomie, Lebensreform, „Neuer Mensch“, Finanzierung, Stiftung, Pochwadt
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: "Mangel, Mut und Mazdaznan – Die Bauhaus-Kantine in Weimar"
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar und beleuchtet deren Bedeutung als soziales und wirtschaftliches Zentrum des Bauhauses in einer Zeit der Knappheit und des gesellschaftlichen Umbruchs. Er konzentriert sich auf die Herausforderungen bei der Gründung und den Einfluss des Mazdaznan-Kults auf die Ernährung der Bauhäusler.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Bauhaus-Gründung, die Rolle der Kantine als soziales Herzstück, den Einfluss des Mazdaznan-Kults, die Finanzierung der Kantine, die Bemühungen um wirtschaftliche Autonomie, die Bedeutung der Kantine für das künstlerische Schaffen und die Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: "Mangel, Mut und Mazdaznan – Die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar", "Das „Wohnzimmer“ der Bauhäusler", "Himbeeren und Rhabarber auf dem Grundstück „Am Horn“", "Napoleonisches Tafelsilber für einen Zentner Kartoffeln", "Die Kantine als soziales Herzstück des Bauhauses" (inklusive Unterkapitel "Die Küchenkommission" und "Meister Muche als Herr über Töpfe und Pfannen") und "Ausblick in die Dessauer Zeit" (der Ausblick ist aufgrund fehlender Informationen spekulativ).
Welche Herausforderungen gab es bei der Gründung der Bauhaus-Kantine?
Die Gründung der Kantine war durch die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeit und die finanzielle Benachteiligung der Studenten stark herausgefordert. Der Text beschreibt die Notwendigkeit von Improvisation und kreativen Lösungen zur Bewältigung der Ressourcenknappheit.
Welche Rolle spielte der Mazdaznan-Kult?
Der Mazdaznan-Kult hatte Einfluss auf die Ernährungsweise der Bauhäusler in der Kantine. Der Text beleuchtet diesen Einfluss, jedoch ohne detaillierte Angaben zur konkreten Ausprägung.
Wie war die Kantine finanziert?
Der Text beschreibt die Bemühungen um wirtschaftliche Autonomie der Kantine, inklusive der Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln durch Anbau auf dem Gelände. Die detaillierte Finanzierungsstruktur wird jedoch nicht explizit dargelegt.
Welche Bedeutung hatte die Kantine für die Bauhaus-Gemeinschaft?
Die Kantine fungierte nicht nur als Essensversorgung, sondern diente als soziales Herzstück und Begegnungsstätte, förderte die Gemeinschaft und trug zum kulturellen Leben der Bauhaus-Gemeinschaft bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Bauhaus, Weimar, Kantine, Mangel, Ernährung, Mazdaznan, Walter Gropius, soziale Bedingungen, wirtschaftliche Autonomie, Lebensreform, „Neuer Mensch“, Finanzierung, Stiftung, Pochwadt.
Wie wird die Dessauer Zeit behandelt?
Der Text enthält keine konkreten Informationen zur Dessauer Zeit und der Ausblick in dieses Kapitel ist daher spekulativ und unvollständig.
- Quote paper
- Julia C. Eydt (Author), 2021, Mangel, Mut und Mazdaznan. Die Anfänge der Bauhaus-Kantine in Weimar, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1015032