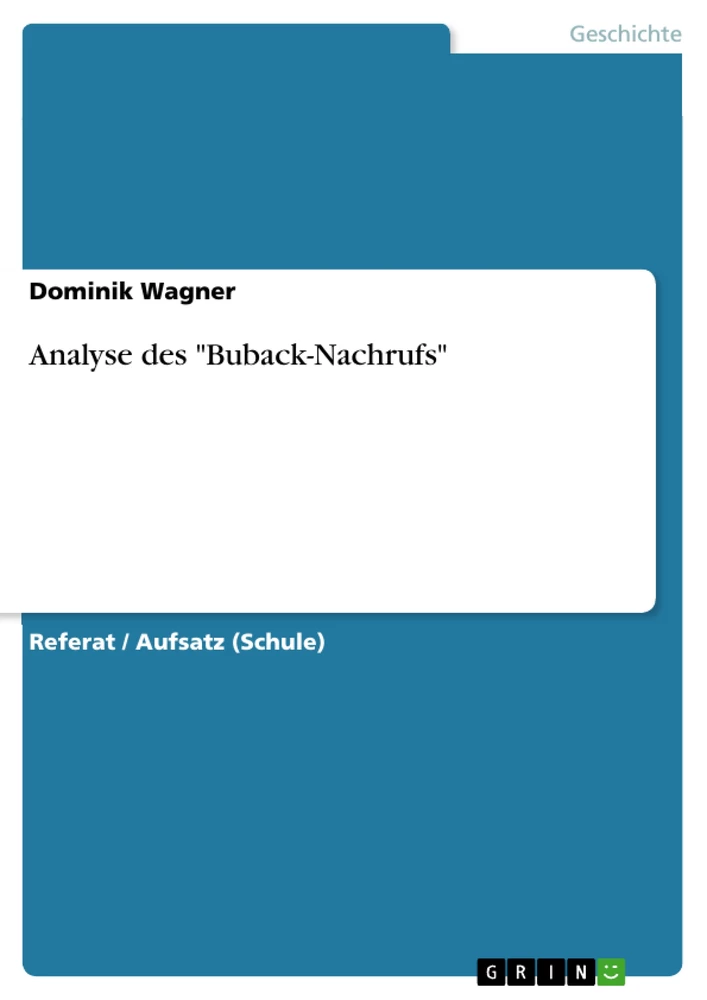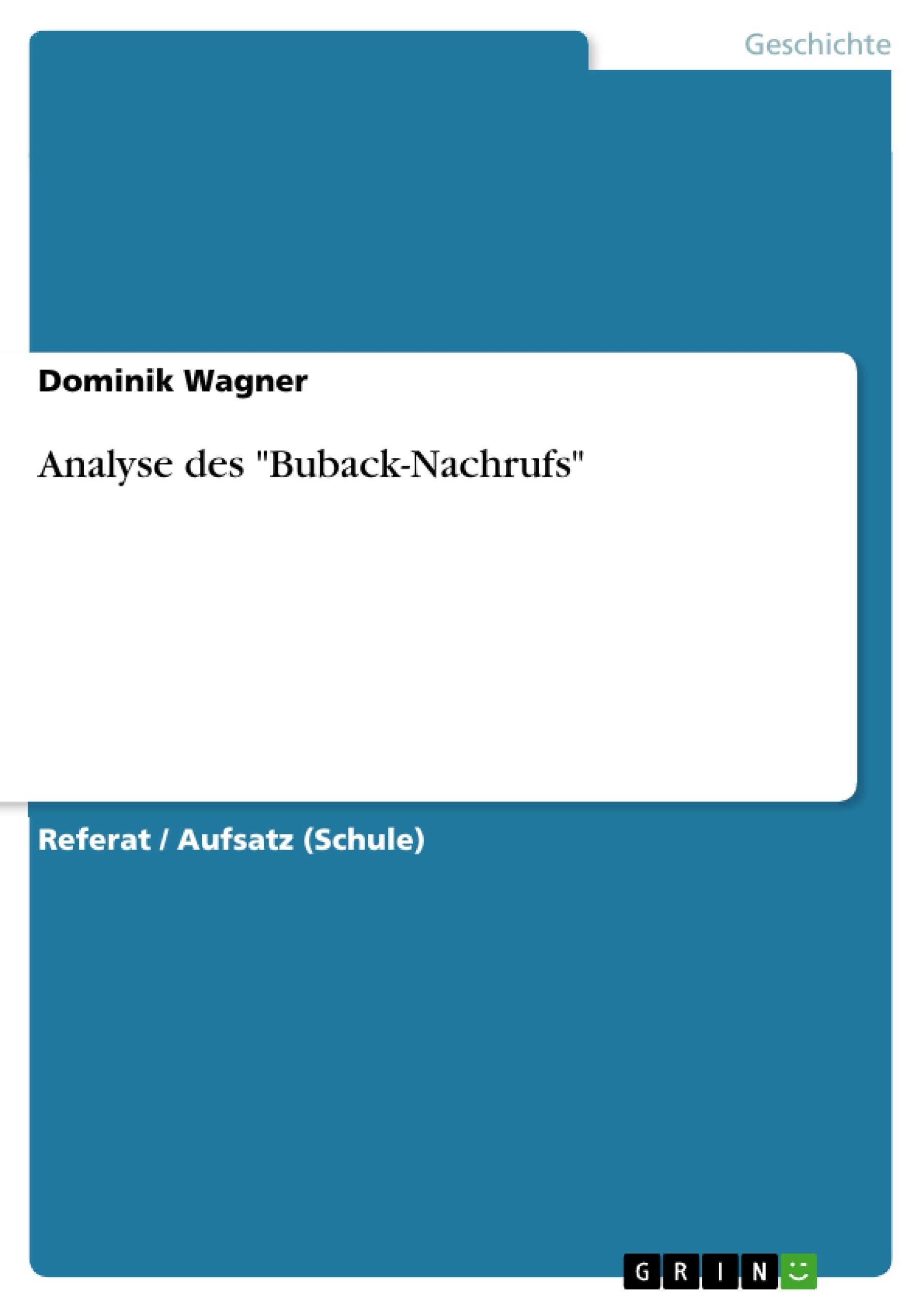Hausarbeit
Von Dominik Wagner
Buback - Ein Nachruf
Eine Analyse in Hinsicht auf die Klärung des Inhalts, der wichtigsten Aussagen, der historischen Bedingungen und schließlich der Intention des Autors
Der Autor des Nachrufs, selbstbezeichnend als „Ein Göttinger Mescalero“, verstößt schon im ersten Abschnitt (Z. 1-5) seines Briefes gegen „damalige“, „bürgerliche“ Normen, indem er nicht argumentativ vorgehen will „Ausgewogenheit, stringente Argumentation, Dialektik und Widerspruch - das ist mir alles piep-egal.“ (Z. 2-3) und indem er sich bei diesem, normalerweise ernsten und seriösen Thema im Stil vergreift „piep-egal (...) Rülpser“ (Z. 3-4).
Im folgenden liefert der Göttinger Student eine Erklärung dafür, wie der Mord am General- Bundesanwalt Siegfried Buback (+ 7.4.1977) aus seiner Sicht zu rechtfertigen ist. Der „Mescalero“ gibt dem Text eine bestimmte Richtung indem er sagt, dass er eine „klammheimliche Freude“ nicht verhehlen will und kann (Z. 7), es ist aber offenbar noch kein Fazit, da der Text in seinem Verlauf zu einer Reduktion, von den Terroristen ausgehenden Gewalt aufrufen wird.
Zuerst wird der Ermordete aber als „Hetzer“ bezeichnet, der bei der Verfolgung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine herausragende Rolle gespielt haben soll (Z. 7-8). Damit meint der Autor offenbar die schwierigen Verhältnisse der gefangenen Terroristen Baader, Meins, Raspe, Ensslin, Meinhof und anderer, die damals in Stammheim inhaftiert waren. Die Bundesregierung verhängte 1977 nämlich eine Informationssperre gegenüber der Presse, zugleich wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Gefangenen von der Aussenwelt isolierte, sie durften weder Zeitungen, noch Fernsehen, noch Radio und besonders keine Besuche von Anwälten oder anderen Personen erhalten.
Zuvor ist Holger Meins an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben (+14.11.1974). Die Bundesanwaltschaft, damit auch Buback, wollte ihre Zusagen nicht einhalten. Einige Terroristen, wie Petra Schelm, wurden auf der Flucht erschossen, in jener Zeit des „Deutschen Herbstes“ wurden viele Linke als potentielle Terroristen angesehen. Die Anspielung auf eine Revolution (Z. 13) und deren Folgen zeigt die Ziele der Linken von damals: So wollte man nach einer Umwälzung der staatlichen Prinzipien, die Vertreter der „alten Welt“ in Schauprozessen vorführen und über sie urteilen, einer von ihnen sollte Buback sein „(...) der meistgesuchten und meistgehaßten Vertretern (...) zur öffentlichen Vernehmung vorzuführen.“ (Z. 13-14).
Bei der Darstellung seiner persönlichen Reflexionen sagt der Verfasser darüber noch hinaus, dass er mit der einheitlichen Meinung der Gesellschaft in Bezug auf die Ermordung Bubacks nicht einverstanden ist. Damit greift er die deutschen Medienmacher an, denn seiner Meinung nach haben Presse und Funk die „öffentliche Empörung und Hysterie“, die nach Bubacks und im besonderen nach Hans-Martin Schleyers Ermordung (+ 19.10.1977) geherrscht hat, lediglich inszeniert. So seien die Medien ein „hermetisch wirkender, gleichgeschalteter Block“ (Z. 22) der nicht fähig zur kritischen Stimme sei und damit ein Handlanger der „falschen Politik“. Er geht noch weiter indem sie durch den Ausdruck „politische Eunuchen“ (Z. 20) entmündigt.
Tatsächlich waren den Medien, durch die von der Bundesregierung verhängte Informationssperre, die Hände gebunden. Eine Gleichschaltung der Medien sollte den Terroristen mögliche Informationen entziehen und die härtere, manchmal illegale Vorgehensweise des Krisenstabes um Bundeskanzler Schmidt, Bundesinnenminister Maihofer, Justizminister Vogel, Aussenminister Genscher etc. verdecken. So spricht der Autor von der Wanzenaffäre, die gezeigt haben soll, dass der Staat sich in Bezug auf die inhaftierten Terroristen nicht gesetzestreu verhalten haben soll: „(...) die Bubacks, Maihofers, Schiess und Benda die dicksten Rechtsbrüche begehen (...)“ (Z. 28-29).
Mit dem Ausdruck „Terroristenbrut“ (Z. 30) deutet der Göttinger Student an, dass der Staat den Feind in der linken Studentenbewegung sehe und gegen diesen nach dem Anschlag auf Buback noch härter vorgehen wird. Da der Staat hier aber pauschalisiere, indem er die Terroristen dem Studenten-Milieu zuordnet, wird er offenbar weitere Rechtsbrüche in Kauf nehmen müssen, um gegen diese Gruppe vorzugehen. Deswegen löst auch der Mord an Buback, einem Staatsdiener, die „klammheimliche Freude“ aus: „ Jetzt nach dem Anschlag ist nicht nur wieder jedes Mittel recht, um die „Terroristenbrut“ zu zerschlagen, sondern die angewandten Mittel sind gar zu gering.“ (Z. 29-31).
So hat der Staatsanwalt („die Bubacks“) bei dem Verfahren Roth/Otto die Verurteilten absichtlich in falscher Anbetracht der Tatsachen des Mordes an einem Polizisten verklagt (Z. 32-35). In dieser Zeit, so der Autor, ging es nach dem Prinzip, dass alle Linken potentielle Mörder sind: „Revolutionäre Linke sind Killer, ihre Gesinnung, ihre Praxis prädestiniert sie zu Killern, die vor keinem Mittel zurückschrecken, so die Gleichung der Ankläger und (offensichtlich) der Richter.“ (Z. 35-36).
Trotzdem ist es Personen, die er als „Genossen und Genossinnen“ bezeichnet, gelungen gegen diesen „Apparat“ anzukämpfen und die gleichgeschalteten Medien auf die erschwerten Haftbedingungen der Terroristen aufmerksam zu machen. Die Anwälte von Otto und Roth haben daraufhin Antrag auf Haftentlassung gestellt. Nach dem Anschlag auf Buback sind die Chancen auf eine Haftentlassung aber gesunken, weil die Terroristen ihren inhaftierten Genossen den Weg „verbaut“ haben (Z. 37-45).
Genau an dieser Stelle des Briefes fängt der Autor an, die Gewalttaten der RAF zu kritisieren. So habe der Gebrauch sinnloser Gewalt der Linken nur zu Folge, dass die Haftbedingungen der eigenen Genossen sich verschlechtern und dass mögliche Nachteile in der Rechtsprechung entstehen. Eine Fokussierung auf die Entwicklung der Gefangenen in Stammheim und die Forderung ihrer Freilassung durch Gewalt („Landshut-Entführung“, „Hans-Martin SchleyerEntführung“) und die mangelhafte Beschäftigung mit der politischen Weiterentwicklung in Deutschland führen demnach zur Gegengewalt und zum Gegenaufstand auf staatlicher Seite: „ ‚Counterinsurgency‘ andersherum“ (Z. 48).
Allein diese Gewißheit zerstört, oder besser: hemmt, beim Autor die „klammheimliche Freude“, denn er kommt zu dem Zwischenresultat: „Diese Überlegungen alleine haben ausgereicht, ein inneres Händereiben zu stoppen.“ (Z. 50). Obwohl der Göttinger Student Aktionen bewaffneter Kämpfer einst als gut empfunden hat, distanziert er sich von jeglichen aktiven Teilnahmen. Damit rückt er sein Bild in ein helleres Licht, weil er, obwohl der Verfasser des Nachrufs, sich dem pazifistischen Lager der Linken unterordnet. Trotzdem wird in diesem Teil des Briefes deutlich, dass der Autor die Motive und Überlegungen zur Rechtfertigung der Gewalttaten verlässt und diese mit der Sehnsucht nach „Action“ und Abenteuer zu erklären versucht: „Ich habe mich schon bißchen dran aufgegeilt, wenn mal wieder was hochging und die ganze kapitalistische Schickeria samt ihren Schergen in Aufruhr versetzt war. Sachen, die ich im Tagtraum auch mal gern tun tät, aber wo ich mich nicht getraut habe sie zu tun.“ (Z. 52-55)
Hiermit zielt der Autor auf die Probleme in der damaligen Gesellschaft ab. So soll diese, der Meinung der Linken nach, ziemlich „bürgerlich“, „streng genormt“ und „spießig“ gewesen sein. Außerdem hat vor der Studentenrevolution der 68er nie zuvor eine sinnvolle Aufarbeitung der NS-Zeit stattgefunden, so dass man alles vor sich hergeschoben und zu verdecken versucht hat. Deshalb kam den Studenten damaliger Zeiten jede Aufruhe, die zum Aufrütteln des alten „Muffs“ beitragen konnte gerade recht. Man hat sich in Deutschland nach dem 2.Weltkrieg nämlich darauf eingestellt, ein wohlhabendes Leben zu führen mit möglichst wenigen Erinnerungen an das Dritte Reich über die „Runden zu kommen“. Das kommentierte der damalige Justizminister Hans-Jochen Vogel auch passend im Bundestag, allerdings nach dem Mord an Hans-Martin Schleyer, der die Gesellschaft der Bundesrepublik verändert hatte: „Meine Damen und Herren, es ist noch etwas in Gang gekommen: ein neues Verständnis unseres Staates. Die Menschen haben in diesen Tagen und Wochen gespürt, daß der Staat mehr sein muß als eine Schönwettervereinigung zur Wohlstandsmehrung.“ Der Autor erklärt im weiteren Verlauf (Z. 56-63), dass ein Leben als Terrorist für ihn nicht in Frage komme. So fordere dieses eine Abkoppelung aus dem öffentlichen Leben, die Gefahr getötet zu werden sei sehr hoch. Ebenso sei auch die Gefahr, dass dritte, unbeteiligte Personen sich in Gegenwart von Terroristen nicht in Sicherheit befinden, sehr hoch. Diese Überlegung (Z. 61-63) initiiert, dass der Autor keine egoistische Denkstruktur aufweist und sich damit indirekt zum Pazifismus bekennt. Seine anti-radikale Haltung wird auch darin deutlich, dass er sich nicht vorstellen könnte so zu handeln, wie es der vermeintliche Feind (der Staat) tut. So sind seiner Meinung nach Richter, Polizisten, Werkschützen, Soldaten und Betreiber von Atomkraftwerken kaltblütig wie einst Mafiabosse, schnell, brutal und berechnend im Töten (Z. 64-66). Damit zielt er auf den Staatsapparat ab, der es sich vorgenommen hat, gegen die Linken von damals mit Gewalt vorzugehen. Die AKW-Betreiber werden als Feindbilder angesehen, weil es damals unter vielen Studenten eine Öko-Bewegung gab. Später sollte aus dieser die Gründung der Grünen resultieren. So war das Betreiben von Atomkraftwerken staatlich monopolisiert, was bedeutete, daß der Staat durch die krebserregenden Mineralien bei der Stromerzeugung gegen seine eigenen Bürger handelte. Deswegen wurden AKW- Betreiber gleichgesetzt mit Richtern, die in manchen Ländern (nicht in Deutschland) über Leben und Tod urteilen, mit Polizisten, Soldaten und Werkschützen, die zum potentiellen Töten vom Staat aufgestellt werden.
All diese Personen bilden eine Einheit, nämlich den Feind. Daher ist auch Buback, laut Autor, nur ein Individuum des „falschen“ Staates gewesen, es hätte auch jede andere Person treffen können, die den Staat unterstützt hat und damit gegen die Ideale der RAF gearbeitet hat (Z. 67-73).
Dabei zweifelt der Autor auch am Demokratieverständnis der damaligen „aufrechten Demokraten“ (Z. 72). So hinterfragt er dieses mit einer rhetorischen Frage, indem er wissen möchte, ob diese Art von Hysterie auch entstanden wäre, wenn die RAF, anstatt Buback, nur eine Köchin ermordet hätte: „Warum diese Politik der Persönlichkeiten?“ (Z. 71). Mit der sinnlos klingenden Frage „Sollten wir uns nicht überhaupt auf die Köchinnen konzentrieren?“ (Z. 73) spielt er diese Hysterie um die Ermordung Bubacks herunter und gibt zu verstehen, dass es für ihn wohl wichtigeres im Leben gibt.
Im folgenden aber, entzieht der Göttinger Student den Terroristen die Legitimierung für den Mord an Buback. So zieht er Beispiele aus Militärregimen (Argentinien und Spanien) zur Hilfe, in denen Staatsmänner ermordet werden, die vom Volk allgemein gehasst werden. Dies war bei Buback aber nicht der Fall. An diesem Punkt gerät der Autor in eine moralische Zwickmühle: So kann er den Mord an Buback einerseits nicht gutheißen, weil er vom Volk nicht gehasst worden ist, wie einige Diktatoren in Südamerika, andererseits liefert er eine Form von Legitimierung für Morde an Personen in demokratischen Ländern. So reicht es einfach aus, dass diese vom Volk gehasst werden um sie zu ermorden. Hass ist aber ein sehr subjektives Gefühl, das schlecht messbar ist. Somit liefert er eine dubiose Erklärung für die Legitimierung eines Mordes an einer Person. Hier drin liegt wohl auch einer der Gründe der damaligen Bundesregierung, diesen Nachruf zu verbieten.
Da Buback nicht vom Volk gehasst worden ist, durfte sich auch die RAF nicht herausnehmen, für das Volk stellvertretend zu handeln, so die Schlußfolgerung.
Schließlich geht die Meinung des Autors gegen Ende seines Nachrufes völlig ins Gewaltlose über: Er fordert die Linken dazu auf, gewaltfrei zu handeln, weil Gewalt das Mittel der Herrschenden ist. Viel wichtiger sei es eine Gesellschaft zu schaffen, in der das Volk glücklich Leben kann, da es vor Gewalt ja nur Angst hat. Das kennen die Menschen ja noch aus vergangenen Zeiten des NS-Regimes: „(...) sie haben ihre Erfahrungen damit gemacht, genauso wie mit Einkerkerung und Arbeitslager.“ (Z. 85)
Genauso sollen die Feinde nicht liquidiert werden, trotzdem soll mit ihnen nicht „sanft“ umgegangen werden. Damit beruft sich der Autor wieder auf Gewaltminderung (Z. 86-87). Der Wunsch einer sozialistischen Welt wird erwähnt, die eine bessere Gesellschaft hervorbringen soll, welche ohne Terror und Gewalt, ohne Zwangsarbeit, ohne Justiz, „Knast“ und Anstalten auskommen wird.
Diese Darstellung stellt das Ziel vieler damaliger Terroristen dar, der Autor erkennt aber, dass diese Welt nicht das Paradies sein wird. Er fügt nämlich noch in Klammern hinzu, dass die „Wunschgesellschaft“ nicht ohne Aggression und Militanz, nicht ohne „Plackerei“, nicht ohne Regeln und Vorschriften auskommen wird (Z. 88-92).
Dies lässt sein Ziel realistischer wirken und nicht wie viele Versprechungen in der Geschichte, die nicht eingehalten worden sind (Versprechungen vor der Oktoberrevolution 1917 in Rußland, die später nicht eingehalten worden sind z.B.).
Zukünftige Revolutionäre sollten also nicht zum Mittel der militärischen Waffen greifen, sondern sich auf die eigenen Fähigkeiten beschränken: Das Volk soll aufgeklärt werden und die Linken sollen so handeln, dass nicht sie zu den Gehassten werden: „Einen Begriff und eine Praxis zu entfalten von Gewalt/Militanz, die fröhlich sind und den Segen der beteiligten Massen haben, das ist (zum praktischen Ende gewendet) unsere Tagesaufgabe.“ (Z. 98-100). Nachdem sich der Autor diplomatisch der sachlichen Argumentation genähert hatte, greift er gegen Ende des Nachrufes auf seine provozierenden Stilmittel aus dem Anfangsteil. So bezeichnet er Staatsdiener als „Bubacks mit Killervisagen“ (Z. 100-101), beendet seinen Text mit den unformalen Schlußworten „Ein bißchen klobig, wie? Aber ehrlich gemeint...“ und bezeichnet sich selbst schließlich als einen „Göttinger Mescalero“, was doch etwas an Karl- May-Romantik erinnert.
Damit zeigt er dem Staat gegenüber seine vollkommene Respektlosigkeit und erschüttert mit dem gesamten Nachruf die Trauer der Freunde und Angehörigen Bubacks.
Stellungnahme aus heutiger Sicht
Aus heutiger Sicht ist es mir unerklärlich, warum eine Veröffentlichung des Nachrufs verboten worden ist. Schließlich wird laut Grundgesetz, Art.5 die Meinungsfreiheit gewährleistet und es gehört zu den demokratischen Grundprinzipien die Menschenrechte zu achten. Zwar ist der Text an sich anstößig, weil er politischen Mord normalisiert, indem er argumentativ belegt, dass ein Repräsentant des Staates nur vom Volk gehasst werden muß, um ihn umzubringen, doch fordert der Text auch die generelle Aufgabe des Terrorismus und damit Gewaltvermeidung oder Gewaltverzicht. Auch wenn man die positiven Faktoren des Textes mit den negativen Faktoren nicht aufwiegen kann, halte ich ein Verbot des Textes für übertrieben. Genauso sehe ich eine gekürzte Herausgabe des Nachrufs mit Argwohn, weil das die Intention des Autors verfälscht und nebenbei seine Autorenrechte, das „Copyright“ verletzt. Viel wünschenswerter wäre es den ganzen Text zur Diskussion freizugeben, um jegliche moralischen und ethischen Unklarheiten, die zwischen Autor und Gesellschaft auftauchen, zu klären.
Seit der Zeit dieses Nachrufs von 1977 hat sich die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland meiner Meinung nach verändert, indem sie mehr demokratische und liberale Prinzipien adaptiert hat. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass ein Nachruf dieser Art heutzutage dennoch zensiert werden würde. Zwar herrscht in heutigen Tagen kein Terror aus dem linken Lager, dennoch häuften sich in letzter Zeit Gewalttaten, die durch Rechtsradikale verursacht worden sind. Ein anstößiger Nachruf von Neonazis würde die heutige Gesellschaft auch empören, weil das Thema zur Zeit aktuell ist und Deutschland darüber hinaus noch historisch vorbelastet ist. Vergleichbar mit damals, ist heute die gleiche Einstellung der Medien zu verzeichnen: Man berichtet über Rechtsradikale als Masse und analysiert selten die Individuen. Die Medien der 68er haben auch pauschalisiert, was ja der Göttinger Mescalero verurteilt hat. Gäbe es in der Gesellschaft aber keine einheitliche Meinung gegenüber radikalen Gruppierungen, so bestünde die Gefahr der Sympathisierung oder der Ignoranz. Deswegen müssen die Medien mit der Politik zusammenarbeiten, um gegen Radikale jeglicher Art vorzugehen, die die Menschenrechte verletzen und die Verfassung der BRD stürzen wollen.
Historisch gesehen ist der Buback-Nachruf von hoher Brisanz, da er in der damaligen Gesellschaft viel Empörung hervorrief, politisch gesehen ist er heute nicht mehr wichtig, weil es keine linke Radikalität mehr gibt. Der Nachruf verfolgt heute zwar noch einige Politiker der Bundesregierung (Trittin), hat aber für die innenpolitische Sicherheit keine Bedeutung mehr.
Juristisch gesehen hatte der „Deutsche Herbst“ u.a. folgende Folgen: Es wurden Sondergesetze eingeführt, auf die man sich in Ausnahmesituationen heute noch berufen kann. So z.B. das Kontaktsperregesetz, die obligatorische Kontrolle der Verteidigerpost, Durchführung von Jedermannkontrollen bei Fahndungen sowie das Gesetz zum „Lauschangriff“.
Zusammentragend kann gesagt werden, dass der Buback-Nachruf die damalige Gesellschaft in einer schwierigen Situation empfindlich getroffen hat. Um sich einer strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen, wählt der Autor einen Pseudonym. Dies spiegelt wohl die damalige Anspannung wider: So konnte man wegen der Schilderung seiner eigenen Meinung, die zugegebener Weise in diesem Fall sehr anstößig war, belangt werden. Der Verfasser entschloß erst am 24. Januar 2001 sich als Klaus Hülbrock zu outen, was wohl erst durch die Aufarbeitung der 68er in Bezug auf Joschka Fischers Vergangenheit möglich gemacht worden ist.
Auch wenn die Zeit von damals heute in der deutschen Politik nicht direkt zu spüren ist, steckt sie wohl immer noch in den Köpfen einiger Leute.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Hausarbeit "Buback - Ein Nachruf"?
Die Hausarbeit analysiert den Nachruf auf Siegfried Buback, den ehemaligen Generalbundesanwalt, aus der Feder eines selbsternannten "Göttinger Mescaleros". Sie untersucht den Inhalt des Nachrufs, seine wichtigsten Aussagen, die historischen Bedingungen, unter denen er entstanden ist, und die Intention des Autors.
Was kritisiert der Autor des Nachrufs?
Der Autor kritisiert die gesellschaftliche Normen und die Medienlandschaft der damaligen Zeit. Er bemängelt die Informationssperre und die vermeintliche Gleichschaltung der Medien, die seiner Meinung nach die öffentliche Empörung und Hysterie nach Bubacks Ermordung inszeniert haben. Er kritisiert auch die harte Vorgehensweise des Staates gegen die linke Studentenbewegung.
Welche Rolle spielt die RAF in der Analyse?
Die RAF (Rote Armee Fraktion) ist zentraler Bestandteil der Analyse. Der Autor reflektiert über die Rechtfertigung des Mordes an Buback aus Sicht der RAF, kritisiert aber später die Gewaltanwendung der Terroristen. Er argumentiert, dass die Gewalt der RAF zu einer Verschlechterung der Haftbedingungen der inhaftierten Genossen geführt habe und dem Anliegen der Linken geschadet habe.
Wie steht der Autor zur Gewalt und zum Terrorismus?
Der Autor zeigt zunächst eine "klammheimliche Freude" über den Mord an Buback, distanziert sich aber im Laufe des Textes von Gewalt und Terrorismus. Er fordert eine gewaltfreie Lösung der gesellschaftlichen Probleme und eine Abkehr von der militärischen Auseinandersetzung.
Was ist die "Stellungnahme aus heutiger Sicht"?
In seiner abschließenden Stellungnahme äußert der Autor, dass er ein Verbot des Nachrufs für übertrieben hält, da dieser zwar politischen Mord normalisiere, aber auch zur Gewaltvermeidung aufrufe. Er argumentiert für eine offene Diskussion des Textes, um moralische und ethische Unklarheiten zu klären.
Welche historischen Bedingungen werden im Nachruf behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet die historischen Bedingungen des "Deutschen Herbstes", die schwierigen Haftbedingungen der in Stammheim inhaftierten Terroristen, die Wanzenaffäre und die gesellschaftliche Stimmung nach der Studentenrevolution der 68er.
Wie bewertet der Autor die Demokratie der damaligen Zeit?
Der Autor zweifelt am Demokratieverständnis der damaligen Zeit und hinterfragt, ob die gleiche Hysterie entstanden wäre, wenn die RAF anstatt Buback nur eine Köchin ermordet hätte.
Was fordert der Autor von zukünftigen Revolutionären?
Der Autor fordert von zukünftigen Revolutionären, dass sie nicht zum Mittel der militärischen Waffen greifen, sondern sich auf die Aufklärung des Volkes konzentrieren und so handeln, dass sie nicht zu den Gehassten werden.
- Quote paper
- Dominik Wagner (Author), 2001, Analyse des "Buback-Nachrufs", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101467