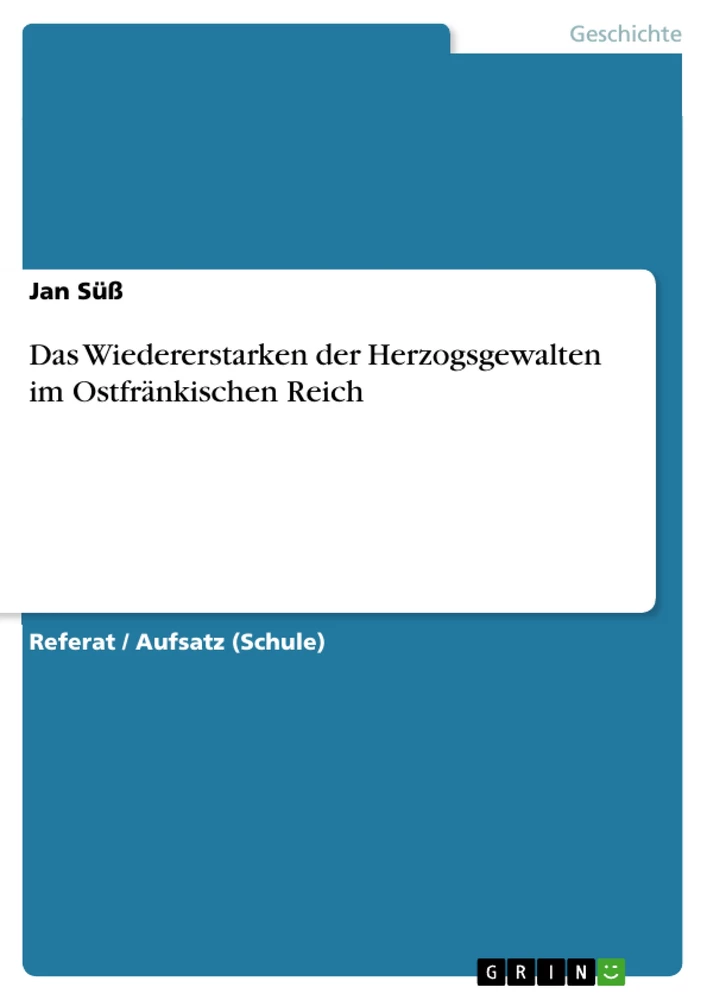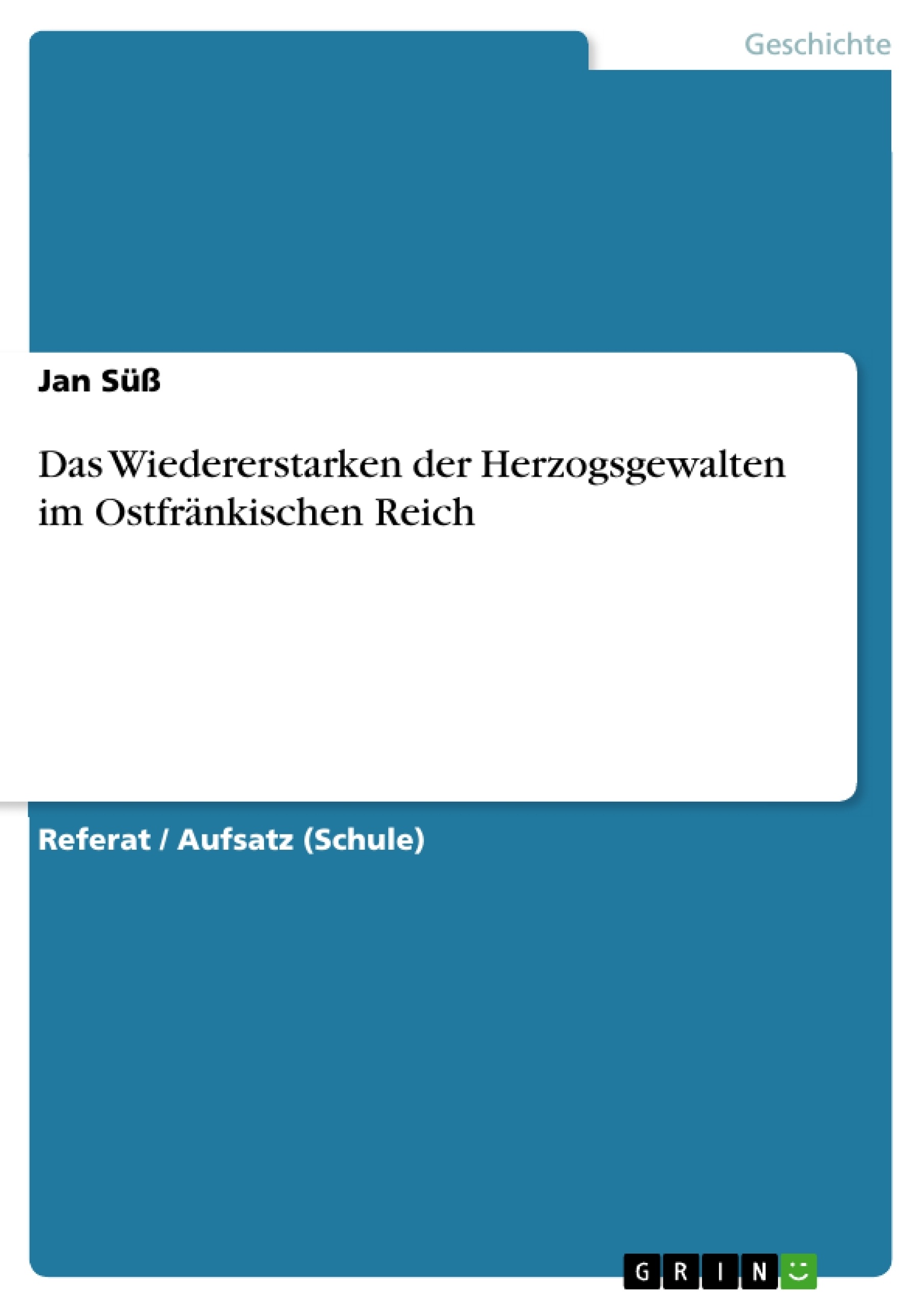DAS WIEDERSTARKEN DER HERZOGSGEWALTEN IM OSTFRÄNKISCHEN REICH
Im beginnenden 10. Jahrhundert trat das Ostfränkische Reich in einen Prozeß der prinzipiellen inneren Umgestaltung, in dem sich die zentralistischen Strukturen des fränkisch-karolingischen Herrschaftsaufbaus nach und nach zerrieben. So traten nach dem Tod Kaiser Arnulfs und besonders während der elfjährigen Regierungszeit seines unmündigen Sohnes Ludwig dem Kind, dem letzten ostfränkischen Karolinger, die Gegensätze zwischen kaiserlichem Einheitsstaat und der zunehmenden Emanzipation des Stammesadels offen zu Tage. Denn begünstigt durch die jährlichen Einfälle der Ungarn und Normannen entwickelte sich aus den in der Abwehr alleingelassenen Regionalgewalten ein zunächst geduldetes, aber zunehmend unentbehrlich werdendes Mittelgewicht zwischen dem König (bzw. dessen Regentschaftsrat) und seinem gräflichen Verwaltungsapparat, welcher - durch einzelne Erfolge in der Bekämpfung äußerer Feinde selbstbewußt geworden - nach Anerkennung seiner gesteigerten Macht strebte, die sich in der Ausübung herzoglicher Gewalt manifestieren sollte.
So formte sich schon unter den späten Karolingern in Sachsen ein neues Stammesherzogtum , nachdem der ostfränkische König Ludwig III. der Jüngere Liutgard, eine Tochter Liudolfs aus dem Geschlecht Widukinds, zur Frau nahm und danach seinem Schwiegervater freie Hand in Ostsachsen gab. Nach dem Tod Liudolfs 866 trat dessen Sohn Brun das sächsische Erbe an, fiel aber im Kampf gegen die Normanen in der Schlacht bei Ebbekesdorp am 02.02.880, in deren Ergebnis die dänische Mark verlorenging. An Bruns Stelle trat nun sein Bruder, Otto der Erlauchte.
Weniger geradlinig als in Sachsen lief die Entwicklung in anderen Teilen des Reiches ab. Denn nicht überall war die Hierarchiesierung innerhalb der führenden Adelsgruppen soweit fortgeschritten. Ein selbstzerstörerischer Machtkampf des miteinander rivalisierenden Stammesadels war die Folge, für den die 897 im ostfränkischen Raum ausbrechende Babenberger Fehde beispielgebend war. In dieser kam die ganze Ohnmacht königlichen Machtanspruches zum Ausdruck, dem es nicht gelang, die Familien der Konradiner und Babenberger zu hindern, sich „ mit dem Adel ihres Blutes, mit der großen Anzahl ihrer Verwandten und der Gr öß e ihrer irdischen Machtüber Gebühr zu brüsten ” und „ in gegenseitigen Metzeleienübereinander herzufallen ”, wobei „ unzählige auf beiden Seiten durch das Schwert zugrundegingen, Verstümmelungen an Händen und F üß en verübt, ganze Landschaften durch Raub und Brand zugrundegerichtet ” wurden (Regino von Prüm).
Während sich die Babenberger unter den Königen Ludwig dem Jüngeren und Karl III. im Kampf gegen die Normanen auszeichneten, gelang es den Konradinern während König Arnulf’s Herrschaft über dessen Gemahlin Oda, eine Konradinerin, ihre Positionen auszubauen. Arnulfs Tod sollte dann auch zum Auslöser der Fehde werden, die 902 den Babenberger Grafen Heinrich II. das Leben kostete, während sein Bruder Adalhard in Gefangenschaft geriet. Der im gleichen Kampf verwundete Konradiner Eberhard erlag wenig später seinen Wunden, womit Adalhards Enthauptung gerechtfertigt wurde. Den Besitz der babenberger Brüder übertrug eine Versammlung der ostfränkischen Stämme König Ludwig dem Kind, der ihn an den Konradiner Bischof Rudolf von Würzburg weitergab. Vier Jahre später traten sich beide Familien erneut entgegen. Der Tod Konrads des Älteren - Vater des späteren Königs Konrad - schien die Lage zugunsten der Babenberger zu ändern, doch die betrügerische Gefangennahme des letzten überlebenden Babenberger Grafenbuders Adalbert und dessen durch Adelsgericht angeordente Hinrichtung am 09.09.906 entschied den Kampf zugunsten der Konradiner, die nun in Ostfranken unter Konrads gleinamigem Sohn und in Lothringen unter Gebhard, dessen Onkel, die Vormachtstellung innehatten. Aber Gebhard fiel 910 am Lech im Kampf gegen die Ungarn und die unterdrückten lothringischen Adelsgruppen, allen voran die Reginare und Matfriedinger, nutzen die Möglichkeit und boten Lothringen dem westfränkischen Karolinger Karl dem Einfältigen an, der am 01.11.911 die Herrschaft antrat.
Die Abspaltung Lothringens war aber nicht nur bezeichnend für die offensichtliche Schwäche des Königtums, sondern stellte nach Ludwigs Tod das Reich vor die Gefahr des Zerfalls in die vier Hauptstämme. Um diesen zu verhindern, einigten sie die führenden Vertreter Sachsens, Frankens, Baierns und Schwabens zwischen dem 07. und 10.11.911 in Forchheim auf Konrad als zukünftigen König.
Mit diesem Schritt bewahrte der ostfränkische Adel aber nicht nur die Einheit des Reiches, vielmehr brachte er sein gewachsenes Selbstbewußtsein zum Ausdruck, denn während der lothringische Adel mit der Erhebung Karls des Einfältigen dem Geblütsrecht der Karolinger folgte, trug Konrads Wahl - ähnlich wie in Burgund und Italien, die sich den regionalen Gewalten anpassend bereits seit den achtziger Jahren des 9. Jahrhunderts unter Ausschaltung der Karolinger eigene Könige erhoben - den politischen Realitäten, insbesondere dem über Ludwigs Mutter Oda durch die Konradiner dominierten Regentschaftsrat , Rechnung. In seiner Stellung als König rang Konrad aber anders als im Regentschaftsrat, in dem ihm vor allem am Ausbau seines fränkischen Machtbereiches gelegen war - womit er klar den Mittelgewalten zuspielte - um die Durchsetzung königlicher Rechte. So wollte er - begründet durch das Ausbleiben einer spürbaren Entlastung und dauernder Erfolge in der Reichsverteidigung - eine erneute Etablierung der Herzogsgewalten unterbinden. Nach außen demonstrierte er diese Absicht, indem er seine wichtigsten Berater aus bischöflichen Kreisen rekrutierte.
Ganz im Sinne des karolingischen Einheitsgedanken unternahm er gleich nach seiner Wahl den Versuch, Lothringen - und damit die konradinischen Einflußgebiete - zurückzugewinnen. Doch drei zu diesem Zweck unternommene Feldzüge im Frühjahr und Sommer 912 und nochmals im Frühjahr 913, blieben erfolglos.
Zur ersten Reibungen kam es schließlich in Schwaben, wo der rhätische Markgraf Burchard im Begriff stand, das allemanische Herzogtum wieder aufzurichten. Aber die Interessen Burchards ließen den Kanzler König Konrads, Bischof Salomo III. von Konstanz, um seinen eigenen Einfluß fürchten. Deshalb ließ er Burchard 911 umbringen, was den Aufbau eines schwäbisches Herzogtum zunächst zwar unterbinden, letztlich aber nicht aufhalten konnte.
Die Sachsen brüskierte Konrad, indem er den Tod des bereits in herzogsähnlicher Stellung waltenden Otto den Erlauchten am 30.11.912 zum Vorwand nahm, Thüringen aus Sachsen herauszulösen. Dem widersetzte sich Ottos Sohn Heinrich entschieden und besetzte seinerseits in Sachsen gelegenes mainzisches Kirchengut.
Die Machtdemonstration des Liudolfingers und ein im Bund mit ihrem Neffen, dem bairischen ,Herzog’ Arnulf, errungener Sieg über die Ungarn am Inn 913, bewog die beiden allemanischen Grafenbrüder Erchanger und Berthold das Werk Burchards in Schwaben fortzuführen. Konrad versuchte der Konfrontation zu begegnen, indem er 913 Kunigunde, die Schwester der beiden und Mutter Arnulfs, heiratete. Doch der Streit seiner Schwäger mit dem Kanzler verhinderte einen friedlichen Ausgleich. 914 eskalierte der Konflikt in der Gefangennahme Salomos durch Erchanger. Zwar konnte Konrad den Bischof befreien und Erchanger exilieren, doch provozierte er damit den Widerstand seines Stiefsohns heraus. Konrad zog nach Baiern und zwang Arnulf zur Flucht nach Ungarn, aber im nunmehr führerlosen Schwaben setzte sich Burchards Sohn, Burchard I., an die Spitze.
Anstatt sich nun um ein einheitliches Vorgehen gegen die in dieser Situation in Sachsen und Schwaben einbrechenden Ungarn zu bemühen, übergab Konrad seinem Bruder Eberhard die sorbische Mark und ließ ihn in Sachsen einmarschieren. Aber Heinrich rieb das fränkische Heer bei der Eresburg auf und zog seinerseits nach Hohentwiel, wo Konrad Burchard belagerte. Konrad zog sich aus Schwaben zurück, in dem Erchanger wieder erschien und mit Burchard ein Bündnis gegen Konrad schloß. In Sachsen konnte Konrad 915 zwar bis Grone vorstoßen, aber in Schwaben besiegten Erchanger und Burchard das königliche Aufgebot bei Wahlwies (westlich von Bodman) und Erchanger wurde im Herbst 915 zum Herzog ausgerufen.
Erchangers Beispiel folgend, kehrte auch Arnulf zurück, den Konrad aber noch im Frühjahr 916 in Regensburg angriff, die Stadt in Schutt und Asche legte und Arnulf erneut zum Ausweichen nach Ungarn zwang.
Zur Beilegung der ersten tiefen Krise des noch im Entstehen begriffenen deutschen Staates wurde am 20.09.916 in Hohenaltheim eine Generalsynode einberufen, der die sächsische Kurie allerdings demonstrativ fernblieb. Der eigens aus Rom angereiste päpstliche Legat Petrus von Orte verdammte die Opposition der Herzöge gegen einen „Gesalbten des Herrn” und rechtfertigte damit die Verurteilung Erchangers und Bertholds zu lebenslanger Klosterhaft. Arnulf und sein Bruder Berthold, die der Aufforderung zum Erscheinen nicht gefolgt waren, wurden zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorgeladen.
Vielleicht hätte die Synode - wenn schon keine Einigung - zumindest eine Waffenruhe herbeiführen können, die eine wirksame, das ganze Reich umfassende Abwehr gegen die Ungarn möglich gemacht hätte. Doch die Flucht der schwäbischen Grafenbrüder und die nach ihrer Wiederergreifung unumgängliche Hinrichtung - einschließlich ihres Neffen Liutfried - am 21.01.917 in Aldingen verhinderte dies nachhaltig.
In Schwaben fand Burchard, der kurzentschlossen den Besitz der Brüder besetzte, bald allgemeine Anerkennung als Herzog und im Zuge eines erneuten Raubzuges der Ungarn 917 vertrieb Arnulf Eberhard aus Baiern. Noch einmal zog Konrad im Herbst 918 nach Regensburg, wurde aber geschlagen und verwundet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von "DAS WIEDERSTARKEN DER HERZOGSGEWALTEN IM OSTFRÄNKISCHEN REICH"?
Das Hauptthema ist die Wiedererstarkung der Herzogsgewalten im Ostfränkischen Reich im beginnenden 10. Jahrhundert und der damit verbundene Zerfall der zentralistischen Strukturen des fränkisch-karolingischen Herrschaftsaufbaus.
Welche Faktoren trugen zur Stärkung der Herzogsgewalten bei?
Mehrere Faktoren trugen dazu bei: die Schwäche der Zentralregierung unter Ludwig dem Kind, die Einfälle der Ungarn und Normannen, die zur Entwicklung von Regionalgewalten führten, und der Machtkampf rivalisierender Adelsfamilien.
Wie entwickelte sich das Stammesherzogtum Sachsen?
Das Stammesherzogtum Sachsen formte sich unter den späten Karolingern, beginnend mit Liudolf und seinen Nachfolgern Brun und Otto dem Erlauchten. Otto der Erlauchte trug wesentlich zur Festigung der sächsischen Macht bei.
Was war die Babenberger Fehde und welche Bedeutung hatte sie?
Die Babenberger Fehde war ein selbstzerstörerischer Machtkampf zwischen den Babenbergern und Konradinern. Sie verdeutlichte die Ohnmacht des königlichen Machtanspruchs und den Aufstieg des Stammesadels.
Wie endete die Babenberger Fehde?
Die Fehde endete mit dem Sieg der Konradiner, nachdem der letzte überlebende Babenberger Graf Adalbert hingerichtet wurde. Die Konradiner übernahmen die Vormachtstellung in Ostfranken und Lothringen.
Welche Rolle spielte Konrad im Wiedererstarken der Herzogsgewalten?
Nach seiner Wahl zum König versuchte Konrad, die Herzogsgewalten zu unterbinden und die königlichen Rechte durchzusetzen, was jedoch aufgrund mangelnder Erfolge in der Reichsverteidigung scheiterte.
Was unternahm Konrad, um Lothringen zurückzugewinnen?
Konrad unternahm mehrere Feldzüge, um Lothringen zurückzugewinnen, die jedoch alle erfolglos blieben.
Welche Konflikte gab es in Schwaben und Sachsen?
In Schwaben versuchte Burchard, das allemanische Herzogtum wieder aufzurichten, wurde aber von Bischof Salomo III. umgebracht. In Sachsen kam es zu Konflikten, als Konrad versuchte, Thüringen aus Sachsen herauszulösen, was Heinrich widersprach.
Wie versuchte Konrad, die Konflikte in Schwaben und Baiern zu lösen?
Konrad versuchte, die Konflikte durch Heirat mit Kunigunde (Schwester der Grafen Erchanger und Berthold und Mutter Arnulfs) und militärische Interventionen beizulegen, was jedoch nicht gelang.
Was geschah auf der Generalsynode in Hohenaltheim?
Auf der Generalsynode in Hohenaltheim wurden die Herzöge, die gegen Konrad opponierten, verurteilt, was jedoch keine Einigung oder Waffenruhe herbeiführte.
Wie endete Konrads Herrschaft?
Konrad starb am 23.12.918, ohne die Herausbildung der Herzogsgewalten verhindern oder sie in den Staatsaufbau integrieren zu können.
- Quote paper
- Jan Süß (Author), 2001, Das Wiedererstarken der Herzogsgewalten im Ostfränkischen Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101463