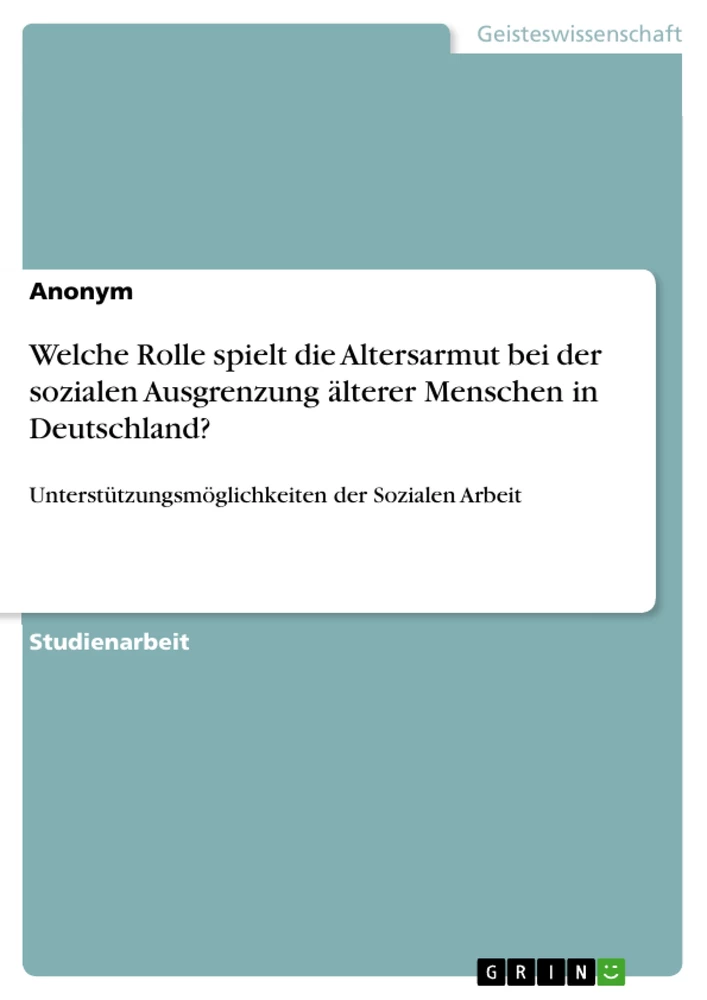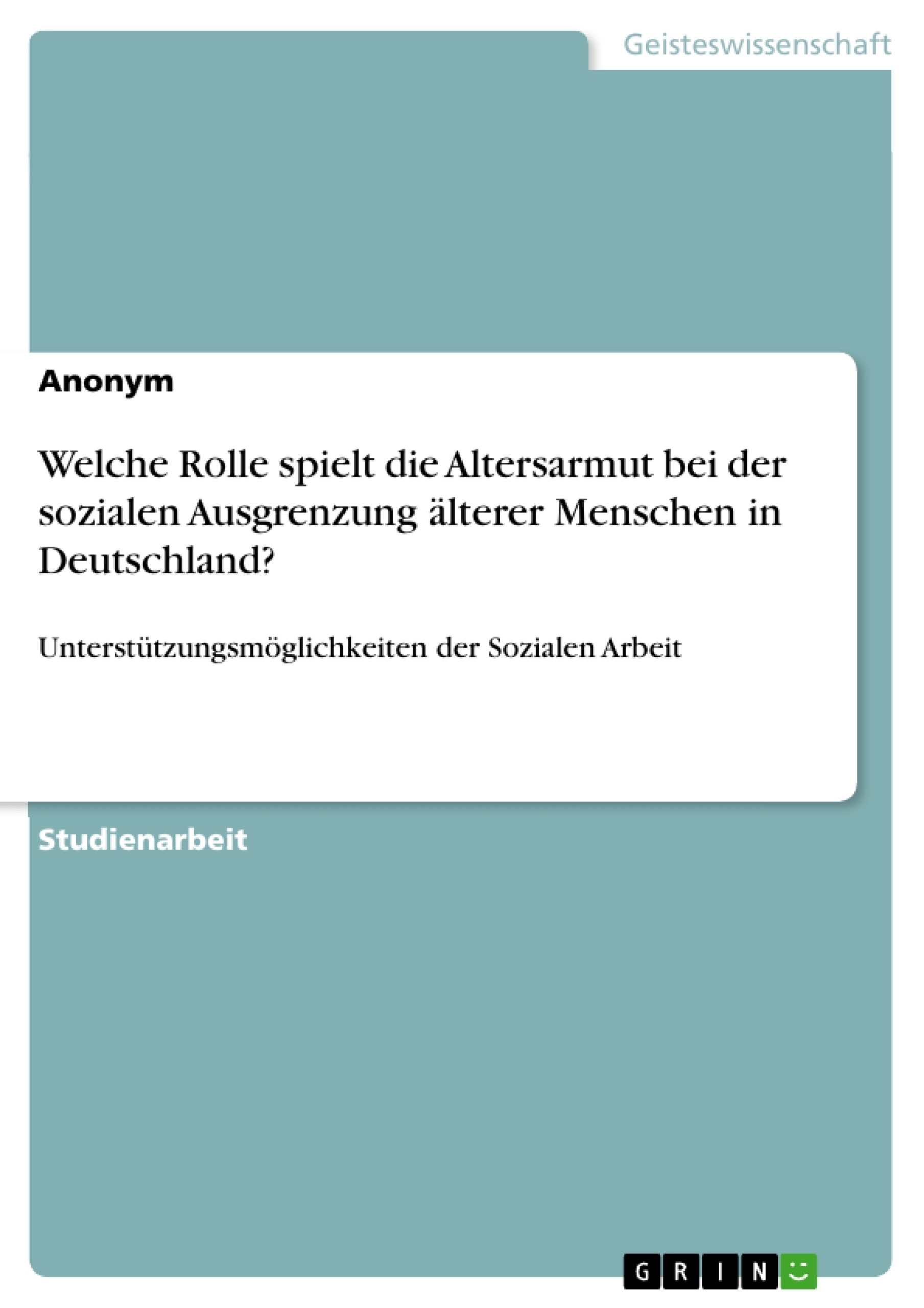Im Rahmen dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche Rolle die Altersarmut bei der sozialen Ausgrenzung älterer Menschen in Deutschland spielt. Ältere sowie von Armut betroffene Menschen stellen heute und auch in Zukunft einen Teil der Klient*innen der Sozialen Arbeit dar. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist unumgänglich, wenn es darum geht, die Klient*innen in ihrer spezifischen Lebenslage zu unterstützen. Das Bewusstwerden der Lebenssituation älterer armer Menschen ist auch deshalb nötig, um in Zukunft Bedingungen zu schaffen, die eine solche Situation eindämmen beziehungsweise verhindern können. Mit den Ursachen und Konsequenzen von Altersarmut und sozialer Ausgrenzung werden Sozialarbeiter*innen häufig konfrontiert. Es liegt somit auch an ihnen sozialpolitisch tätig zu werden und in der Gemeinde Bedingungen zu schaffen, die soziale Ausgrenzung reduzieren.
Um Altersarmut besser analysieren zu können, werden zunächst die Begriffe Altersarmut und soziale Ausgrenzung definiert. Im weiteren Verlauf folgt eine Auseinandersetzung mit den von Altersarmut besonders betroffenen Personengruppen. In den darauffolgenden Kapiteln werden mögliche Gründe für eine soziale Ausgrenzung näher betrachtet. Das Kapitel Altersarmut als Grund sozialer Ausgrenzung soll Aufschluss darüber geben, dass die Kombination der Faktoren erhöhtes Alter und Armut soziale Ausgrenzung eher begünstigt als die alleinige Tatsache von Armut. Abschließend folgt das Fazit, welches rückblickend auf die Kapitel eingeht, Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit beleuchtet und die aktuelle politische Lage in den Blick nimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Altersarmut
- Soziale Ausgrenzung
- Von Altersarmut besonders betroffene Personengruppen
- Alter als Grund sozialer Ausgrenzung
- Altersarmut als Grund sozialer Ausgrenzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Rolle von Altersarmut bei der sozialen Ausgrenzung älterer Menschen in Deutschland. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Altersarmut und sozialer Ausgrenzung zu beleuchten und zu analysieren, wie sich diese Problematik auf die Lebenssituation älterer Menschen auswirkt. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren zur sozialen Ausgrenzung beitragen und welche Folgen sich aus der Kombination von Alter und Armut ergeben.
- Definitionen von Altersarmut und sozialer Ausgrenzung
- Besonders betroffene Personengruppen
- Alter als ein Faktor sozialer Ausgrenzung
- Altersarmut als ein Faktor sozialer Ausgrenzung
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Altersarmut und soziale Ausgrenzung älterer Menschen in Deutschland ein. Sie beleuchtet den aktuellen Stand der Armutsgefährdung in Deutschland, insbesondere im Kontext der Altersgruppe ab 65 Jahren. Zudem werden die Gründe für die Wiederkehr des Themas Altersarmut erläutert, wie beispielsweise gebrochene Erwerbsbiografien und die Expansion des Niedriglohnsektors.
Definitionen
Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Altersarmut“ und „Soziale Ausgrenzung“. Es werden verschiedene Perspektiven und Definitionen aus der wissenschaftlichen Literatur vorgestellt, die sowohl die ökonomischen als auch die sozialen Aspekte dieser Themenbereiche beleuchten.
Von Altersarmut besonders betroffene Personengruppen
In diesem Kapitel werden die Personengruppen beleuchtet, die besonders von Altersarmut betroffen sind. Es wird auf Faktoren eingegangen, die zu dieser Lebenslage geführt haben, und es wird ein Überblick über jene Personengruppen gegeben, bei denen die Soziale Arbeit präventiv ansetzen sollte.
Alter als Grund sozialer Ausgrenzung
Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Alters als ein Faktor sozialer Ausgrenzung. Es wird analysiert, wie die Lebensphase Alter, unabhängig von Armut oder Reichtum, zu sozialer Ausgrenzung führen kann. Insbesondere wird der Einfluss von gesundheitlichen Einschränkungen und ungünstigen Wohnverhältnissen auf die soziale Integration älterer Menschen beleuchtet.
Altersarmut als Grund sozialer Ausgrenzung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Altersarmut auf die soziale Ausgrenzung. Es wird dargelegt, dass die Kombination von Alter und Armut die soziale Ausgrenzung eher begünstigt als die alleinige Tatsache von Armut.
Schlüsselwörter
Altersarmut, soziale Ausgrenzung, ältere Menschen, Deutschland, Soziale Arbeit, Handlungsmöglichkeiten, Lebensstandard, Bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen, Grundsicherung im Alter, sozialpolitische Maßnahmen, Inklusion, Exklusion.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Welche Rolle spielt die Altersarmut bei der sozialen Ausgrenzung älterer Menschen in Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1012214