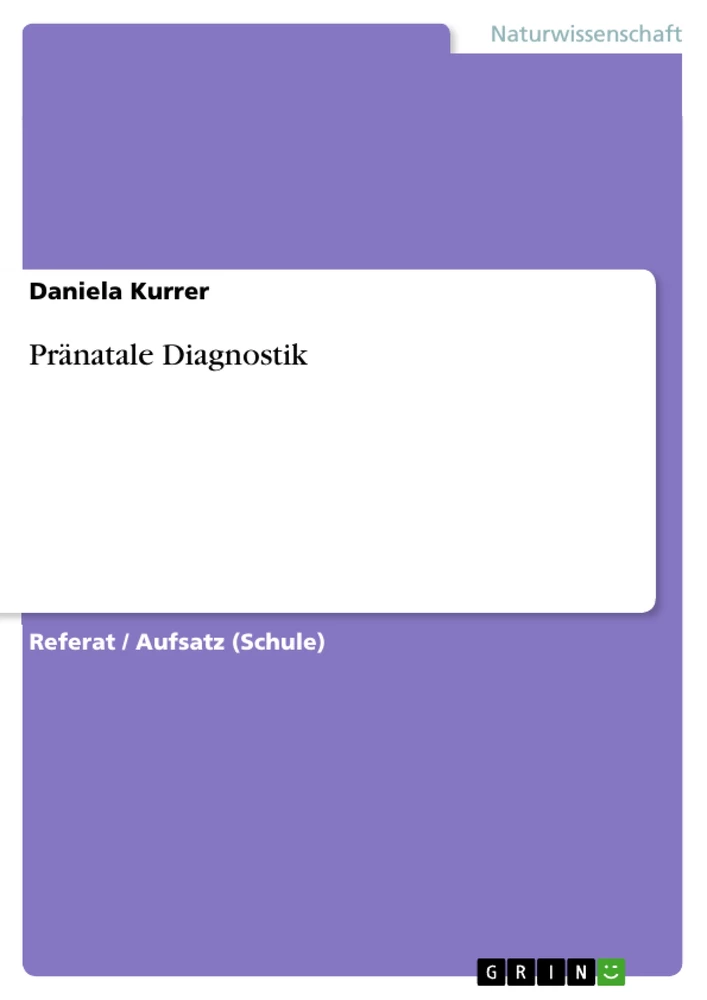Pränatale Diagnostik
0.Einführung
Unter Pränataler Diagnostik versteht man die vorgeburtliche Untersuchung nach genetischen Erkrankungen. Sie beinhaltet alle die diagnostischen Maßnahmen , durch die morphologische, strukturelle, funktionelle, chromosomale und molekulare Störungen vor der Geburt erkannt bzw. ausgeschlossen werden können und dient der Betreuung der ratsuchenden Schwangeren und des ungeborenen Lebens .
Erstmals 1966 eingeführt, ist die pränatale Diagnose heutzutage ein wesentlicher Bestandteil der pränatalen Medizin , welche als eigenständige medizinische Disziplin bereits weit über die ursprüngliche Schwangerschaftsvorsorge hinausgeht .
1.Ziele der pränatalen Diagnostik
- Störung der embryonalen und fetalen Entwicklung zu erkennen
- Durch Früherkennung von Fehlentwicklung eine optimale Behandlung der Schwangeren und des (ungeborenen) Kindes zu ermöglichen
- Befürchtungen und Sorgen der Schwangeren zu objektivieren und abzubauen
- Schwangeren Hilfe bei der Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der
Schwangerschaft zu geben
2.Mögliche Gründe für eine pränatale Diagnostik
- erhöhtes Alter der Schwangeren
- auffällige Serummarker
- verdächtige sonographische Befunde
- pränatal diagnostizierbare Erkrankungen in der Familie
- strukturelle oder numerische chromosomale Aberration bei einem Elternteil
- teratogen und fetotoxisch wirkende Infektionen der Mutter
3.Untersuchungsmethoden der pränatalen Diagnostik
Bei der pränatalen Diagnostik werden zwei Untersuchungsmethoden unterschieden ; die invasiven Methoden und die nicht- invasiven Methoden.
3.1. Nicht- invasive Methoden
- Röntgendiagnostik
- Mikrobiologische Untersuchungen aus dem Blut der Schwangeren
- Ultraschalluntersuchung (Sonographie) : Die Ultraschalluntersuchung gilt als Standardverfahren zur Schwangerschaftsüberwachung und liefert wichtige geburtshilfliche Daten wie z.B. die körperliche Entwicklung des Kindes im Laufe der Schwangerschaft , Lage , Geschlecht , Herzaktion , Sitz der Plazenta und Fruchtwassermenge .Sie wird vorwiegend bei Frauen unter 35 Jahren durchgeführt und ist im Gegensatz zur Röntgendiagnostik und zur Fruchtwasserentnahme vollkommen ungefährlich für die Mutter und das Kind . Außerdem gibt die Ultraschall- Sonographie wichtige Informationen über mögliche foetale Mißbildungen wie z.B. Anencephalus (fehlende Großhirnrinde) , Zwerchfellmißbildungen und es lassen sich mögliche
Chromosomenanomalien (Bsp. Trisomie 21) bereits in einem sehr frühen Stadium an äußeren Merkmalen feststellen
3.2.Invasive Methoden
- Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung): Die Amniozentese oder transabdominale Fruchtwasserpunktion kann bei der Schwangeren ab der 15. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden . Hierbei werden mit Hilfe einer Kanüle einige Milliliter Fruchtwasser aus der Fruchtblase entnommen . Das Fruchtwasser enthält auch einige fetale Zellen , welche kultiviert und einer Chromosomenanalyse unterzogen werden können fi Chromosomenstörungen können , wenn vorhanden , nach ca.3 Wochen diagnostiziert werden
- Chorionzottenbiopsie : Chorionzotten sind fransige Fortsätze der äußeren Embryonalhülle (Chorion) und stellen Gewebe des ungeborenen Kindes dar . Deren Proben können nach erfolgreicher Entnahme in der 8.-10. Schwangerschaftswoche ohne Anlegen von Zellkulturen untersucht werden fi Ergebnisse liegen bereits nach 1 Woche vor
- Nabelschnurpunktion: Wurden Chorionzottenbiopsie und Amniozentese versäumt oder lieferten diese Untersuchungsmethoden nur unklare Ergebnisse, so besteht die Möglichkeit ,mittels einer Spritze einige Milliliter Blut aus der Nabelschnur zu entnehmen und es sofort cygonetisch und biochemisch zu untersuchen .Die Nabelschnurpunktion wird häufig auch dann durchgeführt, wenn der Verdacht einer Virusinfektion vorliegt , die für die Mutter nicht spürbar oder harmlos verläuft , aber bei dem Kind schwere Schädigungen verursacht (Bsp. Röteln).Aus dem Blut entnommene Antikörper können eine Infektion des Kindes bestätigen oder ausschließen .
Nachteile der Invasiven Methoden : Es besteht ein minimales Risiko (ca. 3-5 %), dass das Kind bei der Untersuchung durch die Kanüle bzw. Spritze verletzt wird und es dadurch zu einer Behinderung oder einer Fehlgeburt kommt.
4.Ethische Aspekte der pränatalen Diagnostik
Jede pränatale Diagnostik und die damit verbunden Untersuchungsmethoden haben für die Schwangere und das ungeborene Kind Konsequenzen . Im Idealfall kann man aus den gewonnenen Ergebnissen der pränatalen Diagnostik einen normalen Verlauf der Schwangerschaft ablesen und die Befürchtungen der Schwangeren zerstreuen . Doch werden Eltern nach einer pränatalen Diagnose nicht selten vor die Wahl gestellt sich für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden.
Deshalb ist es unbedingt notwendig Nutzen und Risiko für Mutter und Kind in jedem Einzelfall gegeneinander abzuwägen , die Schwangere zu jedem Zeitpunkt der Diagnose ausreichend zu beraten und zu informieren und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu gewährleisten .
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Pränataler Diagnostik?
Pränatale Diagnostik bezieht sich auf vorgeburtliche Untersuchungen, die auf genetische Erkrankungen abzielen. Sie umfasst alle diagnostischen Maßnahmen, mit denen morphologische, strukturelle, funktionelle, chromosomale und molekulare Störungen vor der Geburt erkannt oder ausgeschlossen werden können. Sie dient der Betreuung der Schwangeren und des ungeborenen Lebens.
Welche Ziele verfolgt die pränatale Diagnostik?
Die Ziele sind die Erkennung von Störungen der embryonalen und fetalen Entwicklung, die Ermöglichung einer optimalen Behandlung der Schwangeren und des Kindes durch Früherkennung, die Objektivierung und den Abbau von Ängsten der Schwangeren sowie die Unterstützung der Schwangeren bei der Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Schwangerschaft.
Welche Gründe gibt es für eine pränatale Diagnostik?
Mögliche Gründe sind ein erhöhtes Alter der Schwangeren, auffällige Serummarker, verdächtige sonographische Befunde, pränatal diagnostizierbare Erkrankungen in der Familie, strukturelle oder numerische chromosomale Aberrationen bei einem Elternteil sowie teratogen und fetotoxisch wirkende Infektionen der Mutter.
Welche Untersuchungsmethoden werden in der pränatalen Diagnostik eingesetzt?
Man unterscheidet zwischen invasiven und nicht-invasiven Methoden. Zu den nicht-invasiven Methoden gehören Röntgendiagnostik, mikrobiologische Untersuchungen aus dem Blut der Schwangeren und Ultraschalluntersuchungen (Sonographie). Zu den invasiven Methoden gehören Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung), Chorionzottenbiopsie und Nabelschnurpunktion.
Was ist eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie)?
Die Ultraschalluntersuchung ist ein Standardverfahren zur Schwangerschaftsüberwachung. Sie liefert wichtige Informationen über die körperliche Entwicklung des Kindes, Lage, Geschlecht, Herzaktion, Sitz der Plazenta und Fruchtwassermenge. Sie kann auch Hinweise auf foetale Missbildungen oder Chromosomenanomalien geben.
Was ist Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung)?
Die Amniozentese ist eine invasive Methode, bei der ab der 15. Schwangerschaftswoche Fruchtwasser aus der Fruchtblase entnommen wird. Die darin enthaltenen fetalen Zellen können kultiviert und auf Chromosomenstörungen untersucht werden.
Was ist eine Chorionzottenbiopsie?
Die Chorionzottenbiopsie ist eine invasive Methode, bei der in der 8.-10. Schwangerschaftswoche Gewebeproben aus den Chorionzotten entnommen werden. Diese können auf genetische Defekte untersucht werden.
Was ist eine Nabelschnurpunktion?
Die Nabelschnurpunktion ist eine invasive Methode, bei der Blut aus der Nabelschnur entnommen und zytogenetisch und biochemisch untersucht wird. Sie wird häufig bei Verdacht auf eine Virusinfektion durchgeführt.
Welche Risiken bestehen bei invasiven Methoden?
Es besteht ein minimales Risiko (ca. 3-5 %), dass das Kind bei der Untersuchung durch die Kanüle bzw. Spritze verletzt wird und es dadurch zu einer Behinderung oder einer Fehlgeburt kommt.
Welche ethischen Aspekte sind bei der pränatalen Diagnostik zu berücksichtigen?
Jede pränatale Diagnostik hat Konsequenzen für die Schwangere und das ungeborene Kind. Eltern können vor die Wahl gestellt werden, sich für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Nutzen und Risiko müssen in jedem Einzelfall abgewogen werden, und die Schwangere muss ausreichend beraten und informiert werden. Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist wichtig.
Welche Konflikte können im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen nach pränataler Diagnose entstehen?
Ein Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnose kann in Konflikt mit dem Tötungsverbot und dem Schutz des ungeborenen Lebens geraten. Die Problematik des Schwangerschaftsabbruches und das Risiko der Diagnostik sollten daher in die Beratung der Schwangeren vor einer pränatalen Diagnostik einbezogen werden.
- Quote paper
- Daniela Kurrer (Author), 2000, Pränatale Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101057