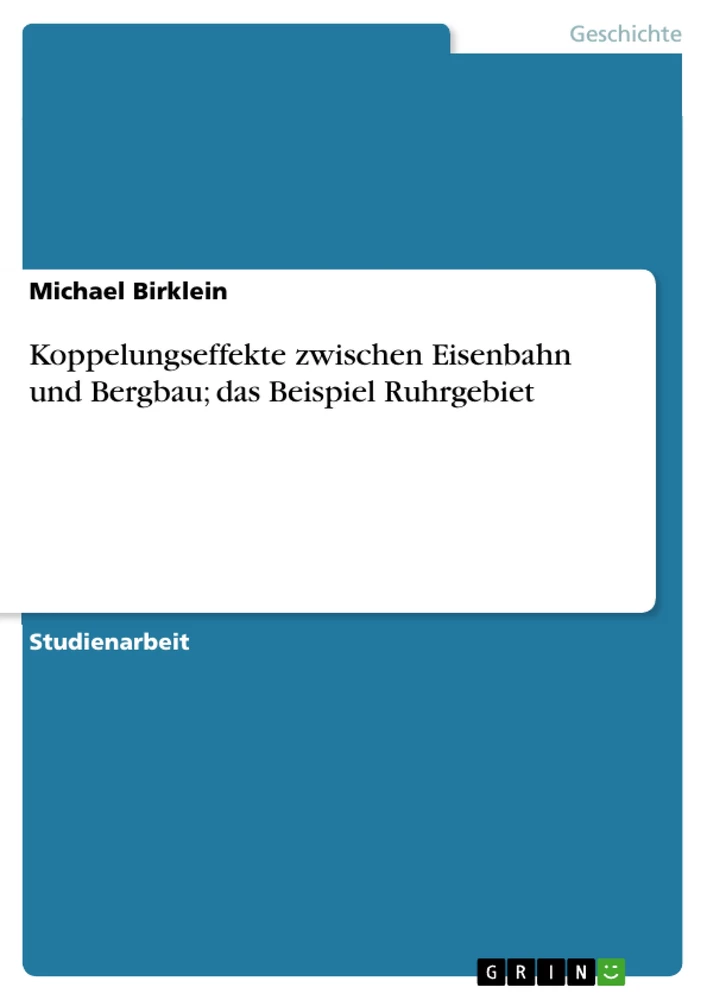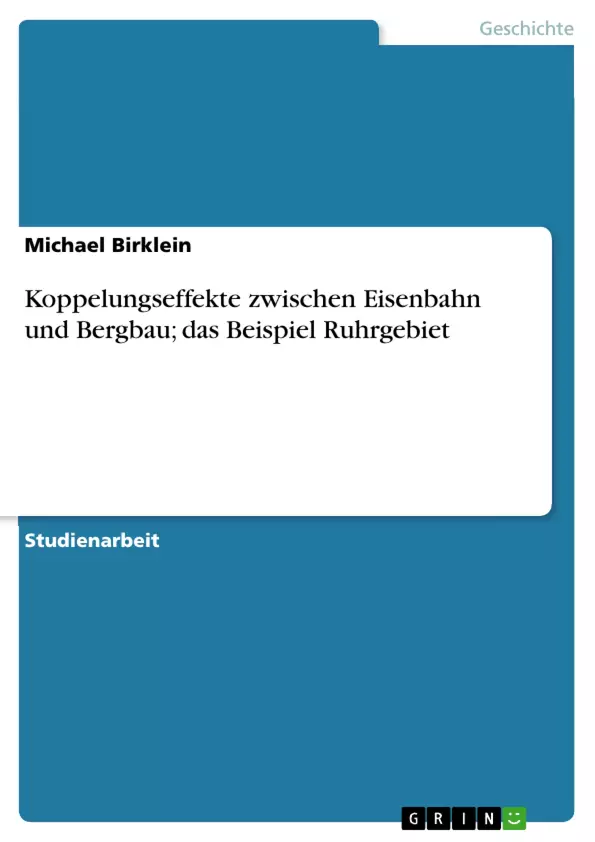Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entwicklung des Ruhrbergbaus bis Mitte des 19. Jahrhunderts
3. Die Entwicklung der Eisenbahn und des Transportwesens im Ruhrgebiet
3.1. Die Verhältnisse im Transportwesen bis 1847
3.2. Die Entwicklung der Eisenbahn im Ruhrgebiet seit 1847
4. Koppelungseffekte zwischen Eisenbahnen und Steinkohlenbergbau während der Industrialisierung in Deutschland
4.1. Vorwärtskoppelungseffekte
4.2. Rückwärtskoppelungseffekte
5. Zusammenfassung
Anhang: - Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Versicherung
1. Einleitung
Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts setzte in den deutschen Landen lange nach England und auch später als z.B. in Belgien die als „take-off“ bezeichnete Phase des demogra- phischen Übergangs und gleichzeitig auch des Übergangs von der vorindustriellen Agrarwirtschaft zur Industriewirtschaft ein. Anders als in England, wo der Textilindustrie eine überragende Rolle im Industrialisierungsprozeß zufiel, errang hierbei in Deutschland vor allem der Eisenbahnsektor herausragende Bedeutung, in dessen Sog die gesamte Wirtschaft wuchs, wobei sowohl der Steinkohlenbergbau als auch die eisenschaffende Industrie sich besonders stark entwickelten. Diesen Aspekt der sogenannten Vor- und Rückwärtskoppelungseffekte eines Führungssektors ( hier: Eisenbahn-Bergbau ) beschreiben und diskutieren in der wissenschaftlichen Literatur ausführlich Wirtschaftshistoriker, zu denen u.a. TILLY1, HOLTFRERICH2 und FREMDLING3 gehören. Es ist dieses Thema auch ein Beispiel für die Wechselwirkung von Verkehrs- infrastruktur und (regionaler) Wirtschaftsentwicklung.
Mit Einsetzen der Industriellen Revolution begann auch der Aufstieg des Ruhrgebietes – damals bereits ein Steinkohlenrevier mit Tradition4 – zum wichtigsten Industriegebiet Deutschlands. Diese Entwicklung hing sehr eng zusammen mit dem Wachstum der Eisen- und Stahlindustrie und dem sich stark ausweitenden Steinkohlenbergbau in dieser Region, deren Wachstum auffällig eng mit der Entwicklung des Eisenbahnnetzes zusammenhing. Dies ist Anlaß genug, sich des Themas der Koppelungseffekte zwischen Eisenbahnen und Steinkohlenbergbau mit besonderem Augenmerk auf das Ruhrgebiet zu widmen, was im Folgenden geschehen soll.
2. Die Entwicklung des Ruhrbergbaus bis Mitte des 19. Jahrhunderts
Um die Behauptung zu stützen, der Bergbau sei positiv durch die Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Deutschland beeinflußt worden, ist es empfehlenswert, sich zunächst mit der Entwicklung des Ruhrbergbaus und der Kohlenmärkte vor der Entstehung des Eisenbahnnetzes zu befassen.
Der Steinkohlenbergbau konzentrierte sich auf einige wenige Gebiete in Deutschland, vor allem auf das Ruhrrevier. Das im Ruhrtal zutage streichende Karbon beinhaltet eine Reihe von Steinkohlenflözen von teilweise sehr unterschiedlicher Mächtigkeit und bisweilen bester Qualität5. Im Bereich des Ruhrtals, wo die Flöze offen zutage treten, begann nachweislich bereits im späten 13. Jh. der Bergbau auf Steinkohlen. So belegt das Dortmunder Bürgerbuch von 1296 erstmals den Beruf des Kohlenbergmanns im Bereich der Ruhr.6 Das Urkundenbuch des Klarissenklosters in Hörde erwähnt bereits 1277 den Begriff „Schuirer Steinkulen“7. Im Jahre 1129 gesteht bereits ein kaiserliches Dokument den Bürgern der Stadt Duisburg das Recht zu, auf eigenem Grund Steinkohlenbergbau zu betreiben.8 In damaliger Zeit schürften die Bergleute mit äußerst einfachen Mitteln in sogenannten Pingen, in denen selten mehr als zwei oder drei Menschen arbeiteten. Mit fortschreitender Zeit ging man dann zum Stollenbau über. Ein Tiefbau, wie er heute betrieben wird, war damals nicht üblich und aufgrund der geringen Absatzmöglichkeiten und mangelnder Technik auch ökonomisch nicht sinn- voll. Lediglich einige seigere (senkrechte) Schächte zwischen zwei oder drei Solen (Stollen) legte man vor dem 19.Jh. an. 9
Die erste Zeche des Reviers ist 1450 in Essen belegt.10 In den folgenden 400 Jahren kamen viele neue Zechen – beinahe ausnahmslos Kleinzechen – hinzu und verschwanden vielfach auch wieder, da sie ohnehin i.d.R. dem Nebenerwerb der Bauern und Handwerker gedient haben dürften.
Im frühen 19. Jh. machte man die ersten Versuche mit sogenannten Mergelschächten die Mergeldecke zu durchstoßen, unter die nördlich der Ruhr die Flöze abtauchen. 1808 entstand der Schacht Victoriaauf Zeche Vollmond in Bochum. Man teufte senkrecht bis 46 m Tiefe.11 Erst dreißig Jahre später folgten diesem Beispiel weitere Zechen des Ruhrgebietes12. Einhergehend mit dem ersten Durchteufen der Mergeldecke kamen auch erstmals aus England importierte Damfmaschienen im Ruhrbergbau zum Einsatz, die erste bezeichnenderweise in Bochum auf ZecheVollmond.13 Zum Vergleich: Im Aachener Revier wurde 1793/94 die erste Dampfmaschiene (Z.Centrum Eschweiler- Pumpe) zur Wasserhaltung eingesetzt14. Dort ist auch der Tiefbau bereits im 18. Jh.weit verbreitet.15 Mit der zunehmenden Nachfrage nach Koks zur Metallverhüttung wurde es umso notwendiger, den Tiefbau zu forcieren, um an die verkokbaren Fettkohlen nördlich der Ruhr zu gelangen, was allerdings teuer war und die Gründung von Großbetrieben nach sich zog.16 Im Jahre 1850 förderten 198 Zechen im Ruhrgebiet durchschnittlich knapp 8500 t Kohle, bei durchschnittlich 64 Beschäftigten, wobei keine einzige Zeche auch nur annähernd 100000 t förderte; die Gesamtbelegschaft aller Ruhrzechen betrug im selben Jahr 12741 Mann17. Seit 1800 hat sich die jährliche Fördermenge auf das Zehnfache vergrößert, betrug bis 1850 aber durchweg weniger als zwei Millionen Tonnen per annum. 18 1850 wurden 1.665.662 t Steinkohle zutage gefördert.19
Die Kohlen des Reviers dienten vermutlich hauptsächlich dem Hausbrand und dem Schmiede- und Metallhandwerk. Sie wurden in der nächsten Umgebung der Zechen abgesetzt, aber teilweise bereits per Fuhrwerk oder Schiff (s. Kapitel 3.1.) in benach- barte Städte und entlang des Rheines transportiert. In den nahen Mittelgebirgstädten, in denen sich ein blühendes Metallgewerbe befand, wurde allerdings noch zur Hauptsache auf Holzkohle zurückgegriffen.20
Tabelle 1:21 Der Ruhrbergabau in Zahlen von 1792 bis 1850
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dies diene als Vergleichsbasis zu später ermittelten Werten, nach Aufkommen der Eisenbahnen im Ruhrgebiet und im restlichen Deutschland.
3. Die Entwicklung der Eisenbahn und des Transportwesens im Ruhrgebiet
Die Steinkohle ist ein Massengut, welches sich nur dann über weitere Entfernungen zu transportieren lohnt, wenn entsprechend große Mengen vergleichsweise kostengünstig befördert werden können. Demnach bestimmen in den dem Revier fern gelegenen potentiellen Abstatzmärkten die Tansportkosten beim Absatz der Kohle eine entschei- dende Rolle. Ist der Transport zu aufwendig und damit zu teuer, steigt der Preis, was den Absatz mindert.22 Aus diesem Grunde ist es notwendig, sich ein Bild über die Situation im Transport- und Verkehrswesen vor und nach dem Auftreten der Eisenbahn zu machen, um anschließend den Einfluß der Eisenbahn auf das Transportwesen und damit auf die Nachfrager nach Transportkapazitäten zu untersuchen:
3.1. Die Verhältnisse im Transport- und Verkehrswesen vor 1847
Bis Mitte des 19. Jh vollzog sich der Güter- und Warentransport im Ruhrgebiet und fast im ganzen Rest Preußens und der anderen deutschen Staaten entlang der schiffbaren Flüsse und auf i.d.R. unbefestigten Straßen, die nach heutigem Maßstab als solche kaum zu bezeichnen wären. Die Strecken, die mit hölzernen Pferdefuhrwerken befahren wurden, waren bei schlechtem Wetter häufig unpassierbar. Außerdem gingen auf den meist unbefestigten Straßen häufig die Räder der Fuhrwerke zu Bruch. Aus diesen Gründen wurde Kohle aus dem RG häufig in Säcken auf den Rücken von Tragpferden (ca. 100 bis 150 kg/Pferd) ins benachbarte Sauerland gebracht. 1850 wurden noch 45% der Kohle vom Ruhrgebiet aus so aufwendig und damit teuer transportiert.23
Neben den Fuhrwegen und den noch seltenen Chausseen kam der Schiffahrt eine gewichtige Rolle im Kohlentransport zu. Deswegen kam es trotz politischer und technischer Schwierigkeiten zur Schiffbarmachung der Ruhr seit 1776. Ab 1778 fuhren die Aaken (Ruhrschiffe, bis 175 t groß) auf der Ruhr. Mit der Schiffbarmachung der Ruhr konnte nur teilweise kostengünstiger transportiert werden, da u.a. Schleusen und wechselnde Wasserstände und das Treideln stromaufwärts die Schiffahrt behinderten.24
Dennoch dürfte der Schiffstransport den Ruhrzechen Absatzmöglichkeiten entlang des Rheines (Südwestdeutschland; Niederlande; Belgien) eröffnet haben, was ein Grund für die Verzehnfachung der Förderung zwischen 1792 und 1850 sein könnte (siehe Tab.1).
Dennoch kann Mitte des 19. Jh. von keinem der damals üblichen Verkehrsträger behauptet werden, er sei für den Massentransport insbesondere von Kohle genügend. Nur damit ist zu erklären, daß auf vielen deutschen und europäischen Kohlenmärkten die englische Kohle dominierte, die über den Seeweg offensichtlich billiger im großen
Umfang transportiert werden konnte, was FREMDLING u.a. am Beispiel des Berliner Kohlenmarktes (Vgl. Tab.2) und des Magdeburger Kohlenmarktes veranschaulichte 25
Tab.2:Berliner Kohlenmarkt nach Herkunft und Transportweg:26
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Transportpreis je Tonnenkilometer betrug im Jahre 1836 in Preußen etwa 15 Pfennige27. Das heißt, daß eine Tonne Steinkohlen pro Kilometer Transportdistanz um
15 Pfennige teurer wurde. Dieser Umstand mußte erheblich den Absatz dieses Massengutes einschränken. Es muß ferner im Interesse der Bergbauunternehmer gewesen sein, diesen Mißstand zu beheben, wobei die Eisenbahn Abhilfe zu schaffen vermochte.
3.2. Die Entwicklung des Eisenbahnnetzes im Ruhrgebiet seit 1847
Die zuvor beschriebenen Umstände begrenzten die Absatzmöglichkeiten der Zechen des Ruhrgebietes erheblich, so daß die Förderung noch gering ausfiel. Dies sollte sich jedoch mit dem Bau der Eisenbahn ändern.
Bereits 1816 gruppierten sich in Elberfeld Gesellschafter zur Errichtung einer Eisen- bahn zur Ruhr, was jedoch die zuständige preußische Regierung nicht billigte.28 Jedoch zogen unermüdliche Eisenbahnpioniere – es sei hierFriedrich Harkortals ein Beispiel genannt –gegen diese Umstände als Wegbereiter für die Schaffung einer Eisenbahn zufelde. So kam es 1826 zum Bau einer ersten Versuchsbahn in Elberfeld durch besagtenHarkortals Demonstrations- und Vorführobjekt. Allerdings wurden weitergehende Projekte u.a. auf Bestreben von Fuhrleuten (sie fürchteten die überlegene Konkurrenz) und auch aufgrund dadurch ausbleibender Chausseegelder verhindert.29
Seit 1827 begann man jedoch an mehreren Stellen des Ruhrgebietes mit der Anlage von Schienenbahnen, die mit Pferden statt Lokomotiven betrieben wurden. Sie dienten als Zechenbahnen dem Abtransport von Steinkohlen von den Zechen zur nächstgelegenen Kohlenstraße (bzw. -hafen), von wo aus der Transport weiterhin konventionell mittels Fuhrwerk (bzw. Schiff) besorgt wurde.30 So dauerte es noch bis zum 15.05.1847, bis die erste Dampfeisenbahn (die „Köln-Mindener-Eisenbahn“) das Ruhrgebiet erschloß und bereits weinige Jahre später bis nach Berlin führte. Man beachte die Tatsache, daß diese Bahn aus Kostengründen nördlich der damals bedeutenden Zechenstandorte Witten, Bochum, Mühlheim und Essen angelegt wurde, was im wesentlichen zur baldigen Ausweitung des Ruhrbergbaus nach Norden beitragen sollte. Die zweite Hauptstrecke durch das Ruhrgebiet folgte Anfang der 1860er Jahre mit der Verbindung Duisburg – Mühlheim – Essen – Steele – Bochum – Langendreer – Dortmund („Bergisch- Märkische-Eisenbahn“).31 Hiermit war der Grundstein zur Erschließung Deutschlands durch die Eisenbahn und zur Entfaltung großer transportabhängiger Industrie gelegt.
„Nach Fremdling bzw. Hoffmann betrugen die deutschen Eisenbahninvestitionen in den 1840er Jahren ca. 20-30% der gesamtwirtschaftlichen Investitionen und danach bis in die 1870er Jahre ca.15-20%. Die jährliche Zuwachsrate der >>Poduktion<< der deutschen Eisenbahnen zwischen 1852 und 1874 betrug fast 14% gegenüber einer jährlichen Zuwachsrate der gesamtwirtschaftlichen Produktion von nur 2,6% oder gegenüber des Industriesektors von 4,8%.“32
Das expandierende Eisenbahnnetz mit seiner enormen Transportkapazität gab den Zechen nun die Möglichkeit, wesentlich kostengünstiger die Kohle auch in weiter entfernte Absatzmärkte zu versenden, doch dazu später mehr. Es entstand somit ein beispiellos dichtes Eisenbahnnetz im Ruhrgebiet.33 1850 betrug die Länge des Eisenbahnnetzes im Ruhrgebiet 170 km. Bis 1900 wuchs die Gesamtlänge des Eisenbahnnetzes im Ruhrgebiet auf immerhin 922 km an (Anstieg gegenüber 1850 um 442,4 %). 1926 erreichte das Netz eine Ausdehnung von 1245 km (Anstieg gegenüber 1850: 632 %).34 Wie wirkte sich nun die Erschließung des Ruhrgebietes durch die Eisenbahn und das in ganz Preußen bzw. Deutschland wachsende Eisenbahnnetz auf den Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet aus? Diese Frage nach den Koppelungseffekten soll im Folgenden beantwortet werden.
4. Koppelungseffekte zwischen Eisenbahn und Steinkohlenbergbau während der Industrialisierung in Deutschland
Nachdem nun sowohl die Entwicklung des Bergbausektors bis Mitte des 19. Jahrhunderts als auch die Entwicklung des Verkehrs- und ab 1847 besonders des Eisenbahnsektors beschrieben worden sind, ist nun von Interesse, wie sich seitdem diese Sektoren in ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflußten. Diese Koppelungseffekte unterteilen TILLY35 und FREMDLING36 in Vor- und Rückwärtskoppelungseffekte.
4.1. Vorwärtskoppelungseffekte
Die Vorwärtskoppelungseffekte definiert TILLY als „[...] die pekuniären externen Ersparnisse anderer Sektoren, die Unternehmer dort zur Produktionsexpansion und Kapazitätserweiterung anregten.“37 Das heißt im Falle der Eisenbahn in bezug auf den Bergbau also, daß der Bau der Eisenbahn durch eine Steigerung der Transport- kapazität38 (s.Tab.4) und Verbilligung der Transportpreise39 (s.Tab.3) die Produktion des Steinkohlenbergbaus positiv beeinflußt hat, da für das Massengut Kohle der Transport über weitere Entfernung rentabler40 und damit neue Absatzmärkte (s.Tab.5) erschlossen wurden41. Dies besagt auch die These von SCHLIEPHAKE, der den Transport als Kostenfaktor und die Absatzreichweite eines produzierten Gutes in Abhängigkeit von dessen Preis und damit u.a. auch vom Kostenfaktor Tranport sieht.42
Tab.3:Transportpreise für Kohle in Preußen pro Tonnenkilometer43
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Man erkennt einen Rückgang der Transporttarife für Kohle auf ein Dreißigstel binnen 40 Jahren. Tabelle 4 soll veranschaulichen, wie Eisenbahnnetz, Transportvolumen und Kohlentransport sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten.
Tab. 4:Kapazität der Eisenbahnen und Nutzung durch Kohlentransport44 45 46 47 48 49
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5 von FREMDLING soll belegen, das der Eisenbahntransport deutscher Stein- kohle es ermöglichte, die englische auf den deutschen Kohlenmärkten ( hier der Berliner Kohlenmarkt ) zu substituieren (Vgl. auch Tab.2).
Tab.5 a-c:Berliner Kohlenmarkt nach Herkunft und Transportweg:50
a)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
b)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2. Rückwärtskoppelungseffekte
„Die Rückwärtskopplungseffekte eines Führungssektors regen das Wachstum der Branchen, welche für diesen Sektor erforderliche Inputs bereitstellen, an.“51 Neben der Rolle als kostengünstiges Transportmedium kam dem wachsenden Eisenbahnsektor auch die Rolle des Konsumenten von Steinkohle zu, denn die dampfbetriebenen Eisenbahnen jener Zeit wurden mit Kohle gefeuert. In den 1840er Jahren verkaufte der Bergbau praktisch keine Kohle an die Eisenbahnen, aber in den 1850ern waren es bereits rund 2 % und im folgenden Jahrzehnt rund 3 % des gesamten Kohlenabsatzes52 und 1912 waren es 12,62 % (nur bezogen auf den Ruhrkohlenanteil)53. Darüber hinaus waren die Eisenbahnen auch Abnehmer vieler Erzeugnisse (Lokomotiven, Schienen, Waggons) der eisenverarbeitenden Industrie (s. Tab.6). So verkaufte die eisenverarbeitende Industrie in den 1840ern 32 %, in den 1850ern 36 % und in den 1860ern 27 %54 ihrer Produktion an die Eisenbahnen, bei gleichzeitiger
Produktionssteigerung der Hochofenindustrie von 111.600 t (1840) auf 1.017.000 t (1870)55. Diese wiederum fragte auch Kohle und Koks nach (1912 gingen 43,24 % der Ruhrkohle an die Eisen- und Stahlindustrie56), so daß man auch hier von Rück- koppelungseffekten der Eisenbahn auf den Bergbau sprechen könnte. Wie eng verzahnt Eisenbahn-, Eisen- & Stahl- sowie Bergbausektor während der Industrialisierung waren, verdeutlicht folgender Auszug aus einer Festschrift desBochumer Vereins:
„An dieser Stelle sei auch die endgültige Einfügung der Gußstahlfabrik in das Eisenbahnnetz des Bezirks erwähnt, weil eine allen Anforderungen entsprechende Bahnverbindung ebenfalls eine Grundvoraussetzung für den geregelten Ablauf des Produktionsprozesses bildete. 1867 war der erste Anschluß an die Linie[...] der Bergisch-Märkischen Bahn geschaffen worden. Seither haben die Bahntransporte durch Angliederung der Zeche und mit der Zunahme der Stahlproduktion eine erhebliche Vermehrung erfahren [...]. So kam [...] 1874 ein zweiter Anschluß an die Rheinische Bahn zustande [...]. In gleicher Weise wurde mit [der werkseigenen, d.Verf.] Zeche Anna Maria verfahren; 1877 erhielt auch sie zu ihrem bisherigen Anschluß [...] einen weiteren [...]. Der Bahnbetrieb innerhalb des Werkes selbst erfuhr mit der Erweiterung der Produktionsanlagen einen fortgesetzten Ausbau.
1879 betrug die Länge der Gleise der Gußstahlfabrik [...] und der Zeche bereits 15 km Normalspur und 8 km Schmalspur. 15 Lokomotiven vermittelten den Transport [...].“57
Wie sich nun der Bergbau infolge des durch die Eisenbahn via Koppelungseffekte iniziierten Booms nach 1850 mit zunehmender Eisenbahnkapazität entwickelte, sei kurz anhand einiger Zahlen dargestellt:
Tab.6: Der Ruhrbergbau in Zahlen von 1850-195058
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.7:Entwicklung der Steinkohlenförderung, des Kohlentransports per Bahn und des Roheisenverbrauchs der Eisenbahnen59 60 61 62
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Erhöhung der Förderung liegen unter anderem entscheidende technische Verbesserungen im Tiefbau und Änderungen im Bergrecht zugrunde, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
5. Zusammenfassung
Zu Beginn dieser Arbeit wurde der Anspruch erhoben, die Koppelungsffekte der Eisenbahn in bezug auf den Bergabau insbesondere im Ruhrgebiet zu beschreiben und zu belegen. Dies ist nicht in aller Ausführlichkeit geschehen, aber dennoch ist die These, daß die Eisenbahnexpansion den Bergbau via Koppelungseffekte positiv beeinflußte, anhand der aufgeführten Statistiken belegt. Da TILLY, HOLTFRERICH und FREMDLING dieses Thema bereits ausführlich in der wissenschaftlichen Literatur behandelten (s. Literaturverzeichnis), kann man die (Sekundär-) Quellenlage als gut bezeichnen. Vergleicht man die drei genannten Autoren, so stellt man fest, daß sie einhelliger Meinung in ihrer Beurteilung der Relationen zwischen Bergbau und
Eisenbahnexpansion in Deutschland sind. Alle sehen sie in der Eisenbahn den das Wachstum iniziierenden Führungssektor63. Auch sind sich alle Autoren einig darüber, daß Bergbau und Eisenindustrie eine außerordentliche Bedeutung erlangten, aber nicht die der Eisenbahn erreichten. Für den hier besonders in Betracht gezogenen Raum des Ruhrgebiets stellt neben den genannten Autoren insbesondere WIEL umfangreiches
Material bezüglich der ökonomischen Zusammenhänge bereit, so daß die Aussagen der oben genannten drei Autoren problemlos auch für das Ruhrgebiet belegbar sind.
Anhang:
Literaturverzeichnis:
- ABELSHAUSER, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte im Industriezeitalter – Konjunktur, Kriese, Wachstum; Düsseldorf 1981
- DÄBRITZ, Walther: Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum. Neun Jahrzehnte seiner Geschichte im Rahmen der Wirtschaft des Ruhrgebietes; Düsseldorf 1934
- ESCHWEILER BERGWERKSVEREIN (Hg.): Vor Ort. Geschichte und Geschichten eines Bergabauunternehmens im Aachener Revier; Herzogenrath 1992
- FREMDLING, Reiner: Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Deitschland; Berlin 1986
- FREMDLING, Reiner: Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879. Ein Beitrag zur Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur (Untersuchungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, Bd. 2). Dortmund 1975
- HOFFMANN, W.G.: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts; Berlin 1965
- HERMANN, Wilhelm et al.: Die alten Zechen an der Ruhr; 3. überarbeitete Auflage, Königstein/Taunus 1990
- BRANDI (ohne Vornamen) und JÜNGST, E.: Das Ruhrrevier – in: FACHGRUPPE BERGBAU DES REICHSVERBANDES DER DEUTSCHEN INDUSTRIE (Hg.): Die deutsche Bergwirtschaft der Gegenwart. Festgabe zum deutschen Bergmannstag 1928; Berlin 1928; S.36-56
- HOLTFRERICH, Carl-L.: Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlenbergbaus im 19. Jahrhundert; Dortmund 1973
- KERSTING, Ruth und PONTHÖFER, Lore: Wirtschaftsraum Ruhrgebiet (Seydlitz); Berlin 1990
- MAIER, Jörg und ATZKERN, Heinz-Dieter: Verkehrsgeographie (Teubner Studienbücher Geographie); Stuttgart 1992
- SCHUNDER, Friedrich: Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus; Essen 1968
- TILLY, Richard H.: Vom Zollverein zum Industriestaat – Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914; München 1990
- WIEL, Paul.: Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes. Tatsachen und Zahlen; Essen 1970
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis:
Tab.1: Der Ruhrbergbau in Zahlen von 1792 bis 1850 (S. 5)
Tab.2: Berliner Kohlenmarkt nach Herkunft und Transportweg (S. 6) Tab.3: Transportpreise für Kohle in Preußen pro Tonnenkilometer (S. 9)
Tab. 4: Kapazität der Eisenbahnen und Nutzung durch Kohlentransport (S. 9) Tab.5 a-c: Berliner Kohlenmarkt nach Herkunft und Transportweg (S. 10) Tab.6: Der Ruhrbergbau in Zahlen von 1850 bis 1950 (S. 11)
Tab.7: Entwicklung des Steinkohlenförderung, des Kohlentransports per Bahn und des Roheisenverbrauchs der Eisenbahnen (S. 12)
Versicherung:
Ich, Michael Birklein (Matrikel-Nr: 209925), versichere hiermit, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, sind nach bestem Wissen und Gewissen als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form von mir noch nicht als Prüfungsarbeit eingereicht worden.
Kerkrade/NL, den 1.08.1999
[...]
1 Vgl. TILLY, Richard H.: Vom Zollverein zum Industriestaat – Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914; München 1990; S.50-58, S.214-216 – im Folgenden abgekürzt: TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“
2 Vgl. u.a. HOLTFRERICH, Carl-L.: Kohle, Stahl und Eisenbahnen. Verflechtungsstrukturen im deutschen Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts; in: ABELSHAUSER, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte im Industriezeitalter – Konjunktur, Kriese, Wachstum; Düsseldorf 1981; S.
3 Vgl. u.a. FREMDLING, Reiner: Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879. Ein Beitrag zur Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur (Untersuchungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, Bd. 2). Dortmund 1975 – im Folgenden abgekürzt: FREMDLING,R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachtum“
4 Vgl. HERMANN, Wilhelm et al.: Die alten Zechen an der Ruhr; 3. überarbeitete Auflage, Königstein/Taunus 1990, S.10-48 – im Folgenden abgekürzt: HERMANN,W.: „Ruhrzechen“
5 Vgl. BRANDI et al.: Das Ruhrrevier – in: Fachgruppe Bergbau des Reichsverbandes der deutschen Industrie (Hg.): Die deutsche Bergwirtschaft der Gegenwart; Berlin 1928 – im Folgenden abgekürzt: BRANDI et al.: „Ruhrrevier“
6 Vgl. HERMANN, W.: „Ruhrzechen“ , a.a.O., S. 26
7 ebd., S.10
8 Vgl. ebd.
9 Vgl. ebd.; S. 48-55
10 Vgl. ebd., S.50f. und 149. beurkundet ist der Pachtvertrag zwischen dem Essener BürgerHerrmann Borchardund den drei BrüdernStrunckedezum Bergbau nach Steinkohle durch die Zuletztgenannten auf dem Land des Erstgenannten.
11 Vgl. HERMANN, W.: „Ruhrzechen“; a.a.O., S.27
12 Vgl.ebd. ; a.a.O.; S. 137-301. Zum Vergleich seien hier aufgeführt: Sch.Zuversicht, Z.Storksbank, Bochum-Wattenscheid: Um 1785 bis 19 m Teufe; Sch.Ephorus, Z.Glückaufsegen, Dortmund: 1840/41 bis ca. 70 m Teufe; Sch.Waldhausen, Z.Ver. Sälzer & Neuack, Essen: ab 1819 bis auf 97 m geteuft; dagegen im Aachener Revier: Sch. 1 und 2, Z.Furth, Bardenberg, 1771 64 m bzw. 100 m Teuftiefe; „Zu dieser Zeit (1814, der Verf.) betrug die mittlere Schachtteufe an Wurm und Inde 70 bis 80 m. Die tiefsten Baue [...] 200 m [...].“ SCHUNDER, Friedrich: Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus; Essen 1968, S.69 und S. 117
13 Vgl. HERMANN, W.: „Ruhrzechen“; a.a.O.; S.149
14 Vgl. ESCHWEILER BERGWERKSVEREIN (Hg.): Vor Ort. Geschichte und Geschichten eines Bergabauunternehmens im Aachener Revier; Herzogenrath 1992; S.15
15 Vgl. ebd., S.14 –16 Vgl außerdem: SCHUNDER, F.: Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus; a.a.O., S.69 und S.98
16 Vgl. KERSTING Ruth et al.: Wirtschaftsraum Ruhrgebiet (Seydlitz); Berlin 1990; S.18 f.
17 Vgl. BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.48
18 Vgl. WIEL P.: Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes. Tatsachen und Zahlen; Essen 1970; S.27 ff. – Im Folgenden abgekürzt: WIEL P.: „Wirtschaftsgeschichte“
19 Vgl. BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S. 37
20 Vgl. KERSTING Ruth et al.: Wirtschaftsraum Ruhrgebiet (Seydlitz); Berlin 1990; S.22
21 Quelle der Zahlen: WIEL P.: „Wirtschaftsgeschichte“; a.a.O.; S.128-129
22 Vgl. MAIER, J. et al.: Verkehrsgeographie (Teubner Studienbücher Geographie); Stuttgart 1992; S.39
23 Vgl. KERSTING Ruth et al.: Wirtschaftsraum Ruhrgebiet (Seydlitz); Berlin 1990; S. 36
24 Vgl. ebd.
25 Vgl. FREMDLING,R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachstum“; a.a.O. ; S.61ff.
26 Quelle der Zahlen: FREMDLING,R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachstum“; a.a.O. ; S.62f.
27 Vgl. TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“; a.a.O.; S. 216. Und vgl. HOLTFRERICH, C.-L.: Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlenbergbaus im 19. Jahrhundert; Dortmund 1973; S.136f.
28 Vgl. WIEL, P.: „Wirtschaftsgeschichte“; a.a.O.; S.357
29 Vgl. ebd.
30 Vgl. ebd.; S.358
31 Vgl. ebd.
32 TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“; a.a.O.; S.50f.
33 Vgl. WIEL, P.: „Wirtschaftsgeschichte“; a.a.O.; S.358
34 BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.46
35 Vgl. TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“; a.a.O.; S.51
36 Vgl. FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachtum“; a.a.O.; S.83
37 TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“; a.a.O.; S.51
38 Vgl. FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachstum“; a.a.O.; S.87
39 Vgl. HOLTFRERICH, C.-L.: .: Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlenbergbaus im 19. Jahrhundert; Dortmund 1973; S.136f.
40 Vgl. FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachstum“; a.a.O. ; S.69-72
41 Vgl. ebd.; S.62-67
42 Vgl. MAIER, J. et al.: Verkehrsgeographie (Teubner Studienbücher Geographie); Stuttgart 1992; S.39
43 Quelle der Zahlen: a)TILLY, R.: „Vom Zollverein zum Industriestaat“; a.a.O.; S.216
b) HOLTFRERICH,C.-L.: Quantitative Wirtschaftsgeschichte des Ruhrkohlenbergbaus im 19. Jahrhundert; Dortmund 1973; S.136f.
44 Quelle der Zahlen: BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.46
45 Quelle der Zahlen: ebd.
46 Quelle der Zahlen: FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachtum“; a.a.O. ; S.72
47 Quelle der Zahlen: ebd.; S.69
48 Quelle der Zahlen: ebd.; S.86
49 Quelle der Zahlen: HOFFMANN, W.G.: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts; Berlin 1965; S.417
50 Quelle der Zahlen: FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachtum“; a.a.O. ; S.62f.
51 ebd.; S.74
52 Vgl. FREMDLING, R.: Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Deitschland; Berlin 1986; S.336
53 BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.46
54 BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.46
55 Vgl. FREMDLING, R.: Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Deitschland; Berlin 1986; S.338
56 BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.46
57 DÄBRITZ, W.: Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum. Neun Jahrzehnte seiner Geschichte im Rahmen der Wirtschaft des Ruhrgebietes; Düsseldorf 1934; S.170
58 Quelle der Zahlen: WIEL, P.: „Wirtschaftsgeschichte“; a.a.O.; S.128 ff.
59 Quelle der Zahlen: BRANDI et al.: „Ruhrrevier“; a.a.O.; S.37
60 Quelle der Zahlen: HOFFMANN, W.G.: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts; Berlin 1965, S.417
61 Quelle der Zahlen: FREMDLING, R.: „Eisenbahn & Wirtschaftswachtum“; a.a.O.; S.72
62 Quelle der Zahlen: ebd.; S.80
Häufig gestellte Fragen zum Ruhrbergbau und Eisenbahnen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text untersucht die Koppelungseffekte zwischen Eisenbahnen und Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet während der Industrialisierung in Deutschland. Dabei werden sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtskoppelungseffekte betrachtet.
Welche Rolle spielte der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet vor dem Aufkommen der Eisenbahn?
Vor dem Bau der Eisenbahnen konzentrierte sich der Steinkohlenbergbau hauptsächlich auf das Ruhrrevier. Der Abbau erfolgte in kleinen Zechen, und die Kohle wurde hauptsächlich für den Hausbrand und das Schmiede- und Metallhandwerk in der unmittelbaren Umgebung verwendet. Der Transport über weitere Entfernungen war aufgrund der hohen Kosten und der mangelnden Transportkapazität begrenzt.
Wie hat sich der Transport von Kohle vor 1847 gestaltet?
Vor 1847 erfolgte der Transport von Kohle hauptsächlich über Flüsse und unbefestigte Straßen. Die Schiffbarkeit der Ruhr war wichtig, aber durch Schleusen und wechselnde Wasserstände eingeschränkt. Fuhrwerke waren oft unpassierbar, und ein erheblicher Teil der Kohle wurde auf dem Rücken von Tragpferden transportiert.
Welche Bedeutung hatte die Entwicklung des Eisenbahnnetzes für das Ruhrgebiet?
Die Erschließung des Ruhrgebiets durch die Eisenbahn ab 1847 ermöglichte einen kostengünstigeren und schnelleren Transport von Kohle in weiter entfernte Absatzmärkte. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Kohleförderung und trug zur Entwicklung des Ruhrgebiets zu einem bedeutenden Industriezentrum bei.
Was sind Vorwärtskoppelungseffekte im Zusammenhang mit Eisenbahn und Bergbau?
Vorwärtskoppelungseffekte beziehen sich auf die positiven Auswirkungen der Eisenbahn auf den Bergbau, indem sie die Transportkapazität erhöht und die Transportpreise senkt. Dies ermöglichte den Bergbauunternehmen, ihre Produktion zu steigern und neue Absatzmärkte zu erschließen.
Was sind Rückwärtskoppelungseffekte im Zusammenhang mit Eisenbahn und Bergbau?
Rückwärtskoppelungseffekte beschreiben die Nachfrage der Eisenbahn nach Kohle und anderen Produkten des Bergbaus und der eisenverarbeitenden Industrie. Die Eisenbahn war ein bedeutender Abnehmer von Kohle für den Betrieb von Dampflokomotiven und von Eisenprodukten für den Bau von Lokomotiven, Schienen und Waggons.
Wie hat sich die Kohleförderung im Ruhrgebiet nach dem Bau der Eisenbahn entwickelt?
Nach dem Bau der Eisenbahn erlebte der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet einen erheblichen Aufschwung. Die Förderung stieg deutlich an, und es entstanden größere Zechen. Technische Verbesserungen im Tiefbau und Änderungen im Bergrecht trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.
Welche Rolle spielte der Berliner Kohlenmarkt in Bezug auf englische und deutsche Kohle?
Der Berliner Kohlenmarkt diente als Beispiel, um zu zeigen, wie der Eisenbahntransport deutscher Steinkohle es ermöglichte, die englische Kohle auf den deutschen Kohlenmärkten zu substituieren. Vor dem Ausbau des Eisenbahnnetzes dominierte oft die englische Kohle, da sie über den Seeweg kostengünstiger transportiert werden konnte.
Welche Wirtschaftshistoriker werden im Text erwähnt?
Im Text werden die Wirtschaftshistoriker TILLY, HOLTFRERICH und FREMDLING erwähnt, die sich ausführlich mit den Koppelungseffekten zwischen Eisenbahn und Bergbau auseinandergesetzt haben.
Welche Tabellen sind im Text enthalten?
Der Text enthält Tabellen zur Entwicklung des Ruhrbergbaus, der Transportpreise für Kohle, der Kapazität der Eisenbahnen, des Berliner Kohlenmarktes und der Steinkohlenförderung.
- Quote paper
- Michael Birklein (Author), 1999, Koppelungseffekte zwischen Eisenbahn und Bergbau; das Beispiel Ruhrgebiet, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100698