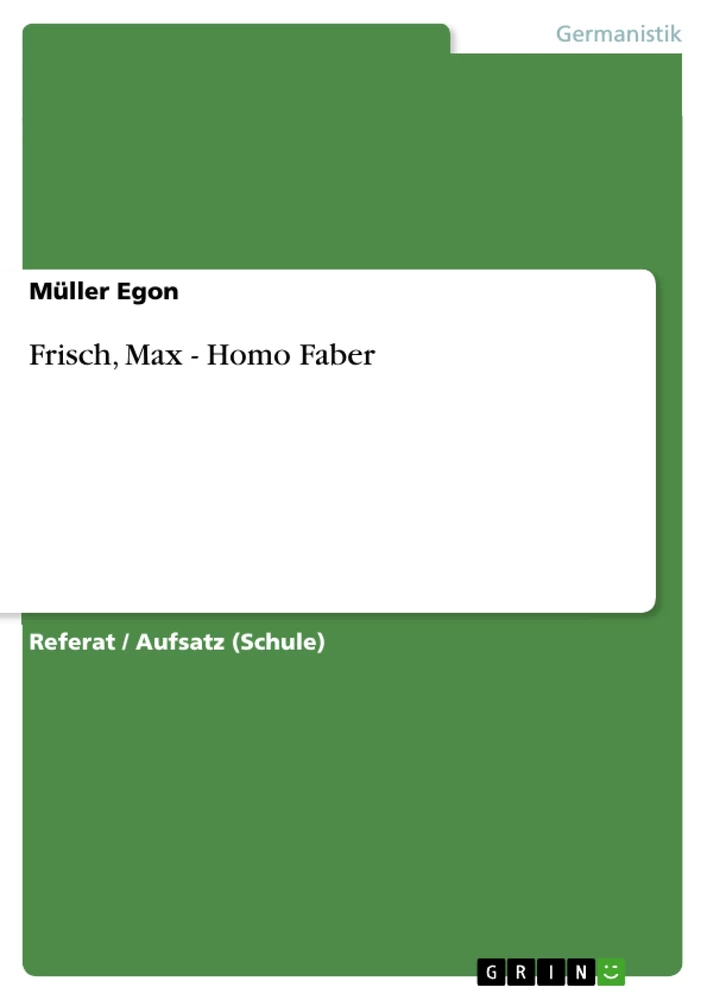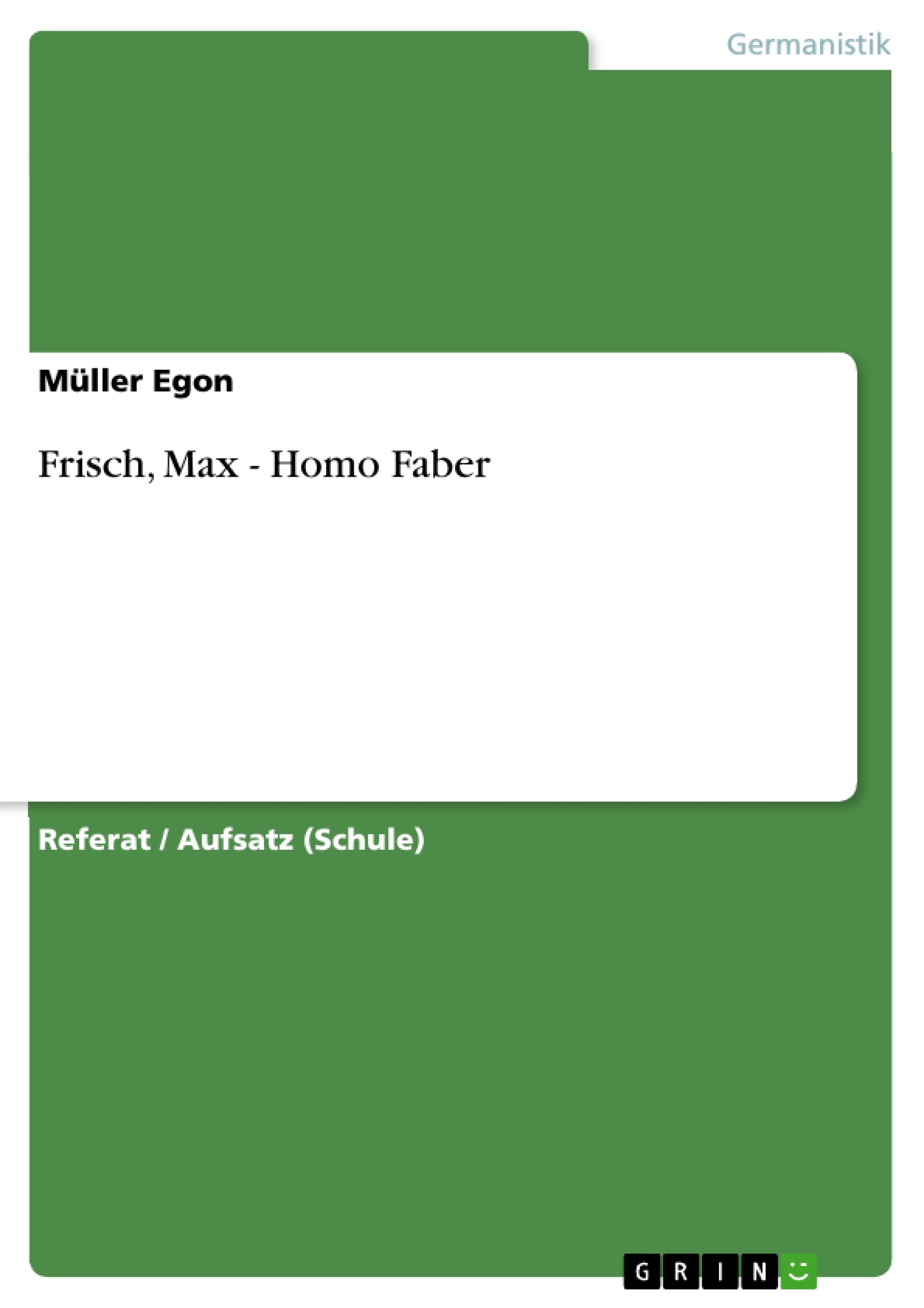MAX FRISCHàTechniker, zahlreiche Auslandsaufenthalte
- Am 15.Mai 1911 in Zürich als Sohn eines Architekten geboren
- 1924-1930 Realgymnasium in Zürich
- 1931-1933 Studium der Germanistik in Zürich aus Geldmangel abgebrochen
- als freier Journalist tätig (hauptsächlich Reiseberichte)
- 1936-1941 Studium der Architektur in Zürich; Diplom
- 1939-1941 Militärdienst als Kanonier
- 1942 Architekturbüro in Zürich
- 1946 Reise nach Deutschland, Italien, Frankreich
-1947 Die chinesische Mauer
- 1948 Reisen nach Prag, Berlin, Warschau
-Begegnung mit Bertold Brecht in Zürich
-1949 Als der Krieg zu Ende war
-1950 Tagebuch 1946-1949
-1951 GrafÖderland
-1952 Einjähriger Aufenthalt in den USA, Mexiko
-1953 Don Juan oder die Liebe zur Geometrie
-1954 Stiller
-Auflösung des Architekturbüros, freier Schriftsteller · 1955 Wilhelm Raabe Preis
- 1956 Reise nach USA, Mexiko, Kuba
-1957 Homo Faber
- Reise in die arabischen Staaten
-1958 Biedermann und die Brandstifter Die große Wut des Philip Hotz
- Georg Büchner Preis
Literaturpreis der Stadt Zürich
- 1960-1965 Wohnsitz in Rom
-1962 Andorra
-1964 Mein Name sei Gantenbein
-1965 Preis der Stadt Jerusalem
-Reise nach Israel
-Wohnsitz in Tessin (Schweiz)
-1966 Reise in die UDSSR, Polen
-1969 Aufenthalt in Japan
-1970 Aufenthalt in USA
-1971 Wilhelm Tell für die Schule
-1972 Tagebuch 1966-1971
1975 Montauk
-1982 Blaubart eine Erzählung
-1990 Verfilmung von HOMO FABER durch Volker Schlöndorff
- 4. April 1991 Tod in Zürich
Homo Faber Inhalt und Interpretation
Die Hauptgestalt des Buches ist Walter Faber, ein etwas 50-jähriger UNESCO-Ingenieur.
Auf einem Flug nach Guatemala lernt er einen jungen Deutschen, (Herbert) kennen, bei dem es sich um den Bruder seines Jugendfreundes Joachim handelt. Durch den Ausfall beider Flugzeugmotoren wird das Flugzeug zur Landung in der Wüste gezwungen, und im Laufe des 4- tägigen Aufenthaltes erfährt Faber, daß Joachim mit seiner früheren Verlobten Hanna verheiratet war, sie knapp dem Holocaust entkam und eine Tochter hat.
Entgegen seiner Gewohnheiten unterbricht Faber seine Reise und begleitet Herbert auf seiner Reise durch den Urwald, um Joachim wiederzusehen. Während der Reise erinnert sich Faber: Vor etwa 20 Jahren war Fabers Heirat mit Hanna, der späteren Frau Joachims, durch die kränkende Bemerkung seinerseits über das erwartete Kind unmöglich geworden (,,Dein Kind statt unser Kind").
Auf der Plantage angekommen, kann Faber nur noch Joachims Tod feststellen, er hat sich mit einem Draht erhängt.
Zurück in New York, bei seiner Geliebten Ivy, beendet Faber diese Beziehung und um sie so schnell wie möglich zu verlassen beschleunigt er die Abreise nach Europa indem er Flugangst vortäuscht, und eine Schiffspassage bucht.
Auf dem Schiff lernt er die wesentlich jüngere Sabeth kennen.
Es entwickelt sich eine Beziehung und er beschließt die zwanzigjährige Studentin auf ihrer Heimreise durch Italien nach Griechenland zu begleiten.
Sie erinnert ihn sehr an Hanna und schließlich erfährt er, daß sie tatsächlich die Tochter Hannas ist die, nachdem er sie verlassen hatte, ihren gemeinsamen Freund Joachim geheiratet hat: »Ich rechnete im stillen pausenlos, bis die Rechnung aufging, wie ich sie wollte: Sie konnte nur das Kind von Joachim sein! Wie ich's rechnete, weiß ich nicht; ich legte mir die Daten zurecht, bis die Rechnung wirklich stimmte, die Rechnung als solche.«
In Athen bestätigt ihm Hanna, was er im Grund längst schon wußte, sich aber nicht eingestehen wollte: Sabeth ist sein Kind. Zu Fabers Inzest kommt hinzu, daß die ahnungslose Tochter durch eine Verkettung unglückseliger Umstände, an denen aber Faber nicht ganz schuldlos ist, verunglückt. Kurz vor seinem Tode - Faber ahnt, daß seine Operation in Athen die Diagnose eines unheilbaren Magenkrebses ergeben wird - muß er erkennen, daß er das Leben seiner Tochter, sein eigenes Glück und das der Mutter vernichtet hat, ohne es zu wissen:
»Was ist denn meine Schuld?« Faber, der alles, was nicht berechenbar ist, als bedeutungslos denunziert, der Stimmungen, Liebe, Religion, Kunst nicht kennt, nicht wahrhaben will oder nur »wissenschaftlich« erklärt und abtut, muß erfahren, daß seine technologische Weltorientierung nicht ausreicht, um menschlicher Schuld und schicksalhaftem Verhängnis zu entgehen. Nach dem Tod Sabeths ahnt er, der moderne Ödipus, daß er schuldig geworden ist; jedoch bleibt ihm unverständlich, was Hanna, die ihn einst »homo faber« nannte, mit der Äußerung meint, daß alles kein zufälliger Irrtum gewesen sei, sondern ein Irrtum, der zu ihm gehöre wie sein Beruf, wie sein ganzes Leben:
Interpretation:
Obwohl Faber sehen kann, handelt er blind. Bei ihm ist dieses geradezu bis zur Existenzblindheit erweitert.
Der Techniker Walter Faber ist Rationalist und mit phantasielosen, nüchternen, auch arroganten, egozentrischen Zügen ausgestattet. Für ihn existieren nur Mathematik und Technik, er strebt nach einer geplanten Welt. Für ihn gibt es nichts Unerklärliches, die Existenz von Fügung wird abgelehnt. Der nichttechnischen Welt gegenüber bringt er nur Unverständnis und Geringschätzung auf. Stimmungen und Gefühle laufen Fabers rationalistischem Weltbild zuwider. Er hält sie für Ermüdungserscheinungen. Die Welt ist für ihn vom Menschen geschaffen, sie wird steril und sauber gehalten.
Frisch verdeutlicht in seinem Buch, daß Leben nicht mit Technik zu bewältigen ist und übt Kritik am absoluten praktischem Denken.
Rezension zum Film ,,Homo faber"
Klischheehafte Romanze in Farbe
Die Verfilmung von Max Frischs zeitlosen Roman ,,Homo faber" von dem Regisseur Volker Schlöndorff erweckt leicht den falschen Eindruck, daß das Hauptthema von einer romantischen Liebesbeziehung zwischen Walter Faber, gespielt von Sam Shepard, und Sabeth, gespielt von Julie Delpy, handelt. Der mit Hanna tanzende Faber wirkt lächerlich und langweilig. Sein konservatives, klischeefaftes deutsches Äußeres, mit dem grau-braunen Anzug und der dicken Brille stellt zwar glaubwürdig die Modewelt eines Technikers wie Faber, dar, doch läßt die schauspielerische Leistung von dem häufig monoton sprechenden Sam Shepard, der Faber oftmals zu kalt und zu lässig darstellt, zu wünschen übrig.
Julie Delpy dagegen, die schon in dem Film Hitlers Junge, eindrucksvoll die Freundin des Jungen spielte, in dem Liebesfilm `Before Sunrise' mit Ethan Hawke an der Seite ihr schauspielerisches Talent gezeigt hat und hier nun Sabeth darstellt, überzeugt mit Pferdeschwanz durch ihr lebenslustiges, unbeschwertes und unschuldig wirkendes Auftreten.
Die gestellt wirkenden Schauplätze, die leider auch nicht von der langgestreckten Szenerie ablenken können, haben manchmal die Wirkung einer Tragikomödie. Der 133 Minuten lange Film zeigt nicht alle Szenen auf, die das Buch enthält. Durch diese unpassende Kürzung der Szenerie, die durch ein schnelles Szenewechseln noch zusätzlich bestärkt wird, ist es schwierig, sich im Dschungel der Schauplätze zu orientieren, sodaß das Verständnis nicht immer eindeutig ist. Durch das Fehlen der Dschungelrückreise Fabers kann sich der Zuschauer des Films wohl schlecht die Abneigung Fabers vor der Natur vor Augen halten und resultierend die Veränderung Fabers in ihren Einzelheiten nicht erkennen. Der Zuschauer wird nach Fabers Veränderung schließlich nur mit gestellten leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen konfrontiert, die den langwierigen Film nur noch abrunden.
Durch das Überleben Fabers entfernt sich der Film am Ende ganz vom Buch und läßt den Zuschauer, der wohl froh ist das Buch vor dem Film gelesen zu haben, aufatmen.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Max Frisch?
Max Frisch war ein Schweizer Architekt und Schriftsteller, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich und gestorben am 4. April 1991 ebendort. Er studierte Architektur, war als Journalist tätig und unternahm zahlreiche Auslandsreisen.
Welche Werke von Max Frisch werden in dem Text erwähnt?
Der Text erwähnt unter anderem Die chinesische Mauer, Als der Krieg zu Ende war, Tagebuch 1946-1949, Graf Öderland, Don Juan oder die Liebe zur Geometrie, Stiller, Homo Faber, Biedermann und die Brandstifter, Die große Wut des Philip Hotz, Andorra, Mein Name sei Gantenbein, Wilhelm Tell für die Schule, Tagebuch 1966-1971, Montauk, und Blaubart eine Erzählung.
Worum geht es in Homo Faber?
Homo Faber handelt von Walter Faber, einem UNESCO-Ingenieur, der auf einer Reise unerwartete Verbindungen zu seiner Vergangenheit entdeckt. Er lernt Herbert kennen, den Bruder seines Jugendfreundes Joachim, und verliebt sich in Sabeth, die sich später als seine Tochter herausstellt. Die Geschichte thematisiert Fabers rationalistische Weltanschauung und dessen Unfähigkeit, Emotionen und Zufälle zu akzeptieren, was zu tragischen Konsequenzen führt.
Wer ist Walter Faber?
Walter Faber ist die Hauptfigur in Max Frischs Roman Homo Faber. Er ist ein UNESCO-Ingenieur, der ein rationalistisches Weltbild vertritt und Technik über Emotionen stellt. Im Laufe der Geschichte wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss die Grenzen seiner Weltanschauung erkennen.
Was ist Fabers Schuld?
Fabers Schuld liegt darin, dass er durch seine rationalistische und berechnende Lebensweise blind für die emotionalen Bedürfnisse anderer und die unvorhersehbaren Wendungen des Lebens ist. Dies führt zu Inzest und letztendlich zum Tod seiner Tochter Sabeth. Er erkennt zu spät, dass seine Weltanschauung nicht ausreicht, um menschliche Beziehungen und Schicksal zu verstehen.
Wie wird die Verfilmung von Homo Faber kritisiert?
Die Verfilmung von Volker Schlöndorff wird als klischeehaft und wenig überzeugend kritisiert. Sam Shepards Darstellung von Walter Faber wird als zu kalt und lässig empfunden. Die gestellten Schauplätze und die Kürzungen der Szenerie erschweren das Verständnis der Geschichte. Das Fehlen wichtiger Szenen, wie Fabers Rückreise durch den Dschungel, führen dazu, dass die Veränderung Fabers nicht ausreichend dargestellt wird. Das Ende des Films weicht vom Buch ab.
Was kritisiert Max Frisch in Homo Faber?
Max Frisch kritisiert in Homo Faber das absolute Vertrauen in Technik und Rationalität, sowie die daraus resultierende Blindheit für Emotionen, Zufälle und die komplexen Aspekte des menschlichen Lebens. Er verdeutlicht, dass das Leben nicht allein mit Technik zu bewältigen ist und übt Kritik am rein praktischen Denken.
- Arbeit zitieren
- Müller Egon (Autor:in), 1992, Frisch, Max - Homo Faber, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100663