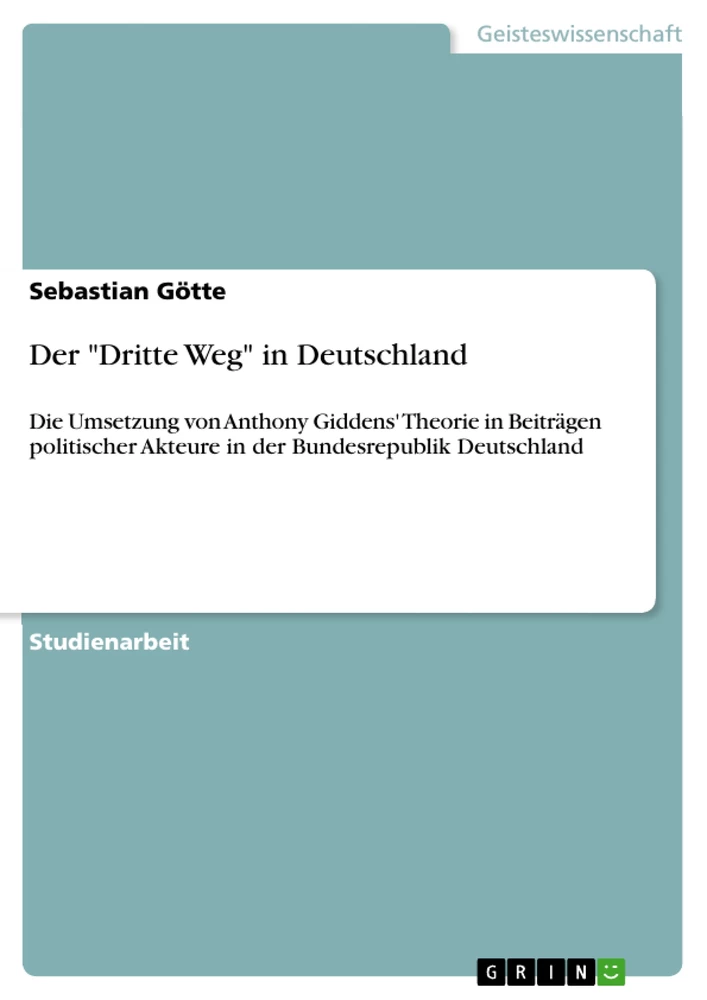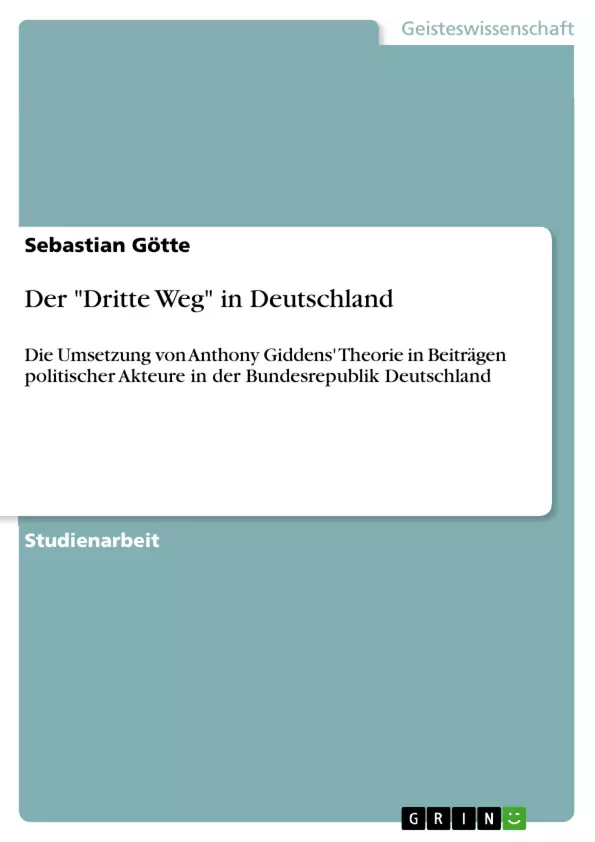Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort – Die Theorie des „Dritten Weges“
2. Reform der Wirtschaft – Die „Kultur der Selbständigkeit“
2.1. Tertiarisierung
2.2. Flexibilisierung
2.3. Globalisierung
3. Reform der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik – „Trampolin“ und „Bürgergeld“
3.1. Die Krise des Sozialstaates
3.2. Senkung der Arbeitslosigkeit
4. Reform der Umweltpolitik – „ökologische Steuerreform“
5. Der „Dritte Weg“ in Deutschland – was bleibt übrig?
6. Literaturverzeichnis
1. Vorwort – Die Theorie des „Dritten Weges“
„Meiner Ansicht nach kann die Sozialdemokratie nicht nur überleben, sondern sogar prosperieren, und zwar auf theoretischer wie auf praktisch- politischer Ebene. Das wird ihr aber nur gelingen, wenn sie bereit ist, ihre überkommenen Ansichten grundsätzlicher in Frage zu stellen, als sie dies
in den meisten Fällen bisher getan hat. Sie muß einen neuen dritten Weg finden.“
(Giddens 1999, S. 7)
Am Ende des 20. Jahrhunderts scheint es so, als ob die Gesellschaft mit ihren traditionellen Politikoptionen „rechts“ (also konservativ und neoliberal) und „links“ (sozial und regelungsfreudig) keine ausreichenden Lösungskompetenzen für ihre Probleme bereitstellen kann. Folgerichtig sind Theoretiker aller Art am Werk, einen Ausweg jenseits dieser alten Strukturen zu schaffen. Anthony Giddens ist mit seiner Idee des „Dritten Weges“ in der letzten Zeit am stärksten beachtet und auch instrumentalisiert worden.
In seinem Theorieansatz einer reflexiven Veränderung der Gesellschaft versucht Giddens, die alten Trennungslinien von Staat und Bevölkerung sowie „rechts“ und „links“ zu überwinden und eine „radikal-demokratische Mitte“ in einem „neue[n] demokratische[n] Staat“ zu schaffen (Giddens 1999, Textbox S. 86). Die Werte seines Dritten Weges sind vor allem „Gleichheit“, die „Freiheit als selbstbestimmtes Handeln“ und demokratische Entscheidungsverfahren (ebd., Textbox S. 82). Um das Regelungsmonopol des Staates zu brechen, fordert Giddens „eine aktive Zivilgesellschaft“ (ebd., Textbox S. 86), die sich durch
„ein hohes Maß an Selbstorganisation“ auszeichnet (ebd., S.96). Des weiteren schlägt er vor, neben der traditionellen Fixierung auf die Erwerbstätigkeit zunehmend andere Formen der gemeinnützigen Beschäftigung zu fördern, da nur so der steigenden Zahl von Nicht- Erwerbstätigen Möglichkeiten der Neuidentifikation geboten werden können.1In jedem Fall soll den Bürgern der Gesellschaft mehr Eigenverantwortung zugetraut werden, ohne dass sie jedoch völlig auf sich allein gestellt werden. Giddens nennt dies eine
„’verantwortungsbewußte Übernahme von Risiken’“ (ebd., S. 118) und fordert gleichzeitig den Schutz der Menschen in Krisensituationen. Mit diesen Gedanken formuliert er eine äußerst voraussetzungsvolle Veränderungstheorie, die in ihrer Gesamtheit auf mittlere Sicht wohl kaum in die Praxis umgesetzt werden kann.
Die rot-grüne Bundesregierung in Deutschland hat sich zumindest nominell einer Politik des Dritten Weges verschrieben. Ziel dieses Referates ist es, Beiträge einzelner politisch Verantwortlicher zur Reform von Politik und Gesellschaft auf Elemente des Dritten Weges Giddens’ zu untersuchen. Dabei konzentriert sich die Analyse auf die drei zur Zeit wohl wichtigsten Themenkomplexe: die Wirtschaft, die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie die Umwelt. Als Untersuchungsobjekte wurden Bücher von Joschka Fischer (B’90 / Grüne), Bodo Hombach (SPD), Hubert Kleinert (B’90 / Grüne) und Siegmar Mosdorf (SPD) sowie der
Zukunftskommission der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ausgewählt.2Zunächst werden daraus die wichtigsten Gedanken zu den einzelnen Themenkomplexen kurz erläutert und im letzten Kapitel ein Resümee gezogen, inwieweit Gedanken von Giddens’ Theorie auch in Deutschland umgesetzt werden.
2. Reform der Wirtschaft – Die „Kultur der Selbständigkeit“
„Geförderte Zeitarbeit, intelligente Arbeitszeitmodelle, Anreize zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen in wettbewerbsfähigen Branchen und eine stärker an den Erfordernissen des Strukturwandels orientierte Weiterbildungsoffensive
– Brücken, nicht Krücken muß der Staat bieten.“(Hombach 1998, S.70)
Die derzeitige Lage der Wirtschaft ist in allen „westlichen Industrieländern“ gekennzeichnet durch drei Faktoren. Man kann diese bezeichnen als Tertiarisierung, Flexibilisierung und Globalisierung. Jeder dieser drei Prozesse birgt sowohl Probleme als auch Chancen in sich, die in der Diskussion um den Dritten Weg in Deutschland auch kontrovers diskutiert werden. Im folgenden werden die wichtigsten Punkte dieser Diskussion dargestellt.
2.1. Tertiarisierung
Seit einigen Jahren findet in der Wirtschaft der „westlichen Industriestaaten“ ein neuer Wandlungsprozess statt. Das Wachstum im Produktionssektor stagniert und Arbeitsplätze werden zunehmend abgebaut. Vorreiter dafür sind vor allem große Unternehmen und der öffentliche Dienst. Die Leidtragenden dieses Stellenabbaus sind meist niedrigqualifizierte Arbeitnehmer, da ihre Tätigkeiten leicht und billig automatisiert werden können bzw. konnten.
Im Gegensatz dazu konnte der Dienstleistungssektor (auch „tertiärer Sektor“ genannt) starke Wachstumsraten verbuchen.3Bedingt durch die spezifischen Tätigkeitsprofile in diesem Sektor verlangen die Arbeitsplätze dort in der Regel wenig Vorkenntnisse und wären somit ein idealer Ersatz für die in der Industrie gekürzten Stellen. Das große Problem des tertiären Sektors ist allerdings, dass für diese niedrigqualifizierten Tätigkeiten auch nur Niedriglöhne gezahlt werden können, da sie wenig produktiv sind.
Die Lösungen, die hierfür angeboten werden, sind vielfältig, entspringen aber nicht unbedingt aus dem Gedankengut der Theorie des Dritten Weges. Sie reichen vom Bürgergeld bis zur Senkung der Sozialbeiträge und werden im dritten Kapitel über die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik näher erläutert.
unternehmen 14 Prozent. Seit 1995 hat sich das Verhältnis in Gesamtdeutschland umgekehrt: nunmehr beträgt der Anteil der Dienstleistungsunternehmen 36 Prozent, der des produzierenden Gewerbes 35 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung.“ (Fischer 1998, S. 300 Fußnote 107)
2.2. Flexibilisierung
Ein zweiter Wandlungsprozess, der zum Teil auch mit der Tertiarisierung zusammenhängt, ist die Flexibilisierung der Arbeit. Die veränderten wirtschaftlichen Anforderungen der letzten Jahre haben es nötig gemacht, dass die einstmals geregelten Arbeitszeiten heute zunehmend keine Geltung mehr besitzen. Statt der bekannten 40- Stunden-Jobs („Normarbeitsplätze“) werden sowohl die Zahl Arbeitsstunden als auch der Zeitpunkt der Arbeit den betrieblichen Erfordernissen angepasst. Da sich die Wirtschaft bis heute fast vollständig vom Tagesrhythmus abgelöst hat und 24 Stunden täglich „in Betrieb“ ist (unter anderem eine Folge der Globalisierung), erfordert dies wesentlich flexiblere Jobs als bisher.4Die Gewinner dieser Entwicklung sind offenbar kleine innovative und flexible Firmen, die in ihren Strukturen noch nicht stark gefestigt sind und die Möglichkeit besitzen, schnell zu reagieren. Ihnen gehört damit zumindest ein Teil der Zukunft.
In diese Richtung argumentieren auch die Vertreter des Dritten Weges in Deutschland. Joschka Fischer fordert zum Beispiel in seinem Buch die Flexibilisierung der Arbeitsmarktregelungen (Fischer 1998, S. 189ff). Die bisherigen Festlegungen sollten seiner Meinung nach gelockert und somit der Weg für neue Arbeitsformen geebnet werden. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass man nicht über das Ziel hinausschießt und zu einer Nicht-Regelung des Arbeitsmarktes übergeht. Bei einer kontrollierten Lockerung könnten am Ende zwei Arbeitsmärkte entstehen, die nebeneinander existieren. Auf dem traditionellen Arbeitsmarkt werden weiterhin sozial abgesicherte Normalarbeitsplätze von Großunternehmen angeboten, während auf dem neuen selbständigen Arbeitsmarkt kleinere Firmen flexible aber auch risikoreichere Arbeitsplätze anbieten. Wichtig wird es dabei aber sein, dass sich diese beiden Arbeitsmärkte nicht spalten und voneinander entfernen, da sonst auch in der Gesellschaft Konflikte und Spaltungen entstehen würden.
Bodo Hombach geht in seinen Ausführungen sogar noch einen Schritt weiter und erklärt Selbständigkeit und Unternehmertum zum gesellschaftlichen Leitbild. Dabei betrachtet er den Staat als Konzernzentrale, die nur noch wenige regelnde Eingriffe, dafür aber mehr organisatorische Anpassungen durchführt. Seine „Politik der zweiten Chance“ möchte jedem Individuum die Möglichkeit geben, selbständig in der Wirtschaft zu agieren und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, ohne bei einem Misserfolg einen zu großen Schaden zu nehmen. Dafür soll der Staat Schutzmaßnahmen schaffen. (Hombach 1998, S. 67) In Zukunft soll dann die deutsche Gesellschaft von der „Kultur der Selbständigkeit“ geprägt sein. Hombach verwendet mit seiner „Politik der zweiten Chance“ Ansätze aus Giddens’
Theorie. Auch die Übernahme von mehr Verantwortung durch die Bürger ist Ziel des Dritten Weges. Allerdings ist der Grundgedanke seiner Ausführungen eher neoliberalen Ursprungs.
Eine weitere Chance, die sich aus dieser Flexibilisierung der Arbeit ergibt, besteht für den Abbau der Arbeitslosigkeit. Durch flexiblere Arbeitsplatzmodelle könnte die vorhandene Arbeit auf mehrere Köpfe verteilt werden. Denkbare und immer wieder genannte Beispiele sind Bildungsgutscheine, welche die Arbeitnehmer nach ihrer freien Verfügung einsetzen können, Sabbatjahre, Arbeitszeitkonten oder ähnliches.5Damit wird die von den Arbeitnehmern geforderte Arbeitszeitflexibilität gerecht ausgeglichen durch eine Zeitsouveränität der Beschäftigten. Zeit kann dann wieder für von der Arbeit verschiedene Dinge eingesetzt werden, die aber durchaus Auswirkungen auf das spätere Berufsleben haben können (z.B. gesteigerter Wert auf dem Arbeitsmarkt durch Weiterbildung oder Nutzung eines Sabbatjahres für zivilgesellschaftliche Tätigkeiten).
Insgesamt betrachtet wird die Flexibilisierung der Arbeitswelt von den Vertretern des Dritten Weges überwiegend positiv eingeschätzt. Gefordert werden für das Einstellen dieser Nutzeffekte allerdings Flexibilisierungsmaßnahmen in staatlichen Regelungen und ein Umdenken in der Bevölkerung. Die Nutzbarmachung der neuen Arbeitsverhältnisse für zivilgesellschaftliche Tätigkeiten, wie sie der Dritte Weg fordert, wird allerdings nur am Rande erwähnt.
[...]
1 „Eine inklusive Gesellschaft muß die Grundbedürfnisse derer befriedigen, die nicht arbeiten können, und sie muß der großen Vielfalt von Möglichkeiten, die das Leben bietet, Rechnung tragen.“ (Giddens 1999, S. 129)
2 Die Titel der Bücher sind im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit aufgeführt.
3 „1960 betrug in Westdeutschland der Anteil des produzierenden Gewerbes 53 Prozent, der Anteil der Dienstleistungs-
4 „Noch Anfang der siebziger Jahre standen einem Nicht-Normbeschäftigten fünf Normbeschäftigte gegenüber. Anfang der achtziger Jahre lag das Verhältnis bei eins zu vier, Mitte der achtziger Jahre bereits bei eins zu drei. Mitte der neunziger Jahre lag es bei eins zu zwei. Bei Fortschreibung dieses Trends wird das Verhältnis von Norm- und Nicht-Normarbeitsplätzen in fünfzehn Jahren bei eins zu eins liegen.“ (Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, zit. in
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "Dritte Weg", der in diesem Text diskutiert wird?
Der "Dritte Weg" bezieht sich auf eine politische Theorie, die darauf abzielt, über traditionelle "rechts"- (konservativ und neoliberal) und "links"- (sozial und regelungsfreudig) Politikansätze hinauszugehen, um neue Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden. Anthony Giddens wird als einflussreicher Theoretiker dieses Ansatzes genannt.
Wer ist Anthony Giddens, und welche Rolle spielt er in der Theorie des "Dritten Weges"?
Anthony Giddens ist ein Soziologe, dessen Theorie des "Dritten Weges" eine reflexive Veränderung der Gesellschaft vorsieht. Er versucht, traditionelle Trennungen zwischen Staat und Bevölkerung sowie "rechts" und "links" zu überwinden, um eine "radikal-demokratische Mitte" zu schaffen. Seine Werte umfassen Gleichheit, Freiheit als selbstbestimmtes Handeln und demokratische Entscheidungsverfahren.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Zusammenhang mit der Wirtschaftsreform im "Dritten Weg" diskutiert?
Die diskutierten Schlüsselkonzepte sind Tertiarisierung, Flexibilisierung und Globalisierung. Tertiarisierung bezieht sich auf das Wachstum des Dienstleistungssektors im Vergleich zum Produktionssektor. Flexibilisierung bezieht sich auf die Anpassung von Arbeitszeiten und -formen an die veränderten wirtschaftlichen Anforderungen. Globalisierung wird als ein Faktor genannt, der diese Prozesse beeinflusst.
Was bedeutet Tertiarisierung und wie beeinflusst sie den Arbeitsmarkt?
Tertiarisierung beschreibt den wachsenden Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaft im Vergleich zum produzierenden Gewerbe. Sie führt zu einem Abbau von Arbeitsplätzen im Produktionssektor und einer Zunahme von Stellen im Dienstleistungssektor, wobei letztere oft niedrigqualifiziert sind und geringe Löhne bieten.
Was ist Flexibilisierung der Arbeit und welche Chancen und Risiken birgt sie?
Flexibilisierung der Arbeit bedeutet, dass Arbeitszeiten und -formen an die betrieblichen Erfordernisse angepasst werden, was zu einer Abkehr von traditionellen 40-Stunden-Jobs führt. Chancen sind die Entstehung neuer, innovativer Arbeitsplätze, die besser auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zugeschnitten sind. Risiken sind die Entstehung eines unsicheren Arbeitsmarktes mit geringer sozialer Absicherung.
Welche Rolle spielt der Staat im "Dritten Weg" bei der Wirtschaftsreform?
Der Staat soll laut dem "Dritten Weg" weniger als Regelungsinstanz und mehr als Organisator agieren. Er soll Rahmenbedingungen schaffen, die Selbständigkeit und Unternehmertum fördern, aber auch Schutzmaßnahmen bereitstellen, um die Risiken zu minimieren ("Politik der zweiten Chance").
Was ist die "Kultur der Selbständigkeit", die Bodo Hombach vorschlägt?
Bodo Hombach sieht Selbständigkeit und Unternehmertum als gesellschaftliches Leitbild. Er betrachtet den Staat als "Konzernzentrale", die organisatorische Anpassungen vornimmt und jedem Individuum die Möglichkeit gibt, selbständig in der Wirtschaft zu agieren und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.
Wie können flexiblere Arbeitsplatzmodelle zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit beitragen?
Durch flexiblere Arbeitsplatzmodelle wie Bildungsgutscheine, Sabbatjahre oder Arbeitszeitkonten kann die vorhandene Arbeit auf mehr Personen verteilt werden. Dies ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit und kann die Arbeitslosigkeit reduzieren.
Welche Kritikpunkte werden an der Flexibilisierung der Arbeitswelt geäußert?
Es wird kritisiert, dass die Flexibilisierung zu einer Spaltung des Arbeitsmarktes führen kann, in dem traditionelle, sozial abgesicherte Arbeitsplätze neben unsicheren, flexiblen Arbeitsplätzen existieren. Es wird auch gefordert, dass die Nutzbarmachung der neuen Arbeitsverhältnisse für zivilgesellschaftliche Tätigkeiten stärker berücksichtigt wird.
Wer sind Joschka Fischer, Bodo Hombach, Hubert Kleinert und Siegmar Mosdorf und welche Rolle spielen sie in der deutschen Debatte um den "Dritten Weg"?
Joschka Fischer (B'90/Grüne), Bodo Hombach (SPD), Hubert Kleinert (B'90/Grüne) und Siegmar Mosdorf (SPD) sind Politiker, deren Bücher und Beiträge zur Reform von Politik und Gesellschaft untersucht werden, um Elemente des "Dritten Weges" nach Giddens zu identifizieren. Ihre Ansichten zu Wirtschaft, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie Umwelt werden analysiert.
Welche Themenkomplexe werden im Kontext des "Dritten Weges" in Deutschland untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Themen Wirtschaft, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie Umwelt.
- Quote paper
- Sebastian Götte (Author), 1999, Der "Dritte Weg" in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100429