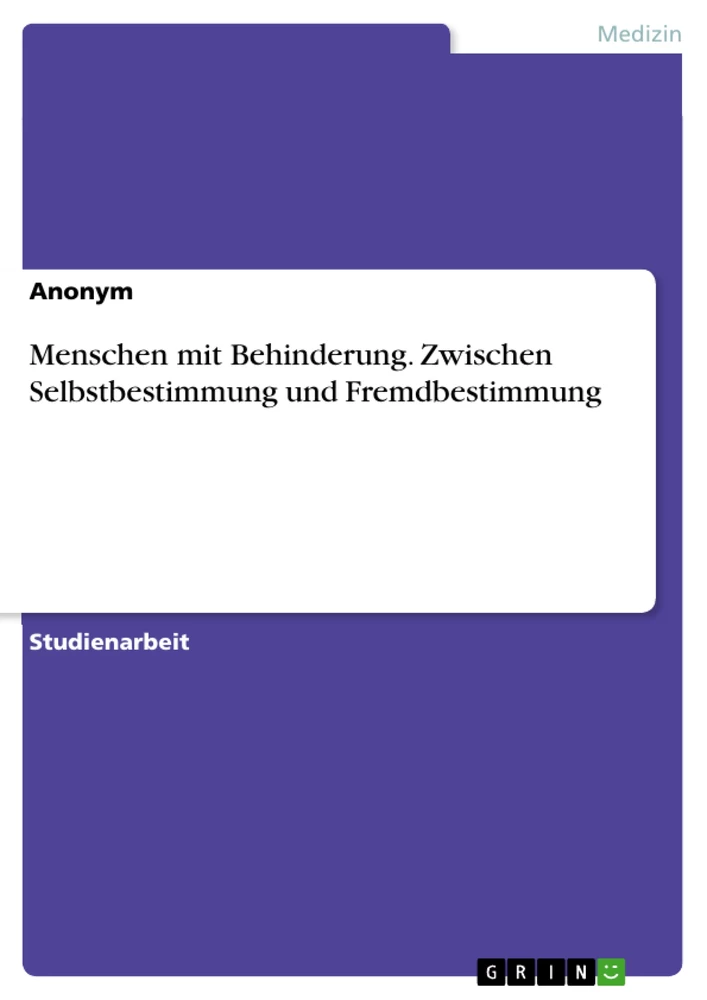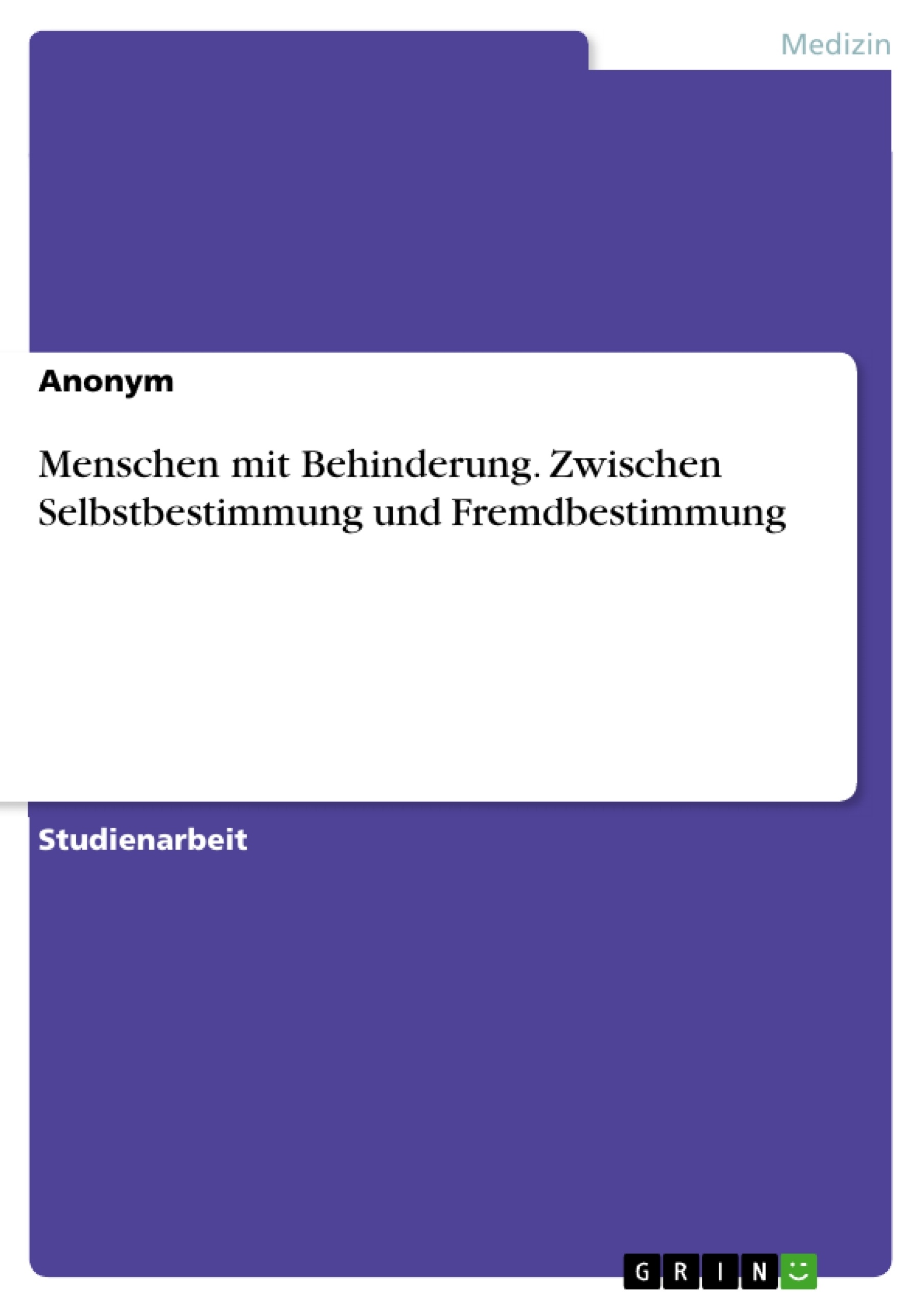Wie geht ein, an Demenz erkrankter Mensch, der im Verlauf der Erkrankung schrittweise physische und kognitive Fähigkeiten verliert, mit den Themen Selbstbestimmung und Autonomie um? Gilt das in Artikel 2 des Grundgesetztes verankerte Recht auf Selbstbestimmung überhaupt für einen Menschen, dessen Erinnerungs- und Handlungsvermögen stetig schwindet? Steht nicht die Gesellschaft in der Verantwortung, für diese hilfebedürftigen Menschen zu sorgen, indem sie ihnen auch wichtige Entscheidungen abnimmt? Oder welche Brücken können geschlagen werden, damit Menschen mit Demenz eine möglichst lebenslange Chance auf Selbstbestimmung erhalten können? Und schließlich: Welche Folgen können getroffene Maßnahmen zum vermeintlichen Schutz der dementiell veränderten Person und/oder der zu Betreuenden haben? Zu welchem Grad ist Freiheitseinschränkung bei dementiell erkrankten Personen gerechtfertigt?
Laut einer Einschätzung des Dachverband Deutscher Alzheimer-Gesellschaften werde sich die Zahl der an einer Demenz erkrankten Menschen bis 2050 im Vergleich zum Jahr 2018 europaweit verdoppeln. Eine fundierte Auseinandersetzung mit diesem Thema ist daher, auch interdisziplinär, von höchster Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demenz - Formen und Ausprägungen
- Selbstbestimmt leben trotz Demenz?
- Demenz als Einschränkung der Selbstbestimmung
- Selbstbestimmung trotz Demenz. Projekte/Strategien zum Erhalt der Selbstbestimmung bei Demenz
- Mögliche Maßnahmen bei Demenz und ihre Folgen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Frage nach dem selbstbestimmten Leben mit einer Demenz zu untersuchen. Dabei wird zunächst die Krankheit Demenz in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen skizziert. Anschließend wird der Fokus auf die Auswirkungen von Demenz auf die Selbstbestimmung gelegt.
- Die Auswirkungen von Demenz auf die Selbstbestimmung
- Projekte und Strategien zur Unterstützung der Selbstbestimmung bei Demenz
- Mögliche Maßnahmen und deren Folgen
- Die ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Demenz
- Die Frage, ob und inwieweit ein selbstbestimmtes Leben mit einer Demenz möglich ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Demenz ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext des zunehmenden Alters der Bevölkerung dar. Zudem werden grundlegende Fragen zur Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der Erkrankung aufgeworfen.
Kapitel 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen und Ausprägungen der Demenz. Dabei werden primäre und sekundäre Demenzen sowie verschiedene Demenztypen, wie die Alzheimer-Demenz und die vaskuläre Demenz, beschrieben.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Frage, ob und inwieweit Menschen mit Demenz selbstbestimmt leben können. Zunächst werden die potenziellen Einschränkungen der Selbstbestimmung durch die Demenz aufgezeigt. Anschließend werden Projekte und Strategien vorgestellt, die den Erhalt der Selbstbestimmung bei Demenz unterstützen. Der begrenzte Umfang der Arbeit erlaubt eine nur kurze Diskussion dieser Strategien.
Kapitel 3 widmet sich den möglichen Maßnahmen in der Betreuung von Menschen mit Demenz. Dabei werden die potenziellen Folgen der Maßnahmen beleuchtet und die Frage nach der Rechtfertigung von Freiheitsbeschränkungen bei Demenzkranken thematisiert.
Schlüsselwörter
Demenz, Selbstbestimmung, Autonomie, Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenz, Projekte, Strategien, Maßnahmen, Freiheitsbeschränkung, ethische Herausforderungen, gesellschaftliche Relevanz, Lebensqualität, Betreuung, Pflege, Grundgesetz
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Menschen mit Behinderung. Zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1003236