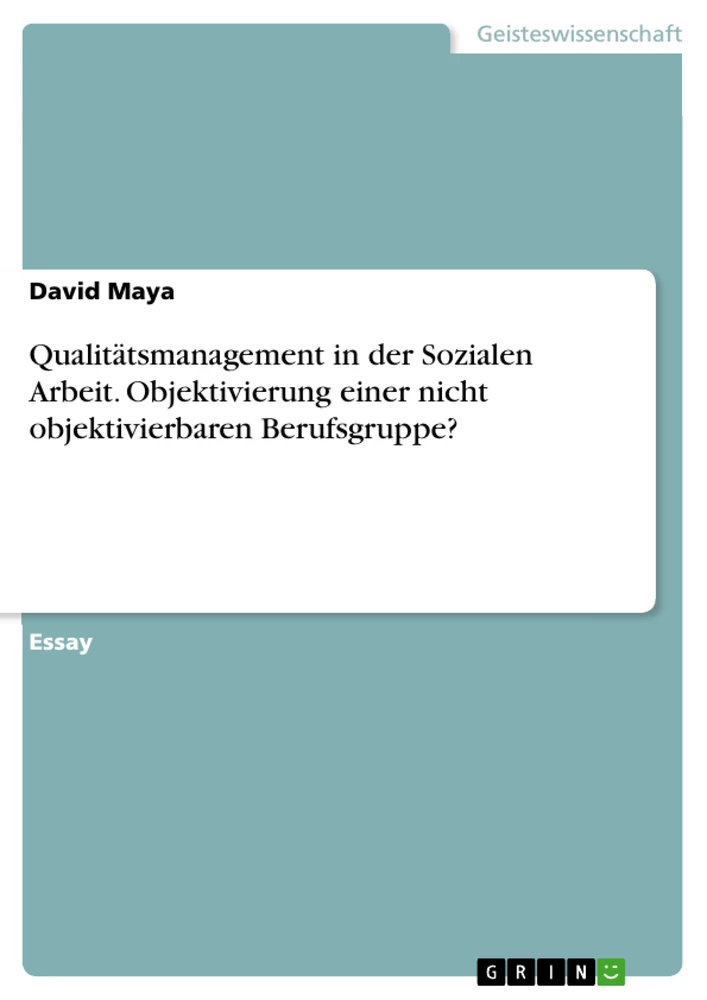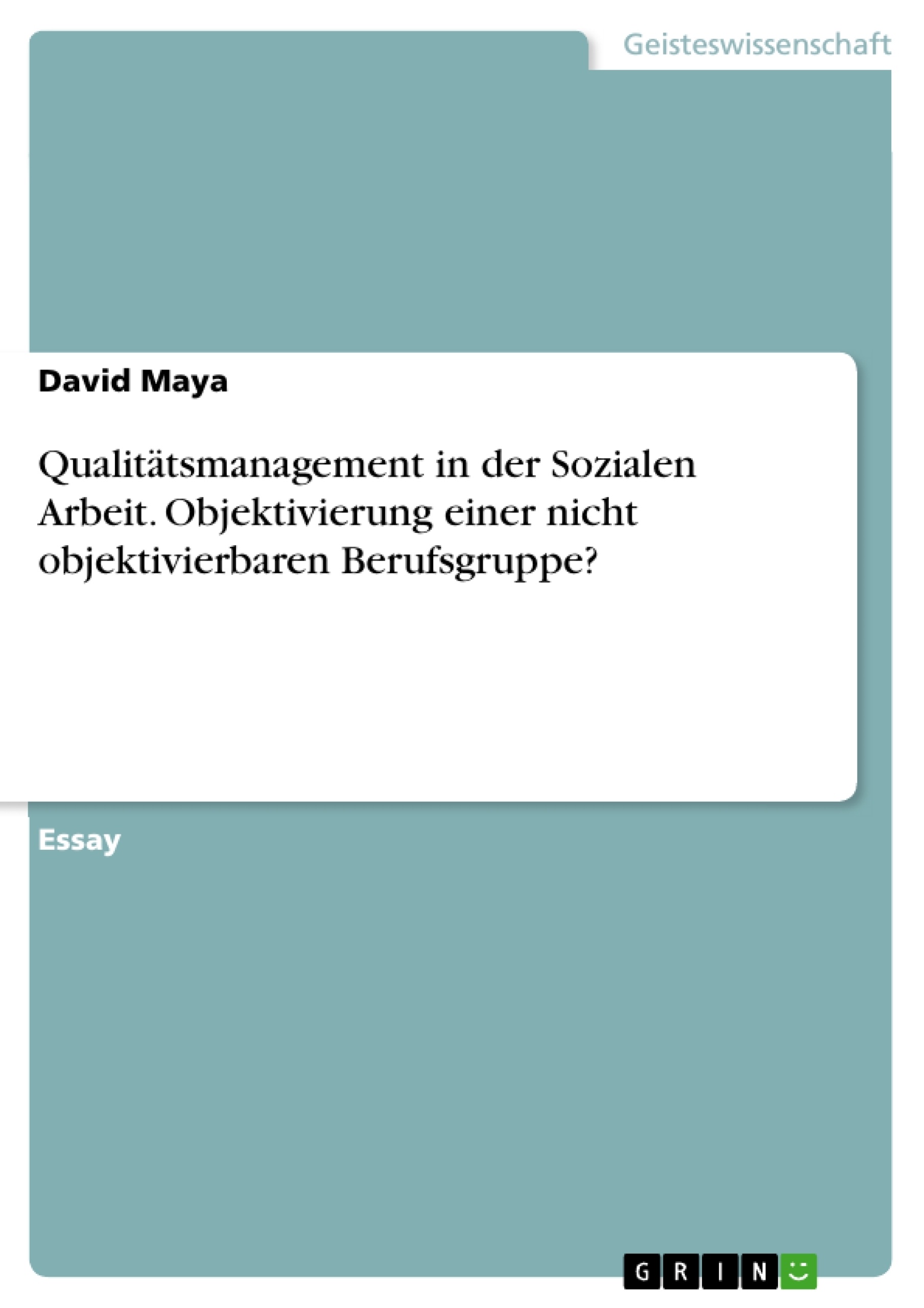Seit der zunehmenden Popularisierung des Neoliberalismus in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sind alle Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Interaktion ökonomischen Paradigmen und Statuten unterworfen worden.
In diesem Zuge ist auch die Soziale Arbeit immer mehr unter die Einflussnahme der (Markt-) Wirtschaft und seine Mechanismen geraten. Aus einer ursprünglich dem Menschen verpflichteten Profession, dessen primäre Aufgabe es ist, Hilfe und Unterstützung anzubieten, ist ein den marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten untergeordneter Arbeitsbereich geworden. Mittlerweile wundert sich kaum jemand, wenn über „Kunden“ und „Produkte“ gesprochen wird, wenn in Wirklichkeit in Not geratene Menschen gemeint sind, denen eigentlich mit Hilfe professioneller und empathischer Mitarbeiter des Sektors der Sozialen Arbeit Hilfestellungen angeboten werden soll.
Dieser Paradigmenwechsel führte zwangsläufig auch zur Umsetzung eines Qualitätsmanagements, der eng mit dem Begriff des ‚New Public Management‘ korreliert und sich insbesondere in der Abänderung des § 78 SGB VIII widerspiegelt. Damit ist die Soziale Arbeit zu einem rein kapitalistischen Markt geworden, dessen negative Auswirkungen ganz evident sind und in dem es in der Hauptsache Verlierer gibt – angefangen bei den sog. „Kunden“ über die einzelnen Organisationen bis hin zu den Mitarbeitern, die unter dem wettbewerblichen Preisdiktat auch im akademischen Vergleich ein Gehalt im unteren Drittel beziehen und immer fraglicheren Arbeitsbedingungen entgegenblicken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Implementation des Qualitätsmanagements in die Soziale Arbeit
- Qualitätsanforderungen an die Soziale Arbeit als Folge eines umstrukturierten Sozialstaates und fiskalischer Zwänge
- Von kollegialen Qualitätsvereinbarungen zum professionellen Qualitätsmanagement
- Auswirkungen des Qualitätsmanagements auf unterschiedliche Handlungsebenen
- Sozialpolitische Umstrukturierungen
- Einfluss auf die Organisationsebene
- Deprofessionalisierung der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Implementierung des Qualitätsmanagements in der Sozialen Arbeit im Kontext der neoliberalen Umstrukturierung des Sozialstaates. Der Fokus liegt auf den Folgen des ökonomischen Paradigmenwechsels und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Qualität der Sozialen Arbeit.
- Die Einführung des Qualitätsmanagements im Kontext des „New Public Management“ und seine Auswirkungen auf die Soziale Arbeit.
- Die ökonomischen Zwänge und fiskalischen Herausforderungen, die zur Einführung eines Qualitätsmanagements führten.
- Die Kritik an der Übertragung ökonomischer Qualitätsmanagement-Modelle auf die Soziale Arbeit und die daraus resultierenden Paradoxien.
- Die Auswirkungen des Qualitätsmanagements auf verschiedene Handlungsebenen, insbesondere auf die Organisation und die Profession der Sozialen Arbeit.
- Die Folgen des Qualitätsmanagements für die Qualität der Sozialen Arbeit und die Herausforderungen für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit im Rahmen des Neoliberalismus dar. Das zweite Kapitel analysiert die Implementation des Qualitätsmanagements in der Sozialen Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen. Es werden die Gründe für die Einführung des Qualitätsmanagements, insbesondere der zunehmende Kostendruck und die Umstrukturierung des Sozialstaates, erörtert. Das zweite Kapitel befasst sich weiterhin mit der Adaption des ökonomischen Qualitätsmanagement-Begriffs auf die Soziale Arbeit und den Herausforderungen, die sich aus der Übertragung eines marktorientierten Modells auf einen menschenbezogenen Bereich ergeben.
Schlüsselwörter
Qualitätsmanagement, Soziale Arbeit, Neoliberalismus, New Public Management, Ökonomisierung, Sozialstaat, Wettbewerbsstaat, Kostenreduktion, Effizienz, Kundenorientierung, Professionalität, Deprofessionalisierung, Qualitätsbegriff, Qualitätsstandards, Qualitätsmodelle, ISO, EFQM, Zertifizierung, Gütesiegel.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der Neoliberalismus die Soziale Arbeit?
Die Soziale Arbeit wird zunehmend ökonomischen Paradigmen unterworfen, wodurch Menschen in Not oft als "Kunden" und Hilfen als "Produkte" betrachtet werden.
Was ist "New Public Management" in diesem Kontext?
Ein Steuerungsmodell, das betriebswirtschaftliche Methoden in den sozialen Sektor einführt, um Effizienz und Wettbewerb zu steigern.
Welche Kritik gibt es am Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit?
Kritiker bemängeln eine Deprofessionalisierung, da empathische Hilfeleistung durch starre ökonomische Qualitätsstandards und Preisdiktate ersetzt werden könnte.
Welche Rolle spielt das SGB VIII (§ 78) für das Qualitätsmanagement?
Die Abänderung des Paragraphen spiegelt den rechtlichen Rahmen für die Einführung verbindlicher Qualitätsvereinbarungen und Leistungsbeschreibungen wider.
Wie wirken sich diese Veränderungen auf die Mitarbeiter aus?
Mitarbeiter stehen oft unter erhöhtem Wettbewerbsdruck bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Gehältern und schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen.
- Arbeit zitieren
- David Maya (Autor:in), 2020, Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Objektivierung einer nicht objektivierbaren Berufsgruppe?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1002993