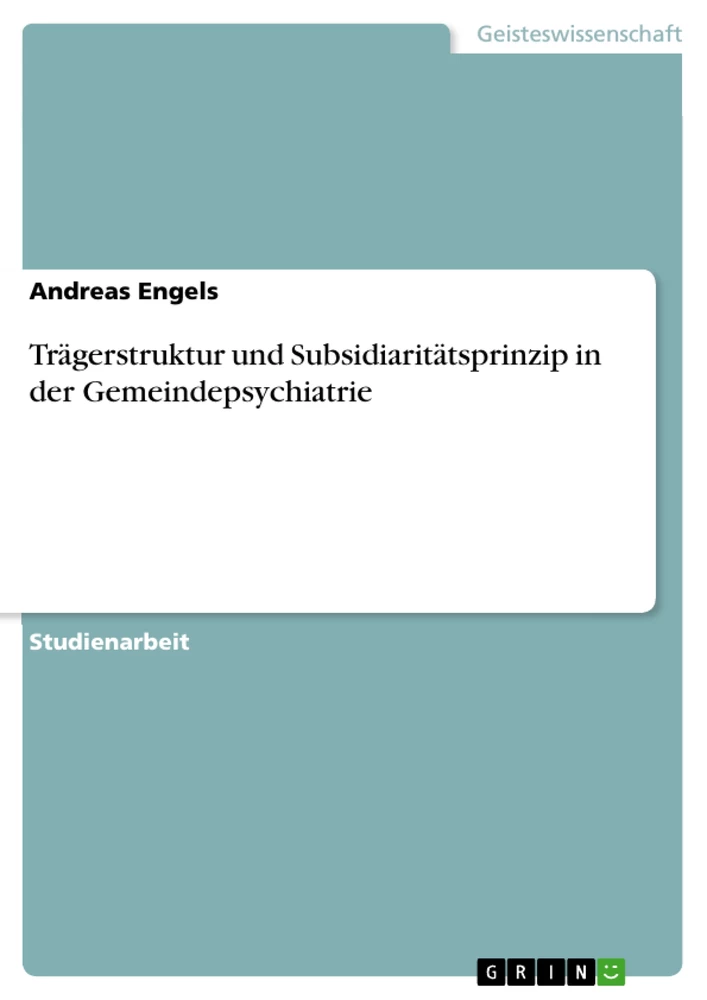Diese Arbeit soll einen Überblick schaffen über das Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Trägern. In einem ersten Schritt wird der Auftrag der Sozialen Arbeit in Deutschland skizziert. Im darauf folgenden Kapitel werden anhand des Arbeitsfeldes Gemeindepsychiatrie Trägerstruktur und Subsidiarität beschrieben. In Kapitel 4 werden abrundend Bezüge zur Sozialinformatik angeschnitten.
Die Wurzeln der Profession Soziale Arbeit – als Konstrukt der vormals differenzierten Zweige Sozialarbeit sowie Sozialpädagogik – liegen nach herrschender Auffassung in der Entwicklung von Armenfürsorge sowie außerschulisch institutionalisierter Erziehung und Bildung. Um den aktuellen Auftrag der Sozialen Arbeit zu umreißen, wird hier Bezug genommen zum Einen auf die Definition des DBSH (Deutscher Be-rufsverband für Soziale Arbeit e.V.) als Vertreter der Profession, zum Anderen natürlich auf den disziplinären Diskurs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Auftrag der Sozialen Arbeit in Deutschland
- 3. Trägerstruktur in der gemeindepsychiatrischen Versorgung
- 4. Sozialinformatische Bezüge
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Trägerstruktur und dem Subsidiaritätsprinzip in der Gemeindepsychiatrie in Deutschland. Sie untersucht das Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Trägern im Kontext der Sozialen Arbeit und analysiert den Auftrag der Sozialen Arbeit im Kontext des Sozialstaates. Darüber hinaus werden Bezüge zur Sozialinformatik hergestellt.
- Der Auftrag der Sozialen Arbeit in Deutschland
- Die Trägerstruktur in der Gemeindepsychiatrie
- Das Subsidiaritätsprinzip in der Sozialen Arbeit
- Bezüge zur Sozialinformatik
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in einer differenzierten Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Diese Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, die sich mit dem Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Trägern in der Gemeindepsychiatrie in Deutschland befasst. Sie skizziert den Fokus der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Auftrag der Sozialen Arbeit in Deutschland
Dieses Kapitel beleuchtet den Auftrag der Sozialen Arbeit in Deutschland. Es verweist auf die Wurzeln der Profession, definiert den Auftrag anhand der Position des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH) und diskutiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der Sozialarbeitswissenschaftlichen Theorie.
3. Trägerstruktur in der gemeindepsychiatrischen Versorgung
Dieses Kapitel untersucht die Trägerstruktur in der gemeindepsychiatrischen Versorgung. Es betrachtet das Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Trägern und analysiert das Subsidiaritätsprinzip im Kontext der Sozialen Arbeit.
4. Sozialinformatische Bezüge
Dieses Kapitel beleuchtet die Bezüge zwischen der Gemeindepsychiatrie und der Sozialinformatik. Es betrachtet die Rolle der Sozialinformatik in der Organisation und Verwaltung der Gemeindepsychiatrie.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Trägerstruktur, Gemeindepsychiatrie, Subsidiaritätsprinzip, Soziale Arbeit, Sozialinformatik, Sozialstaat, Sozialgesetzbuch, öffentliche Träger, private Träger, Inklusion, Exklusion, Exklusionsvermeidung, Inklusionsermöglichung, Exklusionsverwaltung.
- Arbeit zitieren
- Andreas Engels (Autor:in), 2021, Trägerstruktur und Subsidiaritätsprinzip in der Gemeindepsychiatrie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1001250