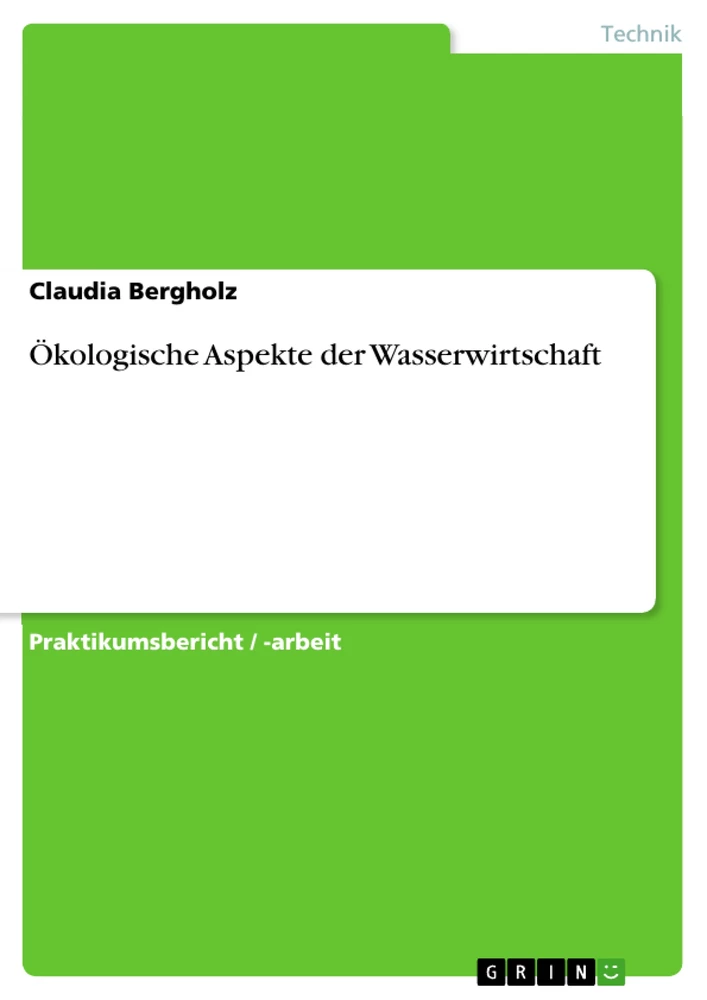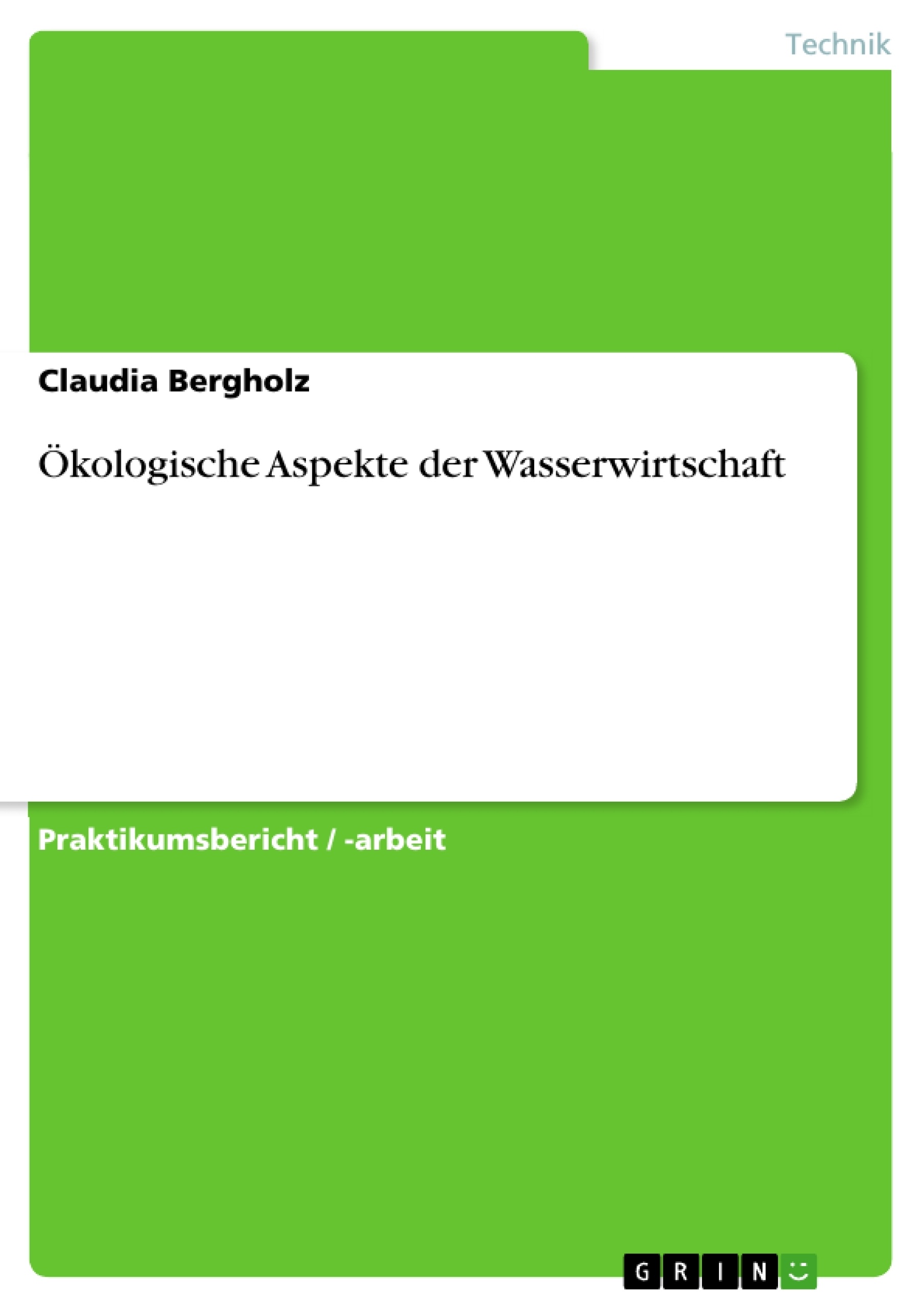Ökologsche Aspekte der Wasserwirtschaft
Aufgabe 1:
Die Morphologie von Fließgewässern als Teil der Landschaft ist von entscheidender Bedeutung. Im Praktikum untersuchten wir dazu die Ihme mittels ,,Vor-Ort" und der ,,100 m" Methode.
Beide Methoden beinhalten Kriterien bzgl. Der Situation vor Ort (Istzustand). Aufgenommen wurden variable abiotische Faktoren wie meteorologische Daten (Niederschlag und Bedeckung) und hydrologische Daten (Gewässerausmasse, Strömung und Wasserführung). Weiterhin wurden makrooptische Verunreinigungen wie Müll, Einleitungen, Sekundärverschmutzungen, Sichttiefe, Farbe und Geruch aufgenommen. Die Gewässergüte wird nicht nur durch eingeleitete Abwasser- und Verschmutzungssubstanzen beeinflusst, sondern auch durch die o.g. Kriterien der Ist- Situation am Tag der Untersuchung. Ziel der Erfassung dieser Kriterien ist es, auch Randerscheinungen aufzunehmen, die evtl. Konsequenzen haben.
Bei der ,,Vor-Ort" Methode wird ein Gewässerabschnitt von ca. 10 bis 15 m genauestens betrachtet. Charakteristisch für diese Methode ist die genaue Untersuchung eines relativ kurzen Gewässerabschnittes, anhand dessen dann Rückschlüsse auf die Gesamtstruktur des Gewässers gezogen werden können.
In unserem Fall war eine erhöhte Wasserführung aufgrund starker Regenfälle zu beobachten. Die Strömungsgeschwindigkeit nahm von der Mitte zum Rand hin stark ab. In Randbereichen waren zum Teil sogar Totwasserzonen zu beobachten. Eine Beprobung zur Bestimmung des Saprobienindexes war aufgrund des hohen Wasserspiegels nicht möglich. Bei der ,,100 m" Methode wird ein Abschnitt von ca. 100 m untersucht. Bei dieser Methode wird ein grösserer Überblick zur Gesamteinschätzung eines Fliessgewässers gewonnen. Kriterien wie Beschattung, Gewässerausmasse, Gewässerzustand und Fliessgeschwindigkeit geben bei dieser Methode eine repräsentativere Aussage über den überwiegenden Verlauf eines Gewässers.
Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Welche Methode angewendet werden sollte, hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab.
Die ,,100 m" Methode ist sicherlich die geeignetere Methode um ein Fliessgewässer hinsichtlich seiner Morphologie als Teil der Landschaft zu beurteilen, weil ein wesentlich grösserer Überblick gewonnen wird.
Die ,,Vor-Ort" Methode bietet den Vorteil eine recht genaue Aussage über die Gewässergüte an einer bestimmten Stelle zu machen. Dies ist z. B. wichtig, wenn Aussagen über Durchmischung und Abführung von Einleitern hinter Zuläufen von Kläranlagen o.ä. gemacht werden sollen.
Aufgabe 2:
Zusammenhang zwischen morphologischem Zustand und Zusammensetzung des Makrozoobenthos
Im Laufe der Fließstrecke der Gewässer ändern sich die abiotischen Parameter. In Zusammenhang damit ändern sich auch die Lebensgemeinschaften. Von der Fließgeschwindigkeit hängt der Stofftransport und der Gasaustausch an der Gewässeroberfläche sowie die Temperatur ab. Je vielgestaltiger der Komplex SubstratStrömung ist, um so artenreicher ist auch die Lebewelt.
Fließgewässerorganismen sind der Gefahr ausgesetzt, durch die Strömung flußabwärts und damit aus einem ihnen zuträglichen Lebensraum verfrachtet zu werden. Um das zu verhindern, haben sie Anpassungen in Morphologie und Verhalten entwickelt oder sind sehr gute Schwimmer. Die von uns gefundenen Asellus aquaticus und Gammariden etwa haben keine speziellen Hafteinrichtungen und leben deshalb in Toträumen, in denen das Wasser ruhig ist. Köcherfliegenlarven haben zur Anpassung an die Strömung ein Gehäuse zur Beschwerung. Mit diesem können sie sich in den Bächen halten. Gammariden hingegen sind seitlich abgeflacht, so daß sie auf der Seite liegend flach am Substrat gegen die Strömung schwimmen können.
Auch die Fließgeschwindigkeit bewirkt Einschränkungen für einige Organismen. So spinnen die Larven mancher Köcherfliegenarten Fangnetze zum Nahrungserwerb. Diese Netze sind nur bei bestimmten Anströmgeschwindigkeiten funktionsfähig. Die Netze fallen schon unter ca. 0,1 m/s zusammen, während sie oberhalb von 0,3 m/s bereits zerreißen. So haben wir die Köcherfliegenlarven vor allem an dem Standort 2 (11 Stück) gefunden, obwohl dort im Mittel eine hohe Fließgeschwindigkeit herrschte. Die Köcherfliegenlarven müssen sich dort in Randbereichen aufhalten, weil hier eine geringere Fließgeschwindigkeit vorliegt.
Im Bach liegt entweder Sand oder Kies und Schotter an den verschiedenen Standorten als Sohlensubstrat vor. Im groben Schotter können sich die Tiere in den durchströmten Hohlräumen der Strömung entziehen, der Untergrund ist jedoch nährstoffärmer. An allen untersuchten Standorten gibt es Detritusansammlungen. Bei der Mineralisation des Detritus wird Sauerstoff verbraucht. Dementprechend nimmt der Sauerstoffgehalt mit zunehmendem Schlammgehalt ab. Das Detritus ist zudem eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele der gefundenen Tiere, besonders für Insektenlarven und Schnecken. Der Bach als Ökosystem wird stark vom Umfeld beeinflußt und ist deshalb immer im Zusammenhang mit dem entwässerten Gebiet zu betrachten. Die Uferzone bildet eine Grenzfläche zur Umgebung. Je breiter und ausgeprägter sie ist, desto geringer ist der Einfluß der Umfeldnutzung.
Zusammenhang zwischen physikalisch-chemischen Parametern und Zusammensetzung des Makrozoobenthos
Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers machen Gewässer zu besonderen Lebensräumen. Das Wasser puffert viele Schwankungen der Umweltfaktoren ab. Die Lebensbedingungen werden dadurch konstanter und besser voraussagbar. Für die Adaption der Organismen an ihren Lebensraum treten deshalb die physikalischen Faktoren gegenüber den biotischen zurück.
Viele aquatische Tiere sind auf ein reichliches Sauerstoffangebot angewiesen und zeigen durch ihre Anwesenheit an, daß dies gegeben ist. Hierzu zählen zahlreiche Fliegen. Als Larven sind sie auf Wasseratmung angewiesen, und in ihrer 1-3jährigen Larvenzeit brauchen sie durchgängig hohe O2-Gehalte die in der Ihme gegeben sind (6,3; 6,4; 6,8 mg/l). Zum Beispiel benötigt die Art Leptophlebiidae langfristig einen Sauerstoffgehalt von mindestens 6 mg O2/l. Generell nehmen die Larven den Sauerstoff über Tracheenkiemen auf. Sie können durch schlängelnde Bewegungen einen Wasserstrom in ihrem Gehäuse erzeugen. Die Anwesenheit von Fliegenlarven ist bereits ein untrügliches Zeichen, daß keine nennenswerte Sauerstoffdefizite vorherrschen.
Ähnliche Rückschlüsse auf den Sauerstoffgehalt geben auch folgende Tiere: Sphaerium (mind. 4 mg O2/l)
Glossiphonia (mind. 4 mg O2/l)
Platambus (mind. 4 mg O2/l)
Elmis maugei (mind. 6 mg O2/l)
Zu den Krebstieren (Crustacea) lassen sich folgende Aussagen treffen:
Für Gammarus ist ein Mindestangebot von 4 mg O2/l notwendig, wobei sich die einzelnen Arten noch etwas voneinander unterscheiden. Dieses wird bei dem Bach an allen Standorten überschritten.
Gegenüber dem Gesamtfaktor kommunales Abwasser lautet die Reihenfolge im Sinne steigender Empfindlichkeit: Asselus aquaticus, Gammarus roeseli, Gammarus fossarum, Gammarus pulex.
Gammarus fossarum ist sehr empfindlich gegenüber pH-Absenkungen. Die durch Gammarus ausgewiesene relative Stabilität im pH-Milieu der Ihme ist eine Vorraussetzung für die hohe Tierartendiversität dieses Baches, die beim Auftreten gravierender pH-Wert Abweichungen allgemein zurückgehen würde.
In allen untersuchten Abschnitten wurden Gammariden gefunden, die nur in Gewässern mit höherem Kalkgehalt leben. Der Sauerstoff (Werte s.o.) und der pH-Wert (7,48 bis 7,56) liegen im in einem nicht limitierenden Bereich, wobei der Jahresverlauf allerdings nicht bekannt ist, so daß keine Rückschlüsse gezogen werden können.
Aufgabe 3:
Die Übersichtskartierung von Gewässerstrukturen dient zur Aufnahme des aktuellen Zustandes des zu untersuchenden Gewässers. Mit Hilfe eines Formblattes werden die Gewässermorphologischen Grundlagen, die Gewässerbettdynamik sowie die Auedynamik erfasst:
Gewässermorphologische Grundlagen (Leitbild) ermöglichen die Bewertung der aktuellen Gewässerstruktur im Vergleich zum Leitbild. Es erfolgt eine Beschreibung des Gewässers u.a. hinsichtlich Krümmungstyp, Lauftyp, Gewässergröße, Gewässertyp und Taltyp. Auf der Basis dieses Leitbildes wird das Gewässer detaillierter untersucht und somit eine Klassifizierung der Gewässerbettdynamik ermöglicht. Dazu müssen Aussagen über die Linienführung des Gewässers, des Strukturbildungsvermögens und des Gehölzsaumes getroffen werden, wobei die Bewertung ,,Uferverbau" mit den Bewertungen ,,Querbauwerke", ,,Abflussregelung", ,,Sohlsubstrat" zum ,,Strukturbildungsvermögen" zusammengefasst wird.
Nach der Erhebung und Bewertung sämtlicher o.g. Faktoren ergibt sich ein Gesamtwert für das Teilsystem Gewässerbettdynamik (Güteklasse). Höhere Zahlenwerte verweisen auf einen höheren Grad an Unnatürlichkeit oder Zerstörung.
Desweiteren wird die Auedynamik erhoben und bewertet. Die Bewertung von Hochwasserschutzbauwerken und des Ausuferungsvermögens ergeben einen Wert für die Retention; die Auenutzung und Uferstreifen ergeben einen Wert für das Entwicklungspotential. Insgesamt resultiert daraus die Gesamtbewertung für das Teilsystem Auedynamik..
Anschließend führt die Gesamtbewertung die beiden Teilssysteme Gewässerbettdynamik und Auedynamik zusammen und das Gewässer lässt sich einer Strukturgüteklasse zuordnen. Die Strukturgüte gibt keine Auskunft über die Wasserqualität, da sie sich lediglich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert.
Im Rahmen des Praktikums haben wir für den Standort Ihme2 eine Strukturgüteklasse 3 ermittelt.
Aufgabe 4:
Die industrielle Entwicklung hat zu einer starken Beanspruchung der Natur und unserer Umwelt geführt. In den letzten Jahren geht der Trend hin zum Versuch der Erhaltung und Verbesserung der Natur, u.a. der Gewässer. Grundlage dafür ist die richtige Beurteilung, die aber durch die Tatsache erschwert wird, dass ein Gewässer ein Organismus ist, in dem vielfältige biologische, chemische und physikalische Prozesse ablaufen, die in enger gegenseitiger Wechselwirkung miteinander stehen. Schon durch geringe Parameteränderungen können unerwartete Veränderungen in anderen Teilen dieses komplexen Systems verursacht werden. Es gilt sich immer die Gesamtheit des Systems vor Augen zu halten, um dem Verlust der Ökosystemeigenschaften eines Raumes entgegenzuwirken und die Fähigkeit der Selbstregulierung zu erhalten bzw. wieder herbeizuführen.
Die Komplexität zeigt sich in der Vorgehensweise des Gesetzgebers. So ist die Zielvorgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Oberflächengewässer und auch das Grundwasser mit wenigen Ausnahmen wieder in einen ,,guten" Zustand zu versetzen, d.h. einen Zustand zu erreichen, der nur geringfügig von einem ungestörten Zustand abweicht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen nicht nur einzelne Gewässereigenschaften wiederhergestellt werden, sondern möglichst alle chemischen und biologischen Eigenschaften. Voraussetzung dafür ist nicht das Gewässer alleine zu betrachten, sondern zusammen mit dem dazugehörigen Einzugsgebiet.
Nun stellt sich die Frage, wie sinnvoll eine solche Forderung ist? Und ob sie sich überhaupt realisieren lässt? Die EU-Richtlinie sieht hierfür einen Zeitrahmen von 16 Jahren vor. Bei der überwiegenden Zahl der Gewässer in Deutschland erscheinen jedoch Zweifel angebracht, da oftmals ökonomische vor ökologischen Interessen überwiegen. So ist nicht so sehr die Gewässerverunreinigung das Problem, als viel mehr die lange betriebene Begradigung der Gewässer und die Ausdeichung der Auen mit dem Ziel, diese ,,höherwertigeren" Nutzungen zuzuführen. Viele der Arten, die einen ,,guten Zustand" bedeuten würden, können sich aber erst wieder ansiedeln, wenn die erforderlichen Flächen zur Verfügung gestellt werden. Fraglich bleibt, ob es zu einer Rückführung der Randgebiete kommen kann.
Leider fehlt in den Rahmenrichtlinien die nähere Erläuterung zu den Parametern mittels derer der gute Gewässerzustand erreicht werden soll. Viele für ungestörte Gewässer typische Tierarten sind inzwischen so selten, dass über ihre Wiederansiedlung in sanierten Gebieten keine konkreten Aussagen gemacht werden können.
Fast alle großen und mittleren Flüsse werden für die Binnenschifffahrt genutzt und sind aus diesem Grund oder zur Energiegewinnung aufgestaut worden. Einerseits gibt es die Forderung, die Binnenschifffahrt stärker zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern, andererseits ist bei dem derzeitigen Ausbauzustand der Gewässer eine ungestörte Entwicklung der Lebensgemeinschaften wohl ausgeschlossen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Ökologsche Aspekte der Wasserwirtschaft"?
Der Text behandelt ökologische Aspekte der Wasserwirtschaft, insbesondere die Morphologie von Fließgewässern, den Zusammenhang zwischen morphologischem Zustand und Zusammensetzung des Makrozoobenthos, den Zusammenhang zwischen physikalisch-chemischen Parametern und Zusammensetzung des Makrozoobenthos, die Kartierung von Gewässerstrukturen sowie die Ziele und Herausforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Was wird in Aufgabe 1 untersucht?
Aufgabe 1 beschreibt die Untersuchung der Morphologie von Fließgewässern, am Beispiel der Ihme, mittels der "Vor-Ort" und der "100 m" Methode. Dabei werden abiotische Faktoren, makrooptische Verunreinigungen und die allgemeine Gewässersituation erfasst. Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden erläutert.
Welche Rolle spielt der morphologische Zustand für das Makrozoobenthos (Aufgabe 2)?
Der morphologische Zustand eines Fließgewässers beeinflusst die Zusammensetzung des Makrozoobenthos. Faktoren wie Fließgeschwindigkeit, Substratbeschaffenheit und Detritusansammlungen bestimmen die Lebensbedingungen und damit die Artenvielfalt der Organismen. Anpassungen der Organismen an die Strömung werden ebenfalls diskutiert.
Wie beeinflussen physikalisch-chemische Parameter das Makrozoobenthos (Aufgabe 2)?
Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers, insbesondere der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert, sind entscheidend für das Überleben und die Verbreitung bestimmter Arten des Makrozoobenthos. Die Anwesenheit bestimmter Arten kann Rückschlüsse auf die Wasserqualität zulassen.
Was beinhaltet die Übersichtskartierung von Gewässerstrukturen (Aufgabe 3)?
Die Übersichtskartierung von Gewässerstrukturen dient der Erfassung des aktuellen Zustandes eines Gewässers anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. Gewässermorphologie, Gewässerbettdynamik und Auedynamik. Daraus ergibt sich eine Strukturgüteklasse, die allerdings keine Aussage über die Wasserqualität trifft.
Was sind die Ziele und Herausforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Aufgabe 4)?
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, Oberflächengewässer und Grundwasser in einen "guten" Zustand zu versetzen. Dies erfordert die Wiederherstellung chemischer und biologischer Eigenschaften, die Betrachtung des Gewässers im Zusammenhang mit dem Einzugsgebiet und die Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Interessen. Die Umsetzung wird jedoch durch Begradigungen, Ausdeichungen und Nutzungskonflikte erschwert.
Welche Bedeutung hat der Gewässerzustand für die Binnenschifffahrt?
Die Nutzung von Flüssen für die Binnenschifffahrt und zur Energiegewinnung, häufig durch Aufstauung, steht im Konflikt mit einer ungestörten Entwicklung der Lebensgemeinschaften. Die Förderung der Binnenschifffahrt und die Sicherung von Arbeitsplätzen sind ökonomische Interessen, die sich mit den ökologischen Zielen der Wasserrahmenrichtlinie möglicherweise nicht vereinbaren lassen.
- Arbeit zitieren
- Claudia Bergholz (Autor:in), 2000, Ökologische Aspekte der Wasserwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100075