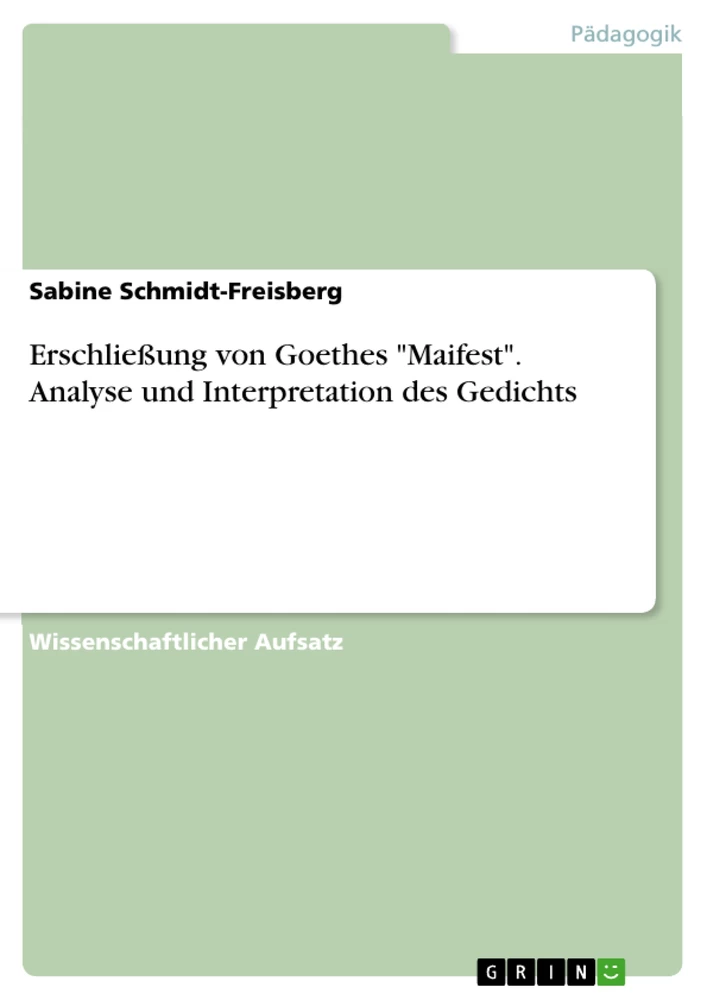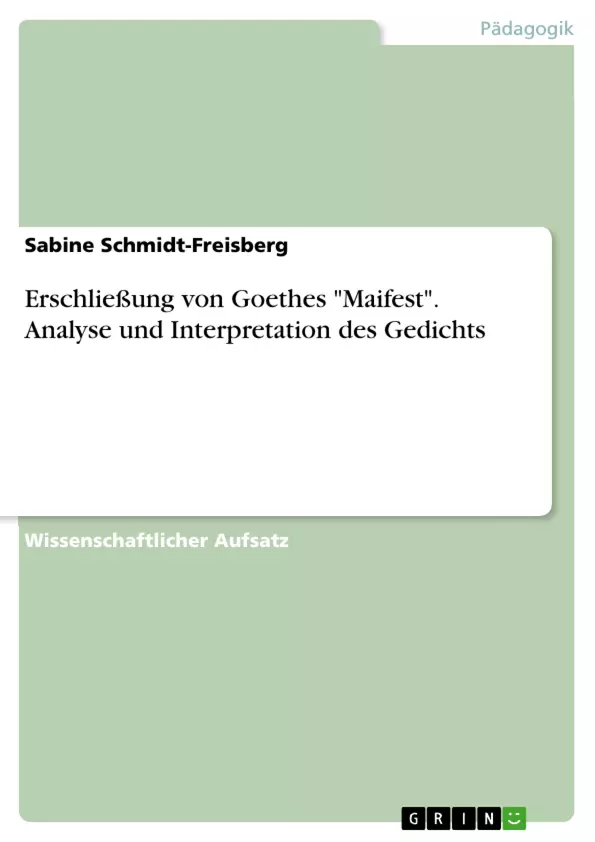Diese Arbeit beinhaltet eine Gedichtanalyse und -interpretation von Johann Wolfgang Goethes Gedicht "Maifest" (später auch: "Mailied") in Form eines Musteraufsatzes für die zehnte bis zwölfte Jahrgangsstufe am bayerischen Gymnasium. Das Gedicht wird in Bezug auf Inhalt, Aufbau und Sprache analysiert und in die Epoche des Sturm und Drang eingeordnet.
Das Gedicht erschien 1775 und ist der Epoche des Sturm und Drang zuzuordnen. Thema des Gedichts ist die Wechselwirkung zwischen Naturerfahrung und Liebesgefühlen anhand eines konkreten Erlebnisses. Es wird eine offensichtlich noch frische Liebesbeziehung zwischen dem lyrischen Ich und einem Mädchen gestaltet. Der Sprecher befindet sich morgens in der Natur und erfreut sich am sonnigen Frühlingswetter, bevor er dort auf die Geliebte trifft.
Das Gedicht ist in Bezug auf Thema und Sprache typisch für die literarische Strömung des Sturm und Drang, zum einen, weil es sich um ein Beispiel der sogenannten Erlebnislyrik handelt, in der ein echtes, persönliches Erlebnis (hier die Liebe zu einem Mädchen) zum Anlass für Dichtung wurde. "Maifest" zählt zu den "Sesenheimer Liedern", die Goethe während seines Jura‐Studiums in Straßburg schrieb, wo er sich in die Pfarrerstochter Friederike Brion aus Sesenheim verliebt hatte. Diese Beziehung war der Auslöser für mehrere Gedichte, die ursprünglich Briefen an Friederike entstammten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Textimmanente Analyse
- Die ersten drei Strophen: Naturbeschreibung
- Die Strophen 4 und 5: Liebe und die intensivierte Naturwahrnehmung
- Die Strophen 6 - 9: Die konkrete Liebesbeziehung
- Der Titel "Maifest"
- Sprache
- Satzbau
- Versmaß
- B. Kontextualisierung
- Erlebnislyrik des Sturm und Drang
- Die Sesenheimer Lieder
- Sprache und Inhalt in der Erlebnislyrik
- Sturm und Drang und Traditionen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert das Gedicht „Maifest" von Johann Wolfgang von Goethe unter besonderer Berücksichtigung seiner Sprache und seines Kontextes in der Epoche des Sturm und Drang. Die Analyse fokussiert auf die Textimmanenz, indem sie die sprachlichen Mittel und den Aufbau des Gedichts untersucht. Dabei werden auch die historischen und literarischen Hintergründe beleuchtet, um die Entstehungsgeschichte und die literarische Bedeutung des Werks besser zu verstehen.
- Die Wechselwirkung zwischen Natur und Liebe
- Die Darstellung von Liebe und Glück in der Sprache
- Die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der Natur
- Die Verwendung von Sprachmitteln in der Erlebnislyrik
- Der Einfluss der Epoche des Sturm und Drang
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Gedicht „Maifest" von Johann Wolfgang von Goethe vor und ordnet es in die Epoche des Sturm und Drang ein. Das Gedicht thematisiert die Wechselwirkung zwischen Naturerfahrung und Liebesgefühlen.
A. Textimmanente Analyse
Dieser Abschnitt analysiert die sprachlichen Mittel und den Aufbau des Gedichts. Dabei werden die Naturbeschreibungen, die Darstellung der Liebe und die sprachlichen Besonderheiten, wie zum Beispiel die Verwendung von Ausrufen, Wortschöpfungen und Hyperbeln, untersucht. Der Text beleuchtet auch die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der Natur, sowie die emotionale Intensität der Liebesgeschichte.
B. Kontextualisierung
Der Abschnitt "Kontextualisierung" ordnet das Gedicht in die literarische Strömung des Sturm und Drang ein. Er erklärt die Entstehungsgeschichte des Werks und setzt es in Beziehung zu den typischen Merkmalen der Erlebnislyrik. Die Rolle der Liebe und der Natur in der Literatur des Sturm und Drang wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Sturm und Drang, Erlebnislyrik, Liebe, Natur, Sprache, Textimmanente Analyse, Kontextualisierung, Goethe, „Maifest“, Lyrik, Ausdrucksmittel, Hyperbeln, Wortschöpfungen, Gedichtanalyse.
- Arbeit zitieren
- Sabine Schmidt-Freisberg (Autor:in), 2021, Erschließung von Goethes "Maifest". Analyse und Interpretation des Gedichts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1000741