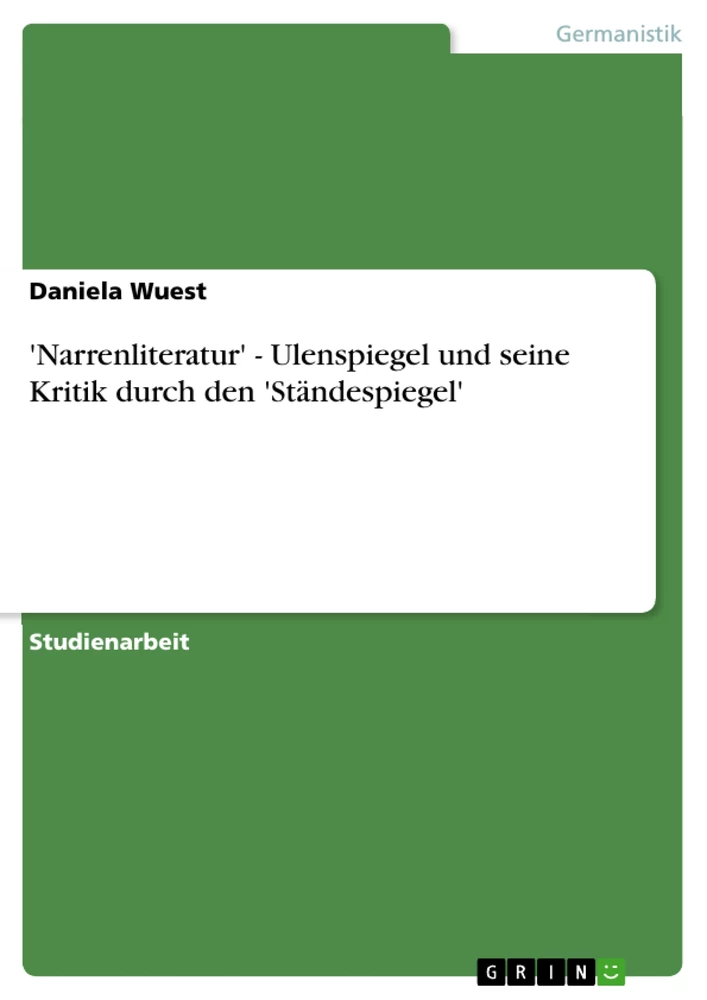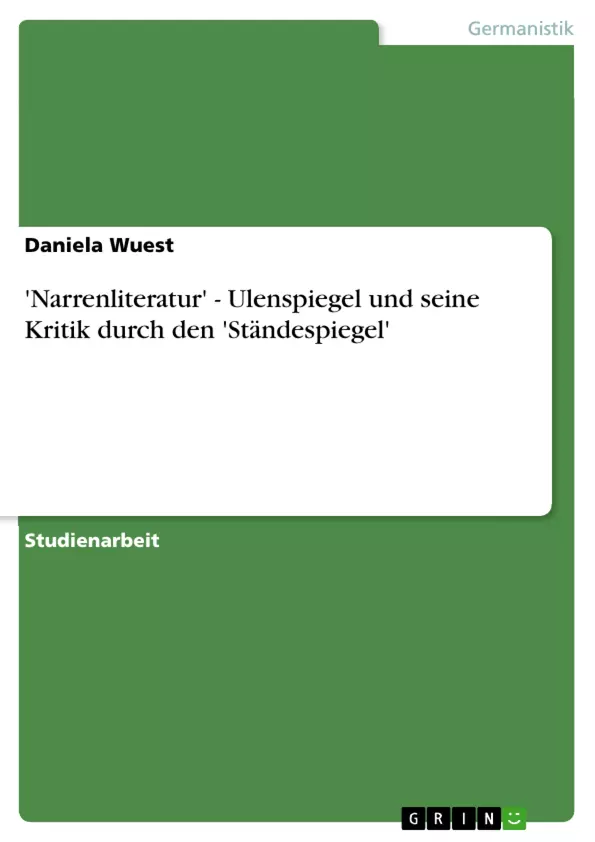Kaum eine literarische Figur hat sich so lange über die verschiedenen Epochen bis heute erhalten wie die des „Ulenspiegels“: Spricht man heute von einem „Eulenspiegel“, dann hat man die Vorstellung von einem „originellen, scharfsinnigen Spaßmacher im Dienste des gesunden Menschenverstandes, der seiner Umwelt ironisch und humorvoll entlarvend den Spiegel vorhält“1. Die ursprüngliche „Ulenspiegelfigur“ bietet aber viel mehr Interpretationsmöglichkeiten, vor allem kritisiert sie ihre Umwelt sehr viel schonungsloser und direkter als wir von einem „Eulenspiegel“ erwarten können. Ich werde in meiner Hausarbeit zuerst zum besseren Verständnis die Entstehung des Ulenspiegelbuches und seine Entwicklung vorstellen, und danach genauer auf die genannte Kritik eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entstehungsgeschichte und Autorenfrage
- II.I. Entstehungsgeschichte
- II.II. Verfasserfrage
- III. Namensgebung und Rezeptionsgeschichte
- III.I. Name
- III.II. Rezeptionsgeschichte
- IV. Ulenspiegels Kritik durch den „Ständespiegel“
- IV.I. Adel
- IV.II. Klerus
- IV.III. Gelehrten
- IV.IV. Ärzten
- IV.V. Bauern
- IV.VI. Kritik an den Gilden und Zünften
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Ulenspiegelfigur, insbesondere im Kontext der Kritik, die der „Ständespiegel“ an seiner Umwelt übt. Es wird die Rezeptionsgeschichte des Ulenspiegelbuches beleuchtet sowie die Frage nach seiner Entstehung und dem möglichen Verfasser.
- Entstehungsgeschichte und Verfasserfrage des Ulenspiegelbuches
- Namensgebung und Rezeptionsgeschichte des Ulenspiegels
- Ulenspiegels Kritik an den verschiedenen Ständen (Adel, Klerus, Gelehrten, Ärzten, Bauern, Gilden)
- Die Verwendung von Akrosticha und der mögliche Einfluss von Hermann Bote und Thomas Murner auf das Werk
- Die historische Relevanz des Ulenspiegels als Spiegel der Gesellschaft seiner Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Ulenspiegels ein und beleuchtet seine Bedeutung als literarische Figur, die über Jahrhunderte hinweg Relevanz bewahrt hat. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des Ulenspiegelbuches und der damit verbundenen Verfasserfrage. Es werden die wichtigsten Druckfragmente und Editionen des Buches sowie die verschiedenen Theorien zur Autorenschaft präsentiert. Im dritten Kapitel werden die Namensgebung des Ulenspiegels sowie seine Rezeptionsgeschichte behandelt. Das vierte Kapitel widmet sich der Kritik, die der „Ständespiegel“ an den verschiedenen Ständen übt, wobei verschiedene Aspekte wie Adel, Klerus, Gelehrten, Ärzte, Bauern und die Kritik an den Gilden und Zünften beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Ulenspiegel, Ständespiegel, Kritik, Entstehung, Verfasserfrage, Rezeptionsgeschichte, Hermann Bote, Thomas Murner, Akrosticha, Schwankliteratur, Gesellschaft, Mittelalter, Frühe Neuzeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer war die historische Figur des Till Eulenspiegel?
Ulenspiegel (Eulenspiegel) ist eine literarische Figur, die als scharfsinniger Spaßmacher bekannt ist. In der ursprünglichen Fassung übt er jedoch eine viel direktere und schonungslosere Kritik an der Gesellschaft aus, als heute oft angenommen wird.
Was ist ein "Ständespiegel"?
Ein Ständespiegel ist eine literarische Form, die die verschiedenen Stände der Gesellschaft (Adel, Klerus, Bauern etc.) kritisch beleuchtet und deren Laster und Verfehlungen entlarvt.
Welche Stände kritisiert Ulenspiegel besonders?
Die Kritik richtet sich gegen den Adel, den Klerus, Gelehrte, Ärzte, Bauern sowie gegen die Gilden und Zünfte der damaligen Zeit.
Wer gilt als möglicher Verfasser des Ulenspiegel-Buches?
Die Verfasserfrage ist umstritten, oft werden jedoch Namen wie Hermann Bote oder Thomas Murner im Zusammenhang mit der Entstehung und Verbreitung der Schwankliteratur genannt.
Was bedeutet der Name "Ulenspiegel"?
Der Name leitet sich von "ulen" (reinigen/wischen) und "Spiegel" ab, was im übertragenen Sinne bedeutet, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten oder ihr "den Hintern zu zeigen".
- Arbeit zitieren
- Daniela Wuest (Autor:in), 2005, 'Narrenliteratur' - Ulenspiegel und seine Kritik durch den 'Ständespiegel', München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/60782