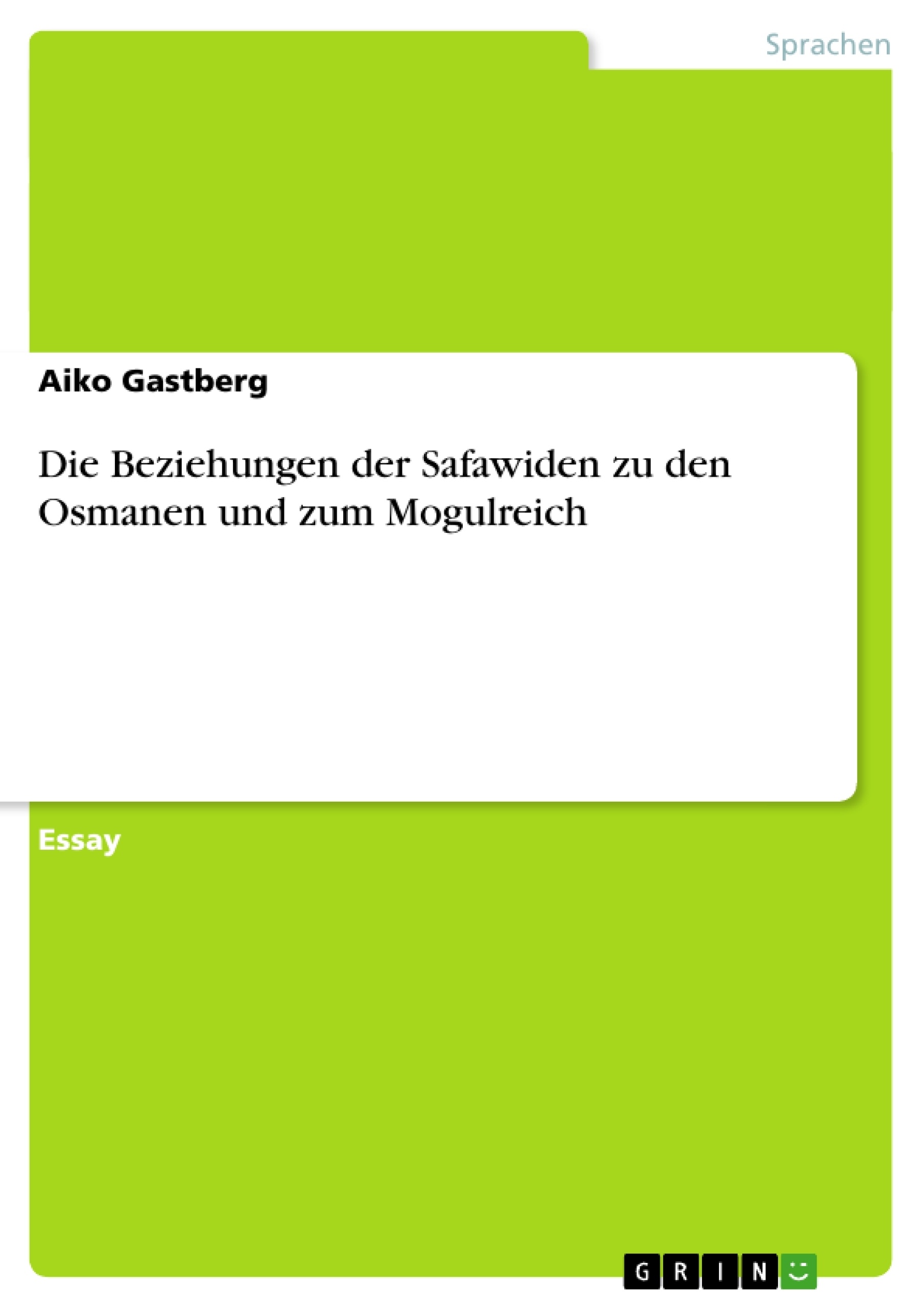Die Ära der Safawiden (DMG: Ṣafawīyya) ist maßgeblich für die neuzeitliche Entwicklung Persiens beziehungsweise des heutigen Iran. Sein gesamtes religiöses und politisches Staatssystem geht in seinen Grundzügen auf die Dynastie der Safwiden (1501-1722) zurück.
Neben der Bedeutung für die religiöse Entwicklung, also die Einführung der Zwölfer-Schia als Staatsreligion und die letztendliche Etablierung eines dauerhaft beständigen, schiitischen Staates, zählte das safawidische Persien neben dem Osmanischen Reich und dem Mogulreich in Indien zu den drei großen Imperien der frühen Neuzeit. Oft werden diese drei Reiche auch als „Gunpowder Empires“ bezeichnet, was wohl auch einen Teilbereich ihrer Machterfolge erklärt.
Das Safawidenreich erreichte seine größte Ausdehnung um 1510 und grenzte unmittelbar an das Osmanische Reich im Westen, das Khanat der Usbeken im Nordosten und das Mogulreich im Osten. Als schiitisches Reich – im Grunde eingekreist von sunnitischen Großmächten – nahm es allein aus diesem Grund einen Sonderstatus ein.
Dieses Essay beschäftigt sich mit den politischen Beziehungen und zuweilen militärischen Auseinandersetzungen der Safawiden mit den Osmanen und dem Mogulreich sowie (thematisch am Rande) mit den Beziehungen zu Europa.
Die Beziehungen der Safawiden zu den Osmanen und zum Mogulreich
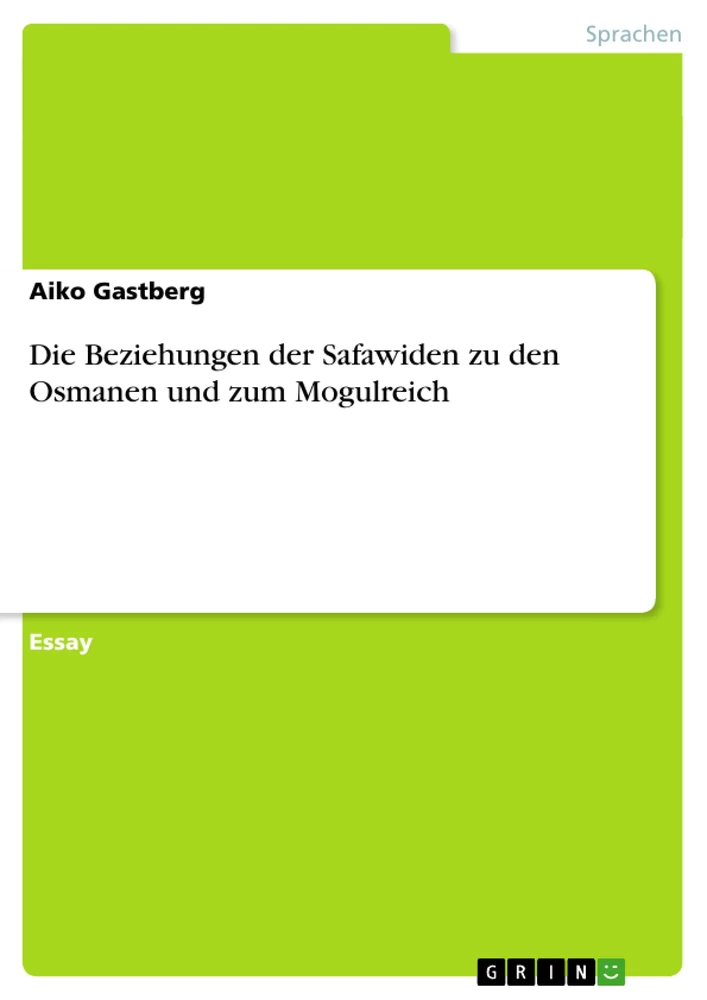
Essay , 2014 , 8 Seiten
Autor:in: Aiko Gastberg (Autor:in)
Orientalistik / Sinologie - Islamwissenschaft
Leseprobe & Details Blick ins Buch