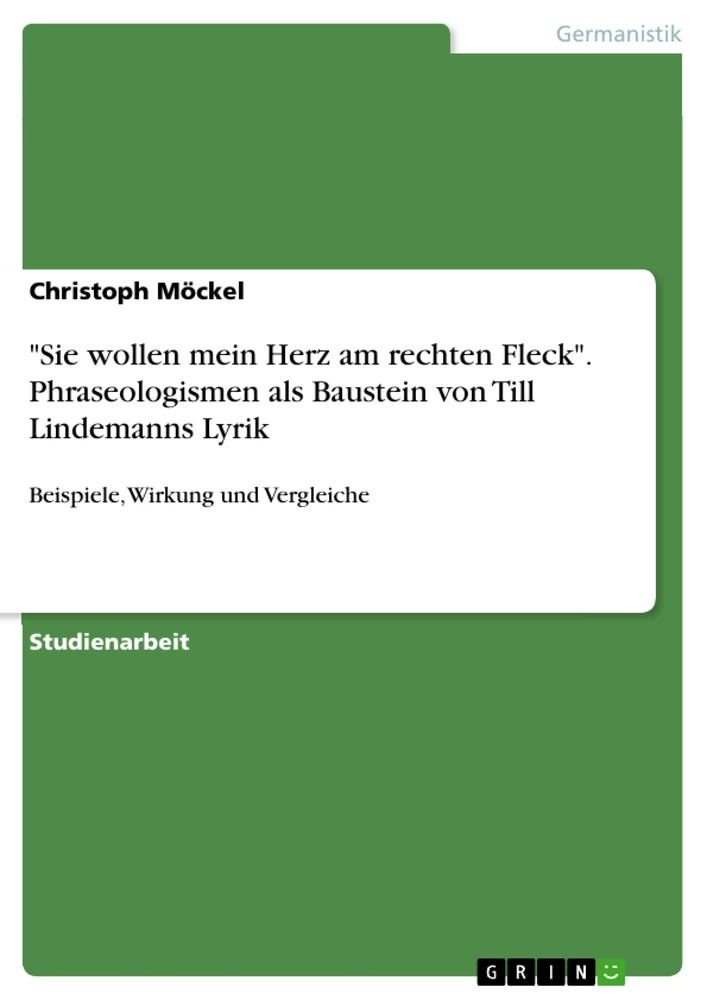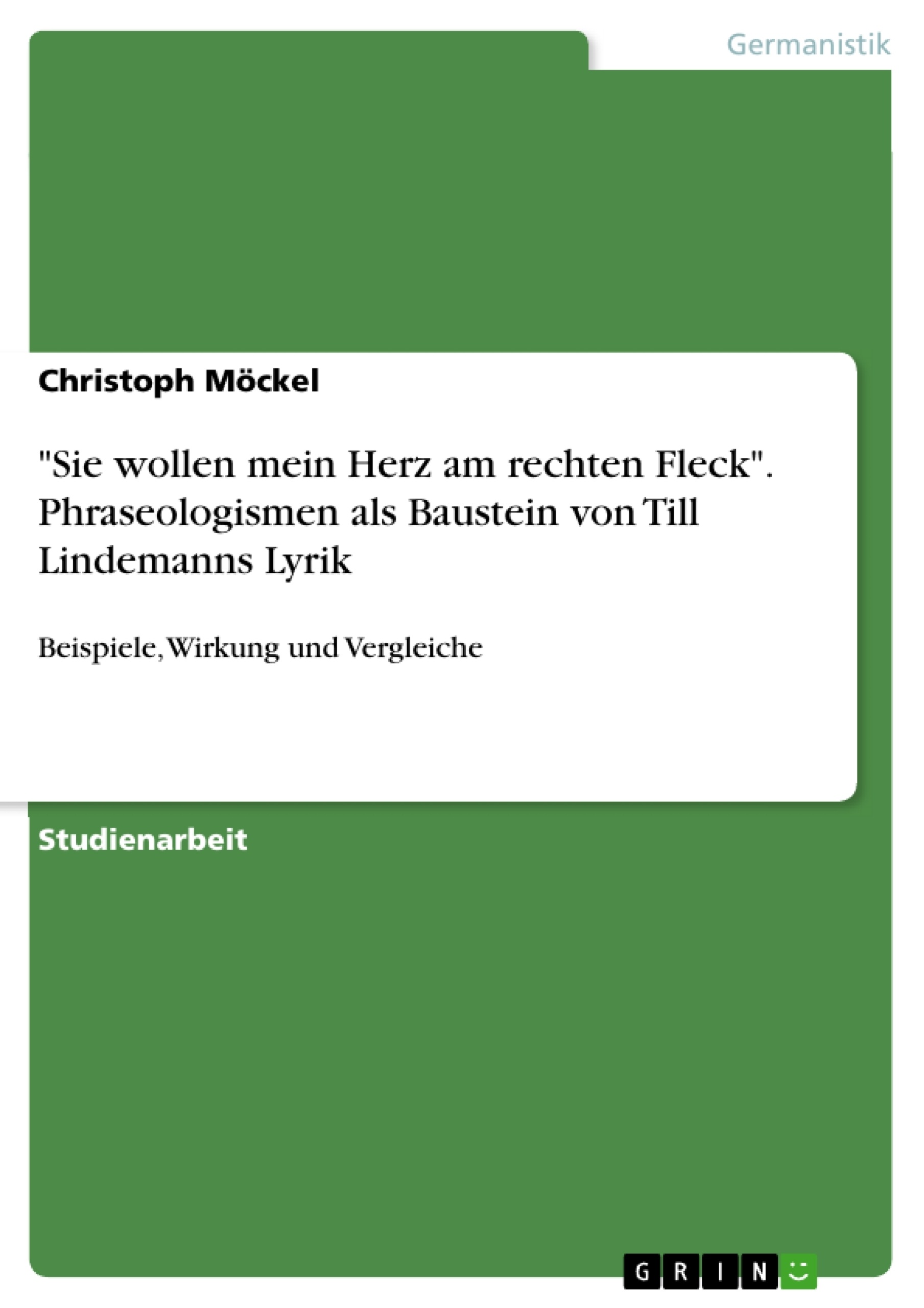Gutachten zur Hausarbeit:
"Der Verfasser legt mit seiner Untersuchung eine Arbeit vor, die weit über dem Niveau von Hausarbeiten der Q-Phase liegt. Obwohl auch literaturwissenschaftliche Aspekte berücksichtigt werden, hat die Arbeit einen eindeutigen sprachwissenschaftlichen Charakter. Der theoretische Teil bereitet äußerst gelungen und konzis die Analyse vor.
Sehr genau wird die Modifikation von Phraseologismen im künstlerischen Text herausgearbeitet.Der Autor zeigt ein großes Gespür für Plausibilitäten und untermauert seine Ergebnisse sogar mit eigenen Umfrageergebnissen. einer repräsentativen Gruppe von 20 Personen im Alter von 19-71 Jahren.
Im Ganzen handelt es sich um eine hervorragende Arbeit, in der sich sie liguistische Kompetenz des Verfassers manifestiert. Er ist, dies lässt sich nicht leugnen, Bewunderer der Lyrik Lindemanns, verfügt aber über die wissenschaftliche Fähigkeit, das Thema aus der Distanz zu betrachten und mit dem richtigen Instrumentarium zu untersuchen.
Deshalb, ohne Einschränkung: 1,0."
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Begriffsdefinition und Eingrenzung der Phraseologismen
2. Textbeispiele und deren Interpretationen unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen Anwendung von Phraseologismen
2.1 „Links 2,3,4“
2.2 „Rosenrot“
2.3 „Mein Teil“
2.4 „Mann gegen Mann“
3. Vergleich zu „Dankbar“ von Andreas Frege
4. Fazit
Quellenangabe