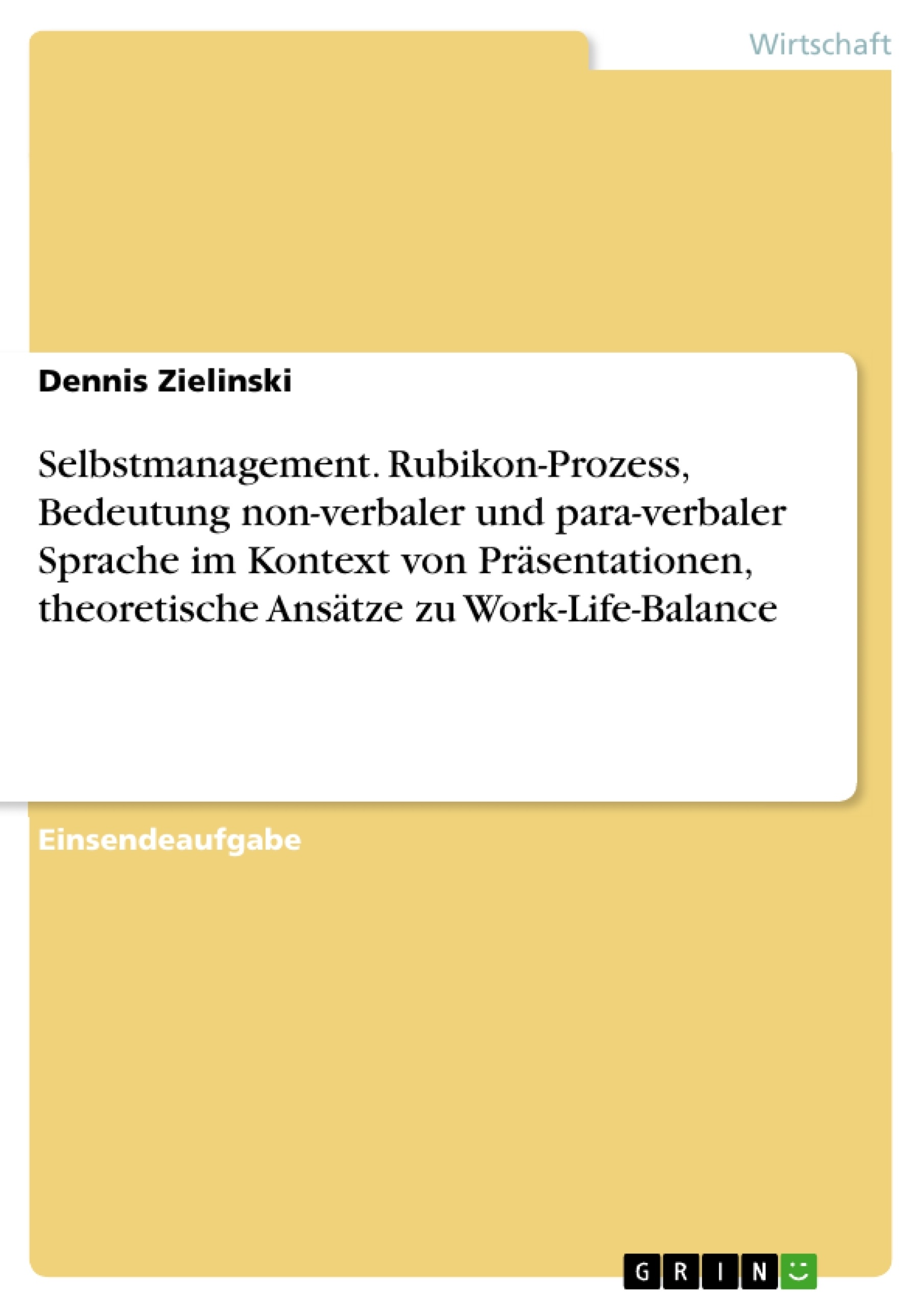Folgende Aufgabenstellungen werden in dieser Arbeit bearbeitet: Erläutern Sie den Rubikon-Prozess aus dem Zürcher Ressourcen Modell. Bilden Sie anschließend ein praktisches Beispiel hierzu.
Welche Bedeutung haben non-verbale und para-verbale Sprache im Kontext von Präsentationen? Diskutieren Sie diese Frage auf wissenschaftlicher Basis.
Erläutern Sie theoretische Ansätze zu Work-Life-Balance. Welche Kritik wird im Kontext dieser Ansätze diskutiert?
Selbstmanagement. Rubikon-Prozess, Bedeutung non-verbaler und para-verbaler Sprache im Kontext von Präsentationen, theoretische Ansätze zu Work-Life-Balance
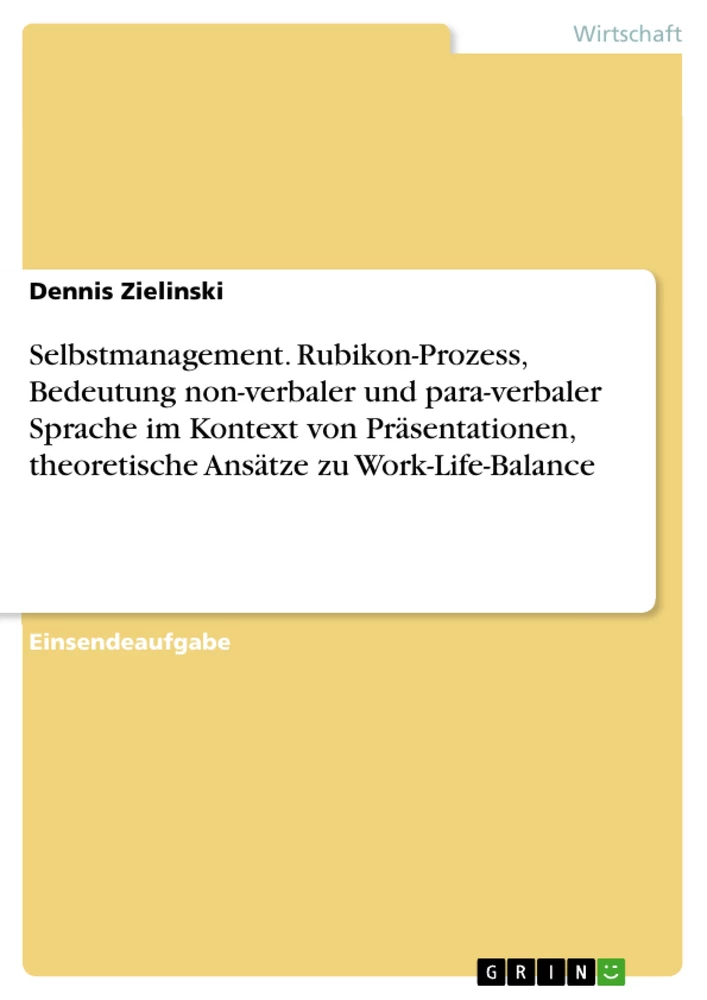
Einsendeaufgabe , 2022 , 20 Seiten , Note: 1,6
Autor:in: Dennis Zielinski (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch